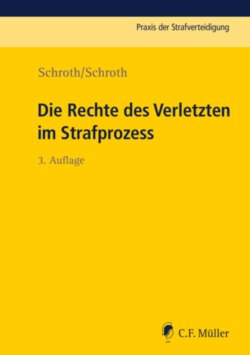Читать книгу Die Rechte des Verletzten im Strafprozess - Klaus Schroth - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеTeil 1 Die Entwicklung der Schutzrechte zugunsten des Verletzten › II. Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten vom 11.5.1976
II. Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten vom 11.5.1976
Teil 1 Die Entwicklung der Schutzrechte zugunsten des Verletzten › II. Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten vom 11.5.1976 › 1. Vorgeschichte
1. Vorgeschichte[1]
7
Das erste Gesetz, das die Verbesserung der Situation des Verletzten zum Ziel hatte, war das sog. „Opferentschädigungsgesetz“ aus dem Jahr 1976.[2] Bis zum Erlass dieses Gesetzes standen dem von einer Straftat Betroffenen nur wenige rechtliche Möglichkeiten zur Verfügung, einen hinreichenden Ausgleich für die erlittenen Schäden zu erlangen. Zum einen konnte der Verletzte den Zivilrechtsweg beschreiten und über die Anspruchsgrundlagen der §§ 823 ff. BGB versuchen, vom Täter Schadensersatz zu erlangen – Voraussetzung hierfür war jedoch, dass dieser überhaupt bekannt war. Das gleiche Problem stellte sich auch auf strafrechtlicher Ebene im Rahmen des Adhäsionsverfahrens gem. §§ 403 ff. StPO. Doch selbst in den Fällen, in denen der Täter zweifelsfrei feststand, konnte ein Ersatzanspruch nur durchgesetzt werden, wenn dieser über die notwendigen finanziellen Mittel zum Schadensausgleich verfügte. Auch Versicherungen boten oftmals keinen Schutz bei Beeinträchtigungen durch Gewaltverbrechen oder waren zu teuer. Angesichts dieser Situation reifte bereits in den späten 60er Jahren die Erkenntnis, dass dringend ein Tätigwerden des Gesetzgebers geboten sei.
8
Man hatte die Grundüberzeugung gewonnen, dass der Staat als Kehrseite seines Gewaltmonopols im Hinblick auf die Verbrechensbekämpfung auch die Pflicht habe, potentielle Opfer zu schützen: Wenn dies misslingt, muss der Staat wenigstens dem Verletzten einer Straftat zur Seite stehen.[3] Als zentrale Säule dieser spät erkannten staatlichen Solidarität gegenüber den Menschen, die trotz des verbrieften Grundrechts auf persönliche Sicherheit nicht vor kriminellen und gewalttätigen Übergriffen geschützt werden konnten, bedeutete der Anspruch auf staatliche, solidarische Entschädigung des Verletzten – ebenso wie ein funktionierender Schutz des Verletzten im Strafverfahren – für den Geschädigten auch ein Stück Hoffnung darauf, nicht noch einmal im Stich gelassen zu werden[4]. Gleichwohl konnten nicht alle Delikte, insbesondere im Bereich der Straßenverkehrsunfälle und der fahrlässigen Körperverletzung, von einem solchen Entschädigungsanspruch erfasst werden, zumal es aus Sicht des Staates niemals möglich ist, solche Schädigungen völlig einzudämmen. Insoweit obliegt es dem Bürger, sich – etwa durch Versicherungen – gegen diese zu schützen.[5]
Teil 1 Die Entwicklung der Schutzrechte zugunsten des Verletzten › II. Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten vom 11.5.1976 › 2. Wesentlicher Inhalt
2. Wesentlicher Inhalt
9
Mit dem „Opferentschädigungsgesetz“ hatte der Gesetzgeber eine besondere staatliche Verantwortung für bestimmte Verletzte, die oft plötzlich ohne jede Vorwarnung und ohne jedes Verschulden erwerbsunfähig, hilflos oder pflegebedürftig werden, als soziale Aufgabe und als Gebot der Gerechtigkeit anerkannt[6].
10
Das „Opferentschädigungsgesetz“ gab den von Gewalttaten Betroffenen die Möglichkeit, auf Antrag Versorgung in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Bundesversorgungsgesetzes zu erhalten. Eine Entschädigung für Sachschäden wurde hingegen nicht gesetzlich verankert. Der Anwendungsbereich umfasste nur vorsätzliche Schädigungen. Fahrlässige Körperverletzungen konnten keine Ansprüche begründen. Darüber hinaus blieben auch vorsätzliche Schädigungen durch Kraftfahrzeuge oder Anhänger unberücksichtigt, sodass Straßenverkehrsdelikte aus dem Anwendungsbereich herausfielen. Ein wesentliches Mitverschulden des Verletzten konnte im Rahmen der Versagungsgründe des § 2 OEG berücksichtigt werden. Die Entschädigung erfolgte nach versorgungsrechtlichen Grundsätzen[7].
Für weitere Ausführungen zur Opferentschädigung nach dem „Opferentschädigungsgesetz“, vgl. Teil 11.