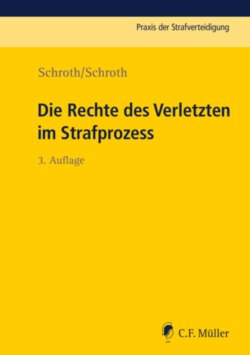Читать книгу Die Rechte des Verletzten im Strafprozess - Klaus Schroth - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеTeil 1 Die Entwicklung der Schutzrechte zugunsten des Verletzten › III. 1. Gesetz zur Verbesserung der Stellung des Verletzten im Strafverfahren vom 18.12.1986
III. 1. Gesetz zur Verbesserung der Stellung des Verletzten im Strafverfahren vom 18.12.1986
Teil 1 Die Entwicklung der Schutzrechte zugunsten des Verletzten › III. 1. Gesetz zur Verbesserung der Stellung des Verletzten im Strafverfahren vom 18.12.1986 › 1. Vorgeschichte
1. Vorgeschichte
11
Auch nach dem Erlass des sog. „Opferentschädigungsgesetzes“ fristete der von einer Straftat Betroffene in der wissenschaftlichen Diskussion noch ein „ausgesprochenes Schattendasein“[1]. Dies änderte sich in den frühen 80er Jahren. Der kriminologische Forschungszweig der Viktimologie, der sich ausschließlich mit Opfern von Straftaten beschäftigt, gewann zunehmend an Bedeutung. Der Gedanke, dem von einer Straftat Betroffenem als besonderem, da in eigenen Rechten verletzten, Zeugen auch im Strafverfahren eine dieser Stellung entsprechende Rolle zuzuweisen, hob sich von dem zuvor vorherrschenden Bestreben einer weitestgehenden Neutralisierung des Verletzten im Strafprozess ab. Dieser Neutralisierungsgedanke beruhte vor allem auf der Auffassung, dass ein Verletzter meist von Wut und Rache gesteuert wird, Vergeltung erstrebt und einer rationalen Konfliktverarbeitung im Wege steht[2]. Jung behandelte dann auf der Strafrechtslehrertagung in Bielefeld 1981 den Verletzten erstmals gleichrangig mit den übrigen Verfahrensbeteiligten.[3]
12
Gleichzeitig war es im Rahmen des Abschlusses der Strafvollzugsreform zu einer Ernüchterung in Bezug auf den bis dato vorherrschenden täterorientierten Resozialisierungsgedanken gekommen und andere Strömungen konnten an Einfluss gewinnen. Im Rahmen der Opferforschung erkannte man, dass das Ziel des Strafprozesses, für Rechtsfrieden zu sorgen, nur dann effektiv erreicht werden kann, wenn neben einer Ahndung der Störung des Rechtsfriedens durch die Straftat auch eine Sühne der individuellen Beeinträchtigung des Verletzten erfolgt. Sühne als Ziel von Strafrecht und Strafprozess könne nur unter Berücksichtigung beider Aspekte vollständig erreicht werden. Daneben wurde von Vertretern der viktimologischen Forschung hervorgehoben, dass die wenigsten Verletzten ein Mitverschulden an der Tat treffe und ein erheblicher Teil von ihnen daher hilfs- und schutzbedürftig sei.[4] Außerdem habe sich der Verletztenzeuge als wichtigste Instanz strafrechtlicher Sozialkontrolle herausgestellt, da ein Großteil der Strafverfahren erst durch private Anzeigen in Gang gesetzt würde und somit die Leistungsfähigkeit der staatlichen Strafverfolgung maßgeblich vom Anzeigeverhalten der Bevölkerung abhänge. Dieses werde dadurch gefördert, dass man dem Verletzten eine angemessene Stellung im Strafverfahren einräume. Diese Stellung müsse vornehmlich darauf gegründet sein, dass man den Verletzten, ebenso wie den Beschuldigten, als Subjekt und nicht nur aufgrund seiner Zeugenrolle als Objekt des Verfahrens anerkenne.[5] Dies folge schon aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht des Zeugen gem. Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG, aus dem das Bundesverfassungsgericht ein Recht auf ein faires Verfahren, insbesondere auf eine angemessene Behandlung und Ehrenschutz abgeleitet habe.[6] Rieß hat insoweit auch auf den „Grundsatz der Waffengleichheit“ hingewiesen, der für den Verletzten Schutzpositionen erfordere, die ihm eine Verteidigung gegen Angriffe und Verantwortungszuweisungen durch den Beschuldigten ermögliche.[7] Allerdings war in der Viktimologie auch stets anerkannt, dass die Stärkung der Rechte der Verletzten nicht auf Kosten der Rechte des Beschuldigten, dessen Täterschaft ja noch nicht feststeht, erfolgen darf.
13
Diese Überlegungen mündeten im Jahr 1984 in die auf dem 55. Deutschen Juristentag erhobene Forderung, die Schutzrechte des Verletzten auszubauen und insbesondere die sich aus rechtlich zulässigen Verteidigungsstrategien des Angeklagten ergebenden Härten für den Verletzten so weit als möglich auszugleichen und die Mitwirkungs- und Kontrollmöglichkeiten des Verletzten so auszugestalten, dass er seine legitimen Interessen im Falle ihrer Bedrohung selbst zur Geltung bringen kann.[8] Daneben fanden gerade in dieser Zeit einige öffentlichkeitswirksame Strafverfahren im Zusammenhang mit Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung statt, die für die Betroffenen erhebliche Belastungen mit sich brachten.
Vor diesem Hintergrund nahm sich der Gesetzgeber sehr schnell dem Problem der Stellung und der Rechte des Verletzten an. Während man noch kurz zuvor in Erwägung gezogen hatte, die Rechte der Verletzten zugunsten einer Entlastung der Justiz im Bereich des Strafverfahrens einzuschränken, änderte sich diese Meinung rasch in entgegengesetzter Richtung. Nach Schünemann hatte sich der Gedanke einer Verbesserung der Verletztenposition so rasch um sich gegriffen, dass alle anderen Ansätze überflügelt wurden und „in Windeseile“ konnten die dem Bundestag vorliegenden Gesetzesentwürfe durchgebracht werden.[9] Nachdem auch der Bundesrat in seiner Sitzung vom 28.11.1986 keinen Antrag nach Art. 77 Abs. 2 GG auf Einberufung des Vermittlungsausschusses gestellt hatte[10], trat das sog. „Opferschutzgesetz“ vom 18.12.1986[11] am 1.4.1987 in Kraft.
Teil 1 Die Entwicklung der Schutzrechte zugunsten des Verletzten › III. 1. Gesetz zur Verbesserung der Stellung des Verletzten im Strafverfahren vom 18.12.1986 › 2. Wesentlicher Inhalt
2. Wesentlicher Inhalt
14
Schwerpunkt des sog. „Opferschutzgesetzes“ war eine Neuordnung der Beteiligungsrechte des Verletzten im Strafverfahren. Der Begriff des Verletzten wurde allerdings nicht definiert, sondern seine normative Ausfüllung sollte der Auslegung im jeweiligen Funktionszusammenhang überlassen bleiben. Das Gesetz sah nicht für jeden in irgendeiner Weise Verletzten die gleichen Rechte vor, sondern differenzierte bei bestimmten Befugnissen nach der Intensität der Beeinträchtigung.
15
Wichtige und umfangreiche Änderungen durch das „Opferschutzgesetz“ ergaben sich im Bereich der Nebenklage, die somit einen Kernpunkt des Schutzes des Verletzten bildete.[12] Es blieb zwar wie bisher bei der Nebenklagebefugnis für Angehörige eines durch die Tat Getöteten sowie bei der Befugnis derjenigen, die die Anklageerhebung im Klageerzwingungsverfahren herbeiführen mussten; die vormalige, nur schwer einzusehende[13] und daher heftig kritisierte Verbindung der Nebenklagebefugnis mit der Berechtigung zur Privatklage wurde hingegen aufgegeben. Vielmehr zählte das neue Gesetz nunmehr enumerativ überwiegend schwere, gegen höchstpersönliche Rechtsgüter gerichtete Straftaten auf, die zukünftig die Nebenklagebefugnis begründen sollten. Hierzu gehörten insbesondere Kapitaldelikte, Körperverletzungen und Sexualstraftaten. Leichtere Straftaten aus dem Katalog der Privatklagedelikte, wie z.B. Hausfriedensbruch oder Sachbeschädigung, berechtigten nicht mehr zur Nebenklage. Die in der Praxis häufigen Fälle einer fahrlässigen Körperverletzung führten nicht mehr generell zur Nebenklagebefugnis; hier bedurfte es besonderer Gründe, z.B. schwere Verletzungsfolgen. Im Bereich der Straftaten gegen den gewerblichen Rechtsschutz und das Urheberrecht wurde die bis dato geltende Regelung beibehalten.
16
Die Verletzten erhielten in einem neu eingefügten 4. Abschnitt des 5. Buches in den §§ 406d bis 406h StPO das Recht auf Akteneinsicht sowie auf Beistandschaft eines Rechtsanwalts. Zudem wurden der Persönlichkeitsschutz und die Möglichkeiten zur Schadenswiedergutmachung verbessert. Im „Opferschutzgesetz“ wurde außerdem ferner der Versuch unternommen, das Adhäsionsverfahren aufzuwerten, da dieses zuvor in der Praxis nur eine geringe Rolle gespielt hatte. Die Streitwertgrenze wurde aufgehoben und der Erlass von Grund- und Teilurteilen ermöglicht. Außerdem konnte dem Antragsteller im Adhäsionsverfahren auf Antrag auch Prozesskostenhilfe gewährt werden. Das Absehen von einer Entscheidung blieb jedoch für das Gericht weiterhin möglich.
17
Weitere bedeutende Neuerungen brachte das „Opferschutzgesetz“ im Bereich des Schutzes der Persönlichkeitssphäre: Die Änderungen der §§ 68a und 247 StPO waren gewissermaßen ein „gesetzgeberischer Appell“, der alle Prozessbeteiligten „über den unmittelbaren, in seiner Wirkung wohl eher begrenzten Anwendungsbereich hinaus zu möglichst schonendem Umgang miteinander“ aufforderte.[14] Schließlich enthielt das „Opferschutzgesetz“ auch eine Neuregelung der Vorschriften über den Ausschluss der Öffentlichkeit.