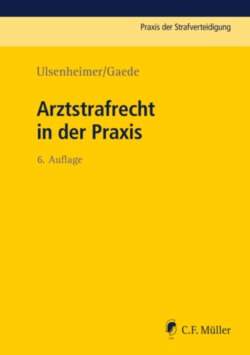Читать книгу Arztstrafrecht in der Praxis - Klaus Ulsenheimer - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Einleitung Zur praktischen Bedeutung des Arzt- und Medizinstrafrechts
Оглавление1-
42
| 1. | Unter der alarmierenden Überschrift „Ein gefährlicher Beruf“ kritisierte im Jahre 1911 der Strafrechtswissenschaftler Kohler mit scharfen Worten die „Weltfremdheit der Richter“[1] des Reichsgerichts, die in einem Entbindungsfall die Verurteilung des Arztes und der Hebamme durch das Landgericht Breslau wegen fahrlässiger Tötung bestätigt hatten. Mit Nachdruck wies der damalige Oberreichsanwalt Ebermayer[2] diese Kritik als haltlos zurück, denn „bekanntlich“ sei „nicht leicht eine Frage zweifelhafter als die der strafbaren Fahrlässigkeit, in keinem Falle“ bestehe eine „größere Gefahr, dass derselbe Tatbestand von verschiedenen Gerichten verschieden beurteilt wird“. Hätten „zwölf welterfahrene Ärzte“ zu Gericht gesessen, „so hätten wahrscheinlich sechs von ihnen das Verfahren ihres Kollegen gebilligt, sechs missbilligt“.[3] An dieser Problematik hat sich bis heute nichts Grundlegendes geändert. Doch waren Strafverfahren gegen Ärzte damals ausgesprochene „Raritäten“, die keinen „Anlass zur Beunruhigung der Ärzte im Allgemeinen“[4] gaben. 100 Jahre später jedoch zeigt eine kritische empirische Bestandsaufnahme, dass die von Kohler seinerzeit befürchtete „Gefährdung des ärztlichen Berufs“[5] durch das Strafrecht in unseren Tagen nicht als bloße Übertreibung, einseitige Panik- oder Stimmungsmache abgetan werden darf, sondern Realität geworden ist. Exaktes statistisches Material liegt leider nicht vor, da in den einzelnen Bundesländern die einschlägigen Ermittlungsverfahren und Strafurteile nicht zentral erfasst werden. Alle Einzelmitteilungen und Publikationen bestätigen jedoch die von einem Generalstaatsanwalt schon 1985 getroffene Feststellung, die Ermittlungsbehörden sähen „sich seit einigen Jahren in steigendem Maße mit Verfahren befasst, in denen Ärzte strafbarer Handlungen bezichtigt werden, die im Zusammenhang stehen mit der Ausübung ihres Berufs“.[6] Um nur zwei konkrete Zahlenangaben zu nennen: Die Ermittlungsverfahren wegen ärztlicher Behandlungsfehler bei der Staatsanwaltschaft Köln nahmen von 137 im Jahre 1998 auf 341 Verfahren im Jahr 2001 zu.[7] Dieselbe Entwicklung zeigt sich auch an den zunehmenden Obduktionen, die infolge von Behandlungsfehlervorwürfen gegen Krankenhausärzte, niedergelassene Ärzte, Notdienstärzte und Notärzte durchgeführt werden. Ihre Zahl hat sich z.B. im Zeitraum zwischen 1990 und 2000 auf über 4.000 verdoppelt.[8] Ein gewisser Rückschluss ist auch aus der Zahl zivilrechtlicher Klagen gegen Ärzte bzw. Krankenhäuser, den Anträgen bei den ärztlichen Schlichtungsstellen und Gutachterkommissionen sowie den Feststellungen der Krankenkassen möglich: Laut Statistischem Bundesamt wurden im Jahre 2018 in Arzthaftungssachen bei Amts- und Landgerichten bereits insgesamt 10.853 Zivilprozesse erledigt, nach einer Veröffentlichung der Bundesärztekammer 10.839 Schlichtungsverfahren im Jahre 2018 eingeleitet[9] und nach Angaben des MDK im gleichen Jahr bei Überprüfung von 14.133 Behandlungsvorwürfen 19,8 % als berechtigt anerkannt.[10] Wenn nur in 10 % bis 20 % dieser Fälle staatsanwaltschaftliche Ermittlungen durchgeführt wurden,[11] so errechnet sich daraus eine Zahl von deutlich über 2.000 staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren wegen ärztlicher Fehlleistungen im Diagnose- und Therapiebereich. Bedenkt man, dass in der Bundesrepublik 115 Landgerichte und Staatsanwaltschaften tätig sind, dann dürfte die von Ulsenheimer auf Grund dieser und anderer Detailangaben bzw. Hochrechnungen geschätzte Zahl von über 3.000[12] sog. Kunstfehlerverfahren nicht zu hoch, sondern eher zu niedrig gegriffen sein.[13] Dies gilt auch vor dem Hintergrund, dass die vermehrt diskutierte Verantwortlichkeit der sog. patientenfernen Entscheider zu einer Ausweitung der von der Verfolgung betroffenen Personen führen dürfte.[14] Es kommt hinzu, dass neben den allgemeinen, an jedermann gerichteten Delikten der §§ 222, 229 StGB eine ganze Reihe weiterer, meist allerdings Vorsatz fordernde Straf- und Ordnungswidrigkeitentatbestände existieren, die (auch) speziell für das ärztliche Handeln im Kontext von Diagnose und Therapie einschlägig sind. Beispielhaft genannt sein sollen hier lediglich der Schwangerschaftsabbruch (§§ 218 ff. StGB), der zeitweise drohende Tatbestand der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung (§ 217 StGB a.F.), die Verletzung der Schweigepflicht (§ 203 StGB), das Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse (§ 278 StGB), strafbare Verstöße gegen das AMG (§§ 95, 96), BtMG (§ 29), ESchG (§§ 1 ff.), GenDG (§§ 25 f.), GenTG (§§ 38 f.), HWG (§ 14), IfSG (§ 74), MPG (§ 41), StZG (§ 13), TFG (§ 31), TPG (§§ 18, 19) und UWG (§§ 16 ff.). In der Justizpraxis kommt diesen Delikten zwar regelmäßig eine vergleichsweise geringe Bedeutung zu. Sie unterstreichen jedoch, dass die heilberufliche Tätigkeit insbesondere des Arztes in diverser Hinsicht dem Strafrecht untersteht. Schließlich ist zu betonen, dass dem Arztstrafrecht mit dem heute fast omnipräsenten Medizinwirtschaftsstrafrecht eine zweite Hauptsäule neben dem klassischen, auf die Behandlung und ihre Umstände bezogenen Sektor erwachsen ist. Bereits seit einigen Jahrzehnten haben Strafverfahren gegen Ärzte mit vermögensrechtlichem Einschlag, also wegen Betrugs (§ 263 StGB), Untreue (§ 266 StGB) und der Korruptionsdelikte (zunächst die §§ 331 ff. StGB, sodann auch wegen § 299 StGB) große Bedeutung erlangt. Diese Verfahren haben die Geschäftsgestaltung und die Abrechnung im Gesundheitswesen zum Gegenstand und gehen insbesondere auf der Geberseite der Korruption über Ärzte als Beschuldigte weit hinaus. Sie betreffen insbesondere andere Heilberufe. Abrechnungsbetrug und Korruptionsdelikte etwa in Verbindung mit Leistungen der Pharmaindustrie sind immer häufiger Gegenstand staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen, ihre Zahl geht jährlich in die Tausende.[15] Unlängst hat diese Entwicklung mit der Schaffung der Spezialtatbestände der §§ 299a, 299b StGB, die sich explizit auf die Zurückdrängung der Korruption im Gesundheitswesen richten, ihren Höhepunkt erreicht. Die Einrichtung entsprechender Schwerpunktstaatsanwaltschaften verdeutlicht, dass es sich hierbei schon vor dem Hintergrund des im Gesundheitswesen stets vorhandenen Kostendrucks nicht nur um eine vorübergehende Modeerscheinung handelt.[16] Zu rechnen ist eher mit der weiteren Ausdehnung, was Debatten um einen ergänzenden speziellen Betrugstatbestand und die jüngste Fruchtbarmachung des § 266a StGB (zu ihr Rn. 1730 ff.) für das Gesundheitswesen nur nochmals unterstreichen. Das verfügbare Zahlenmaterial im Zivil- und Strafrecht und die jüngere Gesetzgebung zeigen eine eindeutige Tendenz: eine „Verrechtlichung“ der Medizin, die Ärzte als „Diktat juristischer Zwänge“ und „Kriminalisierung“ ihrer Tätigkeit nicht ohne Gründe beklagen und erheblich beunruhigt. Das Risiko, von einer Strafanzeige und einem eingeleiteten Strafverfahren mit erheblichen Konsequenzen betroffen zu sein, hängt aus der Perspektive der Betroffenen heute wie ein Damoklesschwert als ständige Bedrohung über der ärztlichen Heilbehandlung bzw. der Tätigkeit im Gesundheitswesen.[17] Sogar von Seiten der Staatsanwaltschaft wird zum Teil von einer „Inflation des Strafrechts“[18] gesprochen und in der Strafrechtswissenschaft nicht selten vor einem „Sanktionierungs- und Verfolgungseifer“[19] gewarnt. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass Verurteilungen von Ärzten wegen eines berufsspezifischen Fehlverhaltens insgesamt nur bei etwa 5 % der eingeleiteten Ermittlungsverfahren zu berichten und damit offenbar äußerst selten sind.[20] Die Einstellungsquote mangels hinreichenden Tatverdachts liegt mit einem Wert von bis zu über 80 % ebenso wie die Quote der Einstellung gegen Zahlung einer Geldauflage mit bis zu 15 % weit über dem bundesdeutschen Durchschnitt.[21] Zu berücksichtigen ist ferner, dass die genannten Zahlen vor dem Hintergrund von etwa 385.000 praktizierenden Ärzten und jährlich über 19 Mio. stationärer Eingriffe sowie 700 Mio. Behandlungsfällen im ambulanten Bereich sich letztlich „verschwindend gering“ ausnehmen.[22] So erfreulich gerade die letzte Bilanz für die Ärztinnen und Ärzte sicherlich ist, relativieren die genannten Zahlen die bestehenden Befürchtungen doch nur sehr graduell. Der Blick darf sich im Strafrecht nicht nur auf die Verurteilung richten: a) Schon ein Ermittlungsverfahren ist häufig existenzgefährdend, manchmal sogar existenzvernichtend, jedenfalls aber oft Ursache tiefgreifender persönlicher Belastungen und weitreichender Änderungen im privaten Lebensbereich.[23] Ärzte, die sich um Assistenzarzt-, Oberarzt- oder Chefarztpositionen bewerben, müssen in Fragebögen regelmäßig angeben, ob gegen sie ein Strafverfahren anhängig ist. Die Antwort „ja“ bedeutet praktisch, trotz oft guter Qualifikation und des Bewerbermangels, dass der Betreffende nicht in die engere Wahl kommt und damit – jedenfalls temporär – den Verlust jeglicher Chancen auf beruflichen Erfolg. Verschweigt der Arzt aber wahrheitswidrig das anhängige Strafverfahren, riskiert er die fristlose Kündigung.[24] Suspendierungen vom Dienst, Arbeitsplatzverlust durch Kündigung während der Probezeit oder außerordentlich nach einem Schuldspruch, manchmal sogar fristlos (!) bei Vorliegen eines bloßen „Kunstfehler“-Verdachts – vor Verurteilung durch ein Gericht oder Anklageerhebung (!) – sind in der Praxis keine Seltenheit.[25] Sie machen deutlich, zu welch schwerwiegenden Konsequenzen die Einleitung und Durchführung eines Ermittlungsverfahrens für den Betroffenen nur allzu oft führen. Vor allem die älteren, also regelmäßig besonders erfahrenen Ärztinnen und Ärzte, die nie etwas mit Gericht oder Staatsanwaltschaft zu tun hatten, stehen fassungslos der Durchsuchung von Praxisräumen, der Beschlagnahme von Krankenblattunterlagen und sonstigen Zwangsmaßnahmen gegenüber und vermögen sich in der – völlig ungewohnten und als ehrenrührig empfundenen – Rolle des Beschuldigten nicht zurechtzufinden. b) Außenstehende Dritte haben häufig keine bzw. nur eine unzureichende Vorstellung von den psychischen und physischen Belastungen, den Unannehmlichkeiten und Misslichkeiten eines Ermittlungsverfahrens, insbesondere wenn es zu einer Anklage kommt. Richtern und Staatsanwälten sind diese zwar grundsätzlich bewusst. Sie werden aber doch meist erheblich unterschätzt bzw. verdrängt.[26] Im Gegensatz zu Zivilprozessen um Schadensersatz und Schmerzensgeld, in denen ebenfalls ärztliche Pflichtverletzungen öffentlich erörtert werden, üben Strafverfahren und – häufig mehrtägige – Hauptverhandlungen ganz offensichtlich eine besondere, geradezu magische Anziehungskraft auf Laien aus.[27] Deshalb wird schon der Inhalt der Anklageschrift meist publiziert. Er entfaltet dann seine stigmatisierende Wirkung, oftmals mit Namensnennung und Vorverurteilung des Arztes. Denn allzu rasch und leicht zieht der Laie aus einem Zwischenfall oder einer Komplikation den Schluss auf ein Fehlverhalten oder Verschulden des Arztes (sog. Rückschaufehler, dazu näher Rn. 69 und 89), weil er die Komplexität des Sachverhalts, die naturwissenschaftlichen Zusammenhänge und die eingriffsspezifischen Risiken nicht kennt bzw. nicht genügend berücksichtigt.[28] Die zentrale Unterscheidung zwischen Unrecht und Unglück bleibt dadurch auf der Strecke. Während vor dem Zivilgericht kaum je ein Zuhörer anwesend ist, finden strafgerichtliche Hauptverhandlungen oft in breitester Öffentlichkeit vor einem gefüllten Zuschauerraum und vor der Presse statt. Dies führt zu einer fast archaischen „Prangerwirkung“, die Ruf und Ansehen des Angeklagten in persönlicher und beruflicher Hinsicht oft dauerhaft schädigt.[29] Dabei spielt der Ausgang des Prozesses kaum noch eine Rolle. Denn selbst wenn der Angeklagte freigesprochen oder das Verfahren eingestellt wird, gilt gerade in diesen Fällen der Satz: semper aliquid haeret, zumal wenn die Hauptverhandlung in kleinen Städten stattfindet und damit der individuelle Bekanntheitsgrad des Arztes das allgemeine Interesse zusätzlich weckt. So löst derselbe Fehler, der im Zivilprozess ohne größeres Aufsehen die Zahlungspflicht des Arztes bzw. der Versicherung begründet, im Falle einer Strafanzeige allein durch den ganz anderen Verfahrensgang und die damit mögliche Publizität mitunter verheerende Wirkungen mit meist nur schwer vorhersehbaren Weiterungen aus. Strafverfahren wegen berufsbedingter Pflichtverstöße und Versäumnisse sind deshalb in Ärztekreisen mit Recht besonders gefürchtet und werden als besonders bedrückend empfunden. Viele der beschuldigten Ärzte resignieren daher, sind nicht mehr bereit, Verantwortung zu übernehmen und stellen ihre operative Tätigkeit ein. Sie lassen sich, wenn möglich, vorzeitig pensionieren, vollziehen einen Berufswechsel innerhalb der medizinischen Fächer weg von den besonders haftungsträchtigen operativen Fachgebieten – Gynäkologie, Chirurgie, Orthopädie und Anästhesie – oder geben den Arztberuf gänzlich zugunsten einer anderen, weniger risikoreichen Berufstätigkeit im Außendienst eines Unternehmens oder im Management eines Krankenhauses auf. c) Hinzu kommt als weiteres belastendes Moment die lange Dauer der Ermittlungsverfahren, die sich meist über ein Jahr, häufig bis zu zwei Jahren und bei Einschaltung mehrerer Gutachter verschiedener Fachrichtungen auch noch deutlich länger hinziehen. Dies schafft Unsicherheit und Ungewissheit, die noch dadurch verstärkt werden, dass schon der bloße Verdacht einer strafbaren Handlung, aus der sich die Unwürdigkeit oder Unzuverlässigkeit des Arztes zur Ausübung seines Berufs ergibt, u.U. zum Ruhen der Approbation bzw. zur Aussetzung ihrer Erteilung (§§ 3 Abs. 5, 6 BÄO) führen kann.[30] Auch die Tatsache, dass staatsanwaltschaftliche Ermittlungen wegen eines berufsspezifischen Fehlverhaltens stets berufsrechtliche Verfahren auslösen[31] und wegen des möglichen „berufsrechtlichen Überhangs“ keineswegs „automatisch“ mit der Einstellung des Strafverfahrens ihr Ende finden, erhöht die persönliche Drucksituation und Zukunftsangst des Beschuldigten. d) Schließlich dürfen bei der Betrachtung der ärztlichen Haftungsstatistik die über den Einzelfall hinausgehenden Fernwirkungen in der gesamten Ärzteschaft nicht übersehen werden. Der erlebte Rechtsfall pflegt eine andere Einschätzung zu implizieren[32] als die bloße Analyse aus der kritischen Distanz des weder unmittelbar noch mittelbar beteiligten Juristen. Unter dem Eindruck des Haftungs- und Strafbarkeitsrisikos dürfte gerade der ehrliche, selbstkritische und dem salus aegroti verpflichtete Arzt vorsichtiger werden. Er prüft nicht mehr unbefangen, was für den Kranken aus medizinischer Sicht am zweckmäßigsten ist,[33] sondern sein Bestreben geht dahin, sich vor den etwaigen juristischen Folgen seiner Behandlungstätigkeit zu schützen. Indem der Arzt bei Diagnose und Therapie „auch die eigenen forensischen Gefahren bedenken und als indizierende wie kontraindizierende Faktoren ins Kalkül ziehen“ muss, droht „aus der verrechtlichten eine defensive Medizin [zu werden], die aus Scheu vor der Klage zu viel untersucht oder zu wenig an Eingriffen wagt“.[34] „Überängstlichkeit“ und „entscheidungshemmender Immobilismus“ sind die Folgen.[35] |
| 2. | „Ein solcher Wandel wird sich langsam und fast unmerklich vollziehen, zum Schaden der Gesamtheit und zum Schaden des einzelnen Kranken“, der „die Auswirkungen des ärztlichen Sicherheitsbedürfnisses zu spüren bekommt“.[36] Er ist letztlich der Leidtragende dieser Tendenz, die teils bewusst, teils unbewusst vor dem Hintergrund der zivil- und strafrechtlichen Haftungskonsequenzen das Denken und Handeln des Arztes bestimmt und manchmal rational, oft irrational seine innere Einstellung zum Kranken prägt. Dienst nach Vorschrift, fehlende Risikobereitschaft, Unsicherheit und Unselbstständigkeit, Absicherung durch Formulare und Verantwortungsscheu sind äußere Zeichen einer solchen Haltung, bei der der Arzt zugunsten der eigenen Sicherheit sein ärztliches Gewissen und das Wohl des Patienten zurückstellt und sich mehr an der Empfehlung seines Rechtsanwalts orientiert.[37] Die Verrechtlichung der ärztlichen Tätigkeit“ führt also „nicht zwangsläufig zu einer besseren medizinischen Versorgung“.[38] Anstelle der erstrebten Sicherung des jeweiligen bestmöglichen Behandlungsstandards beschleunigt sie ggf. nur den unheilvollen Weg in die defensive Medizin mit all ihren negativen Auswirkungen auf die Therapie,[39] für die Kosten unseres Gesundheitssystems und für die Weiterentwicklung der Medizin im Ganzen.[40] Ärztliches Handeln kann sich allerdings selbstverständlich auch nicht im rechtsfreien Raum abspielen; es muss rechtlicher Kontrolle unterliegen und der Arzt steht wie jeder andere Bürger „unter dem allgemeinen Gesetz“.[41] Dennoch erscheint die Frage berechtigt, ob der Schutz der Patienten vor unsorgfältigen oder gar selbstherrlichen Ärzten[42] weiter in dem Umfang wie gegenwärtig gerade mit strafrechtlicher Verfolgung und Sanktion angestrebt werden sollte. Zum einen darf die Wirksamkeit des Strafrechts auf dem medizinischen Sektor nicht überschätzt, zum anderen darf seine oft zu scharfe und deshalb zu viel zerstörende Kraft nicht unterschätzt werden. Sowohl in der Gesetzgebung als auch in der Anwendungspraxis der Strafverfolgungsorgane muss der Rückgriff auf das Strafrecht vor dem Hintergrund seiner Eingriffstiefe und -streuung maßvoll bleiben. Kein geringerer als der berühmte Strafrechtler Binding[43] hat vor dem „Expansionsdrang“ des Strafrechts gewarnt, seinen „fragmentarischen Charakter“ betont und die Selbstbeschränkung des Strafgesetzgebers angemahnt. Auch im Gesundheitswesen muss die Subsidiarität des Strafrechts anerkannt und die staatliche Strafgewalt die ultima ratio[44] bleiben. Dies gilt unter anderem deshalb, weil mit dem Entzug der Zulassung als Vertragsarzt oder der Approbation insbesondere berufsrechtliche Sanktionen denkbar sind. Bedeutsam ist die Subsidiarität insoweit nicht nur für den Umgang mit der zukünftigen Gesetzgebung oder der Bewertung jüngerer Strafgesetze. Auch unter dem Gesichtspunkt der Präzisierungspflicht gemäß Art. 103 Abs. 2 GG[45] müssen die Staatsanwaltschaften und Gerichte vielmehr sowohl bei allgemeinen Delikten wie den §§ 222, 229 StGB als auch bei den spezielleren Vorschriften der §§ 299a, 299b StGB absichern, dass sich die Rechtsanwendung nicht unter der Hand nochmals weiter von den tragenden Gründen der Kriminalisierung und den geschaffenen Tatbestandsmerkmalen entfernt. So ist es bei den §§ 222, 229 StGB geboten, die Fahrlässigkeit ggf. ausschließende Therapiefreiheit des Arztes effektiv zu achten und eine von Rückschaufehlern geprägte Grundhaltung der Verfolgungsorgane zu vermeiden.[46] Für die Korruptionsdelikte sind beispielsweise die vom Gesetzgeber schon für die Ermittlungspraxis gezogenen Grenzen zu achten.[47] Erst recht darf die staatliche Durchsetzungsmacht nicht missbraucht werden, um (hohe) Zahlungen gemäß § 153a StPO zu erpressen.[48] Darüber hinaus wird eine Entkriminalisierung in Teilbereichen vorgeschlagen, auch um moderne Methoden des Risiko- und Qualitätsmanagements zu ermöglichen, welche die Furcht vor Strafe bisher behindere.[49] Insbesondere wird darüber nachgedacht, die strafrechtliche Verantwortlichkeit des Arztes für die fahrlässige Körperverletzung auf grobe Behandlungsfehler zu begrenzen,[50] das Delikt als absolutes Antragsdelikt auszugestalten und die leicht fahrlässige Verletzung ausschließlich dem zivilrechtlichen Schadensersatz und Schmerzensgeld vorzubehalten, so wie dies in einer ganzen Reihe von Ländern, z.B. den USA, Frankreich und Österreich der Fall ist.[51] Eine optimale und realistisch zu verfolgende Lösung dürfte darin indes nicht liegen. Eine verfassungs- oder konventionsmäßige Pflicht zur Bestrafung in jedem Einzelfall besteht zwar tatsächlich nicht.[52] Die Neuregelung, für die eine politische Durchsetzbarkeit absehbar fehlt, dürfte aber als „Ärzteprivileg“ wahrgenommen werden, das Patienten eher beunruhigt und Misstrauen sät. Ermittlungsverfahren könnten noch immer mit der – für den Staatsanwalt ohne Sachverständige kaum zu beurteilenden – Behauptung eingeleitet und fortgeführt werden, es sei ein grober Aufklärungs- oder Behandlungsfehler vorgefallen. Vorzugswürdig dürfte es sein, bereits de lege lata die ausschlaggebende Sorgfaltswidrigkeit selbst zu präzisieren[53] und die vollständige Übernahme der oft allzu weiten Aufklärungspflichten des Zivilrechts in das Strafrecht aufzugeben[54] (siehe Rn. 339 f.). |
| 3. | Fragt man nach den Gründen für die Haftungsausweitung und damit für den steilen Anstieg der zivil- und strafrechtlichen Verfahren gegen Ärzte in den letzten 30 Jahren, so gibt es keine monokausale Erklärung, vielmehr sind die Ursachen für die Ausweitung im klassischen Arztstrafrecht vielgestaltig, teils ineinander verwoben und voneinander abhängig.[55] Sie liegen – von der existenziellen Bedeutung vieler Sachverhalte abgesehen – im Bereich der Medizin selbst, in der grundlegenden Änderung der inneren Einstellung des Patienten zum Arzt, d.h. der gesellschaftlichen Verhältnisse, und schließlich – damit zusammenhängend – im Wandel der höchstrichterlichen Judikatur und Gesetzgebung. a) Der atemberaubende Fortschritt der Medizin mit seiner ungeahnten Ausweitung der Behandlungsmethoden und der Perfektionierung der Technik lässt den Arzt heute „mit weit aggressiveren und damit […] risikoreicheren Methoden als früher“ arbeiten.[56] „Die Eingriffe werden immer komplizierter, die Anforderungen an die technischen Fertigkeiten und den zeitlichen Aufwand der Ärzte immer höher“.[57] Mit der Größe des Risikos wächst jedoch nicht nur die Quote des schicksalshaft bedingten ärztlichen Misserfolgs, sondern notwendigerweise „auch die Rate ärztlicher Fehlleistungen“.[58] b) Als Folge der „Leistungsexplosion“ der Medizin nehmen zugleich die Möglichkeiten der Fehleranalyse, Kontrolle und somit Aufdeckung etwaiger persönlicher oder sachlicher Unzulänglichkeiten zu.[59] Diese Entwicklung wird von der problematischen Fehleroffenlegungspflicht des § 630c Abs. 2 S. 2 BGB noch verstärkt. c) Die immer komplizierter werdende Organisation und wachsende Arbeitsteilung in der Medizin vermehren die Probleme der Zusammenarbeit von Ärzten und Pflegepersonal.[60] Denn: „Je größer die Zahl der an Diagnose und Therapie beteiligten Ärzte, Techniker und Hilfskräfte, je komplizierter und gefährlicher die apparativen und medikamentösen Mittel, je komplexer das arbeitsteilige medizinische Geschehen in einem großen Betrieb, desto mehr Umsicht und Einsatz erfordern die Planung, die Koordination und die Kontrolle der klinischen Abläufe“.[61] Fortschreitende Spezialisierung und Subspezialisierung, Substitution und Delegation in der Medizin erhöhen die Zahl der Schnittstellen und damit die Möglichkeiten organisatorischer Versäumnisse in Gestalt von Koordinations-, Kommunikations-, Kontroll- und Auswahlfehlern. d) Hinzu kommt die Personalknappheit: Der dadurch ausgelöste ständige Zeit- und Arbeitsdruck im Alltag der Patientenversorgung (euphemistisch: „Arbeitsverdichtung“) erzeugt Stress, Unsicherheit, Übermüdung und Konzentrationsmängel – Umstände, die ein Fehlverhalten insbesondere bei Berufsanfängern begünstigen. e) Die Anonymität der „Apparatemedizin“, die Unpersönlichkeit vieler Großkliniken und mangelnder vertrauensbildender Kontakt zwischen Patient und Arzt stellen eine stetig sprudelnde Quelle von Misstrauen und Skepsis dar, ein geradezu idealer Nährboden für Vorurteile und Konfrontation. f) Kollegenneid, Intrigen, Missgunst und Konkurrenzdenken der Ärzte untereinander, insbesondere als Folge der verschlechterten wirtschaftlichen Bedingungen, sind häufig Ursachen für den Gang des Patienten zum Anwalt oder Staatsanwalt. Hausärzte und Fachärzte, Klinikärzte und niedergelassene Ärzte bekämpfen sich wechselseitig im Ringen um finanzielle Vorteile. Bemerkungen des nachbehandelnden Arztes wie: „Ja, wer hat denn an Ihnen herumgemurkst?“ oder: „Das würde ich nicht auf mir sitzen lassen.“, weisen in diese Richtung. Auch einseitige Sachverständigengutachten zu Lasten eines Kollegen unterstützen nicht selten dieses Vorgehen. g) Das für die frühere Zeit charakteristische Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient ist vielfach von einer rein geschäftsmäßigen, vertraglichen Beziehung abgelöst worden: Obschon einem übermäßigen Paternalismus nicht das Wort zu reden ist, ist doch festzuhalten, dass die Krankenbehandlung von beiden Seiten vermehrt als „Rechtsverhältnis“ wahrgenommen wird. Dies findet auch im Patientenrechtegesetz einen sichtbaren Ausdruck. Ziel dieses Gesetzes ist es, die Rechte der Patientinnen und Patienten[62] deutlich herauszustellen und die zahlreichen Pflichten des Arztes festzuschreiben. Dies kann die Klagefreudigkeit auf Patientenseite weiter beflügeln.[63] h) Das durch pseudowissenschaftliche Veröffentlichungen und populäre Erfolgsberichte ausgelöste übersteigerte Anspruchsdenken und die überzogene Erwartungshaltung der Patienten schließen aus Patientensicht den Misserfolg aus.[64] Die Folge davon sind Fortschrittsschelte und Medizinkritik, Unverständnis über ärztliches Versagen und nicht selten „der Gang zum Kadi“. i) Das gewachsene Selbstbewusstsein und die stärkere Konfliktbereitschaft der Patienten, befreit vom Kostenrisiko eines zweifelhaften Prozesses durch Rechtsschutzversicherungen, Prozessfinanzierungsgesellschaften, die Klagen gegen Ärzte als besonders „geeignet“ ansehen, und gefördert von Anwälten aus manchmal durchsichtigen eigenen Interessen,[65] beseitigen bzw. vermindern die psychologische Hemmschwelle, gegen „seinen“ Arzt und die Anstellungskörperschaft vorzugehen. j) Vergeltungswunsch, Ärger, Hass und ähnliche Motive des geschädigten Patienten oder seiner Familienangehörigen, oftmals ausgelöst durch fehlendes Einfühlungsvermögen, mangelnde Gesprächsbereitschaft und ungeschicktes (kommunikatives) Verhalten des betroffenen Arztes nach einem Zwischenfall, führen zu Strafanträgen und Strafanzeigen in nicht wenigen Fällen. k) Kosten- und risikolose Auskunfts- und Akteneinsichtsrechte des Verletzten im Strafprozess machen es – scheinbar – leicht, sich die für den Zivilprozess erforderlichen Unterlagen und Beweise über das staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren zu beschaffen. Oft fruchtlose, aber sicher belastende Ermittlungsverfahren werden so eingeleitet, um das eigentliche Ziel des Schadensersatzanspruchs durchzusetzen. l) Einseitige antiärztliche Berichterstattung in Presse und Medien über die „Halbgötter in Weiß“ und reißerisch aufgemachte Presseberichte über ärztliche Fehler haben ein verzerrtes, negatives Arztbild entstehen lassen, das von Patientenschutzbünden und anderen Vereinigungen nachhaltig „gepflegt“ wird. Bisweilen nehmen Staatsanwälte solche Berichte sogar zum Anlass, Ermittlungsverfahren einzuleiten. m) Krankenkassen überprüfen zunehmend selbständig oder „sollen“ bei Verdacht auf Behandlungsfehler den Patienten mit Hilfe des „Medizinischen Dienstes“ unterstützen (§ 66 SGB V) und erstatten bisweilen selbst Strafanzeige. Auch private Krankenversicherungen gehen in gleicher Weise vor. All dies ist insbesondere im Kontext der Abrechnungen nicht selten von dem primären Ziel getragen, die eigene Bilanz ggf. sogar durch den Einsatz einer eigenen Taskforce aufzuhellen: Kassen suchen auch ohne Anhaltspunkte für eine qualitativ schlechte Versorgung der Patienten gezielt Felder, auf denen sie infolge des – im Strafrecht fatal wirkenden – Anspruchsverlusts bei Verstößen gegen Abrechnungsvorschriften windfall profits erzielen können. n) Todesermittlungsverfahren nach Feststellung eines „unnatürlichen“ oder „nicht aufgeklärten“ Todes auf dem sog. Totenschein gemäß § 159 StPO münden bei „zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkten“ in ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Tötung oder Körperverletzung. o) Das Arzthaftungsrecht ist in seinen Voraussetzungen und Folgen weitgehend durch die Spruchpraxis der Zivilgerichte geformt worden. Mit ihren unter Umständen überzogen scheinenden Anforderungen an die ärztliche Aufklärungspflicht, insbesondere hinsichtlich des Umfangs der Aufklärung bei den sog. eingriffsspezifischen Risiken, sowie durch vielfältige Beweislastregelungen zugunsten der Patienten, etwa bei groben Behandlungsfehlern, unzulänglicher oder fehlender Dokumentation, mangelnder Befunderhebung oder bei Gerätedefekten wurden im Laufe der letzten drei Jahrzehnte die Möglichkeiten der Patienten, gegen Ärzte und Krankenhäuser vorzugehen, erheblich ausgeweitet und damit die Klagefreudigkeit nachhaltig gestärkt. Dies blieb nicht ohne Rückwirkung auf die strafrechtliche Verfolgungshäufigkeit. Da das neue Patientenrechtegesetz das erklärte Ziel verfolgt, Patientinnen und Patienten bei der Durchsetzung ihrer Rechte zu unterstützen, setzt dieses Gesetz einen weiteren Impuls zu mehr Klagen und damit zu mehr flankierenden Strafanträgen und Strafanzeigen. p) Auch die strafrechtliche Judikatur und Verfolgungspraxis der Staatsanwaltschaften tragen erheblich zur Strafbarkeitsexpansion im Arztrecht bei. Hervorzuheben sind insoweit: die fast ausnahmslose, nicht revisibele Bejahung des „besonderen öffentlichen Interesses“ bei fahrlässiger Körperverletzung (§ 230 StGB), die erleichterte Kausalitätsfeststellung bei §§ 222, 229 StGB, das Einschreiten ex officio bei fehlender oder nicht ordnungsgemäßer Aufklärung, die Unterstellung vorsätzlichen Handelns im Rahmen des § 323c Abs. 1 StGB sowie die Überdehnung des Untreue- und Betrugstatbestandes im Gesundheitswesen. |
| 4. | Durchmustert man die aufgezeigten Gründe für den enormen Anstieg der strafrechtlichen Arzthaftung, so lässt sich auch für die §§ 222, 229 StGB vorhersagen, dass auf absehbare Zeit mit einem Rückgang kaum zu rechnen ist. Die forensischen Risiken für die Ärzte werden weiter wachsen.[66] Denn alle genannten Einflussgrößen nehmen an Gewicht weiterhin zu, besonders die Verrechtlichung des Verhältnisses zwischen Arzt und Patient,[67] die immer weiter perfektionierte Apparatemedizin, die Spezialisierung und damit einhergehende Arbeitsteilung, Unpersönlichkeit und „Massenabfertigung“ in Großkliniken sowie der Zeit- und Konkurrenzdruck. Hinzu kommt der Zeitgeist, in einer erfolglosen Therapie, einer tödlichen Komplikation oder misslungenen Operation, besonders bei kleineren Eingriffen oder Routineeingriffen, in erster Linie ein menschliches Versagen zu sehen und hinter schicksalshaften Geschehensabläufen sofort den Arzt als schuldigen Urheber zu suchen. Dabei wird außer Acht gelassen, dass „zwischen Schicksal und Schuld unterschieden werden“[68] muss, weil der menschliche Körper nicht gleich einer Maschine beherrschbar, sondern in seiner Individualität weithin ein Geheimnis bleibt und es deshalb „kaum eine ärztliche Tätigkeit ohne mehr oder weniger Risiko gibt“.[69] Ein circulus vitiosus scheint in Gang gesetzt: Je größer der medizinische Fortschritt, umso vielfältiger die ärztlichen Möglichkeiten, umso höher der Leistungsstandard, umso strenger aber auch – parallel dazu – der Sorgfaltsmaßstab und damit die Sorgfaltsanforderungen, umso naheliegender deshalb die Gefahr ihrer Verletzung und das Haftungsrisiko. All dies dürfte auch die voranschreitende Digitalisierung nicht beenden. Obschon sie das Bild bzw. die Stellung des Arztes fundamental ändern kann und dürfte, wird sie zu neuen und anderen Prüfungsplichten des Arztes Anlass geben, die ebenfalls Gegenstand von Vorwürfen sein können. Es kommt vielmehr hinzu, dass sich das ehedem ganz auf Ärzte konzentrierte Strafrecht angesichts seiner Schlüsselstellung für die Behandlung zwar weiter vornehmlich an den Arztberuf richtet, weshalb auch dieses Werk keinen neuen Namen tragen muss. Es ist aber insgesamt zu einem Strafrecht des Gesundheitswesens geworden, das diversen Heilberuflern etwa durch die §§ 203, 299a, 299b StGB Verhaltensvorschriften bei Strafe auferlegt. Zahlreiche Pflegeberufe haben an der Behandlung Teil und sind auch fernab Aufsehen erregender exzeptioneller Taten[70] Ziel strafrechtlicher Ermittlungen. Zugleich sind die Leitungsebenen zum Beispiel von Krankenhäusern insbesondere unter dem Aspekt der Organisationspflichten und der Tatbeteiligung nicht zuletzt hinsichtlich der Vermögensabschöpfung (Einziehung) Ziele des heutigen Medizinstrafrechts. Schließlich kommt innerhalb des Medizinwirtschaftsstrafrechts hinzu, dass das hochkomplexe Zusammenspiel der Normen des Strafrechts, des Berufsrechts, des Zivilrechts und gerade des öffentlich-rechtlichen Vertragsarztrechts vor dem Hintergrund des steigenden und nie entfallenden Kostendrucks eine Vielzahl klärungsbedürftiger Rechtsfragen stellt. Sie können gerade bei einer allzu leichtherzigen Auslegung und Tatverdachtsprüfung[71] schnell zu Ermittlungsverfahren führen. All diese Entwicklungen werden entsprechend in dieser Neuauflage etwa durch die Neufassung des Kapitel 1 Teile 13 bis 15 berücksichtigt. |
| 5. | Jeder, der sich mit dem Arztstrafrecht – gleichgültig aus welcher Sicht – befasst, sollte den empirischen Hintergrund, die tatsächlichen Gegebenheiten der Strafverfolgung auf dem medizinischen Sektor, kennen. Staatsanwälte, Richter und Verteidiger müssen Einfühlungsvermögen für die „großen Schwierigkeiten des ärztlichen Berufs“ und die „Verantwortung, die der Arzt, wie kaum ein anderer, zu tragen hat“[72] aufbringen. Entscheidend für die Bewältigung der Probleme des klassischen Arztstrafrechts wie des heutigen Medizinwirtschaftsstrafrechts sind aber natürlich profunde Kenntnisse im materiellen Strafrecht und des bei seiner Konkretisierung einschlägigen Medizin- und Sozialrechts. Ebenso bedarf es einer sicheren Beherrschung der Strafprozessordnung. Entsprechend muss sich auch dieses Buch inhaltlich und in seiner Darstellung mehr an den Juristen als an den Arzt wenden, und zwar in erster Linie an den Anwalt als seinen Berater und Verteidiger. Angesichts der aufgezeigten folgenreichen Konsequenzen des Arztstrafrechts ist eine effiziente Strafverteidigung auf diesem Sektor notwendiger denn je, um Auswüchse zu vermeiden und bei der Suche „nach dem gedeihlichen Verhältnis zwischen dem juristischen und dem medizinischen Praktiker“[73] zu einer ausgewogeneren bzw. vernünftigeren strafrechtlichen Beurteilung ärztlichen Handelns zu gelangen. Die Erkenntnis, „dass es am Krankenbett auch Grenzen des Rechts geben kann“,[74] ist bislang leider oft zu vermissen.[75] Letzteres erklärt „die allergische Reaktion nicht weniger Mediziner auf den Juristen“, weil er es „als eine persönliche Ungerechtigkeit“ begreift, wenn „aus den Hunderten und Tausenden von Fällen, die er, oft nach gravierenden Komplikationen, durch äußersten Einsatz seiner ärztlichen Kunst zu einem guten Ende gebracht hat, nur dieser eine Fall vom Staatsanwalt und Richter unter die juristische Lupe genommen wird, unter dem ihn in seinem ärztlichen Ethos allein schon zutiefst verletzenden Verdacht fahrlässiger Körperverletzung oder gar fahrlässiger Tötung“.[76] Zwischen den „Welten“ des Mediziners und des Juristen ist deshalb ein Brückenschlag erforderlich, der, wie es ein englischer Richter formulierte, einerseits deutlich macht, dass „die Ärzte gehalten sind, ein genügendes Maß von Klugheit und Vorsicht zu gebrauchen“, andererseits aber bei ihren Entscheidungen und der Übernahme von Verantwortung nicht „den Mut verlieren dürfen im Hinblick auf die Überlegung, dass ein Fehler ihrerseits das Risiko in sich birgt, wegen einer (beruflichen) Nachlässigkeit gerichtet und verurteilt zu werden“.[77] Deshalb sollten vernünftige Richter „stets den besonderen und oft schwierigen Verhältnissen, unter denen der Arzt im einzelnen Falle zu arbeiten gezwungen ist, Rechnung tragen und den Begriff der Fahrlässigkeit nicht überspannen“, andererseits dürfen im Einklang „mit allen gewissenhaften Ärzten die Forderungen an die Vorsicht des Arztes nicht zu niedrig gestellt werden“.[78] |
| 6. | In diesem Sinne bemühen sich alle Autorinnen und Autoren dieses Buches nach wie vor, auch für den Arzt lesbar und verständlich zu schreiben, damit er sich als unmittelbar Betroffener selbst ein Bild von den für ihn geltenden Ge- und Verboten der Rechtsordnung, den Anforderungen der Rechtsprechung an seine ärztlichen Pflichten, den Maßstäben für die strafrechtliche Beurteilung ärztlicher Sachverhalte und den Möglichkeiten seiner Verteidigung im Strafverfahren machen kann. Denn die ärztliche Fortbildungspflicht umfasst nach Ansicht des BGH das Gebot, sich mit den „einschlägigen juristischen Fragestellungen zu beschäftigen“.[79] Dabei wird der Arzt feststellen, dass trotz aller Kritik an der Judikatur und trotz aller juristisch und/oder ökonomisch motivierter Zwänge die Therapiefreiheit, die Freiheit des Gewissens und die ethisch fundierte, eigenverantwortliche Gewissensentscheidung in der Rechtsprechung durchaus eine fundamentale Bedeutung behalten haben.[80] Unter dieser doppelten Zielsetzung ist das Buch aus der Praxis entstanden und für die Praxis aufbereitet und auch deshalb mit vielen Fallbeispielen unterlegt. Anders als frühere Werke des Arztstrafrechts[81] nimmt das Buch weiterhin seinen Ausgang von dem in der Praxis maßgeblichen Rechtsstand, der insbesondere von der Rechtsprechung geprägt wird. Das bedeutet aber nicht, dass der – überdies nicht stets durch Rechtsprechung geklärte – Status quo sodann keiner theoretisch-wissenschaftlichen Auseinandersetzung zugeführt würde. Im Gegenteil: Die Rechtsprechung – und nicht ein einzelner theoretischer Ansatz des Schrifttums – steht lediglich im Mittelpunkt der folgenden Ausführungen. Überdies verlangen das verfolgte Ziel und der zur Verfügung stehende begrenzte Raum die Beschränkung auf die strafrechtlichen und strafprozessualen Fragen, die sich immer wieder oder doch in nennenswerter Zahl im Justizalltag des Arzt- und Medizinstrafrechts stellen und diesen Alltag damit prägen. Die in der ärztlichen Praxis weniger häufig auftretenden Straftatbestände können dagegen nur im Überblick behandelt werden. |