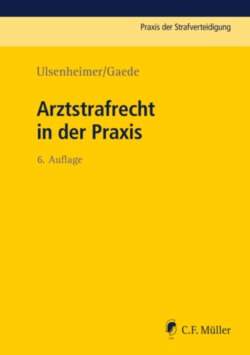Читать книгу Arztstrafrecht in der Praxis - Klaus Ulsenheimer - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Anmerkungen
Оглавление[1]
Kohler zitiert nach Ebermayer Arzt und Patient in der Rechtsprechung, 3. Aufl. 1925, S. 106 f.
[2]
Siehe zu dessen Persönlichkeit A.M. Staufer Leben und Werk des höchsten Anklägers der Weimarer Republik unter besonderer Berücksichtigung seiner Tätigkeit im Medizin- und Strafrecht, 2010.
[3]
Ebermayer a.a.O., S. 107.
[4]
Ebermayer a.a.O., S. 109.
[5]
Siehe bei Ebermayer a.a.O., S. 107.
[6]
Ulrich ÄRP 1985, 379; siehe auch Ulsenheimer Ein gefährlicher Beruf: Strafverfahren gegen Ärzte – Erfahrungen, Schwerpunkte, Tendenzen, MedR 1987, 207 ff.
[7]
Die Angaben betreffend die Zahl der Ermittlungsverfahren bei der Staatsanwaltschaft Köln verdanken wir Frau Oberstaatsanwältin Kaufmann-Fund und bedanken uns auch an dieser Stelle recht herzlich dafür.
[8]
Preuß/Dettmeyer/Madea Begutachtung behaupteter letaler und nicht letaler Behandlungsfehler im Fach Rechtsmedizin (bundesweite Multicenterstudie), 2005, S. 25, 31 ff.
[9]
Statistische Erhebung der Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen der BÄK 2018, S. 3.
[10]
Jahresstatistik Behandlungsfehler-Begutachtung der MDK-Gemeinschaft 2018, S. 7 f.
[11]
Im Falle eines Verfahrens vor einer Schlichtungsstelle oder Gutachterkommission kann während der Anhängigkeit allerdings nicht gleichzeitig der zivilrechtliche Klageweg beschritten oder ein Strafverfahren angestoßen werden.
[12]
Dass diese Schätzung nicht übertrieben ist, zeigt auch folgende Überlegung: Wenn allein im Landgerichtsbezirk Köln mit etwas über eine Mio. Einwohnern mehr als 300 derartige Ermittlungsverfahren bearbeitet werden, dann würden – bei etwa gleicher Deliktshäufigkeit – allein die Staatsanwaltschaften der Großstädte mit über 500.000 Einwohnern zu einer Gesamtzahl von 4.200 Ermittlungsverfahren wegen ärztlicher Behandlungs-, Aufklärungs- und Organisationsfehler beitragen.
[13]
Deutlich höher liegt die Schätzung von Krumpazky/Sethe/Selbmann mit „etwa 20 bis 30 Ermittlungsverfahren pro 1000 Ärzte und Jahr“ – VersR 1997, 425 –, da bei etwa 300.000 berufstätigen Ärzten sich daraus rechnerisch 6.000 bis 9.000 Strafverfahren ergäben. Zum Zahlenmaterial s. auch Althoff/Solbach ZS für Rechtsmedizin 1993 (1984) 273; Figgener Arzt und Strafrecht – Begutachtung von ärztlichen Sorgfaltspflichtverletzungen („Kunstfehlern“), Erfahrungen und Ergebnisse aus 10 Jahren (1968–1977), 1981; Högermeyer Ärztliche Kunstfehler – Ein Beitrag aus der Gutachterpraxis des Institutes für Gerichtliche Medizin der Universität Tübingen, 1991; Jahn/Kümper MedR 1993, 413; Kuon Ärztliche Kunstfehler in der Gutachtenpraxis des Institutes für gerichtliche Medizin der Universität Tübingen, 1985; Mallach Über ärztliche Kunstfehler in der Praxis des niedergelassenen Arztes, Schriftenreihe der Bezirksärztekammer Süd-Württemberg, Bd. 5, 1985; Solbach Arztstrafrechtliche Ermittlungsverfahren in Aachen, 1985; Reichenbach Typische Behandlungsfehler in der Praxis des niedergelassenen Arztes aus der Sicht des Chefarztes der Allianz-Versicherung, Schriftenreihe der Bezirksärztekammer Süd-Württemberg, Bd. 5, 1985; Orben Arzthaftung für Behandlungsfehler, 2002; Peters Der strafrechtliche Arzthaftungsprozess, 2000; Müller DRiZ 1998, 155 ff.; Pflüger Krankenhaushaftung und Organisationsverschulden, 2002.
[14]
Dazu Gaede in: AG Medizinrecht im DAV/IMR (Hrsg.), Aktuelle Entwicklungen im Medizinstrafrecht, 2018, S. 11, 15 f.
[15]
Die Süddeutsche Zeitung berichtete in ihrer Ausgabe vom 8.5.2007, S. 8, die gesetzlichen Krankenkassen hätten etwa 15.300 Fälle von Abrechnungsbetrug und Korruption im Gesundheitswesen verfolgt. Weitere Nachweise siehe Kapitel 1 Teil 13 I und Teil 14 I sowie Laufs/Kern/Rehborn/Ulsenheimer § 161 Rn. 1 ff. und § 162 Rn. 1 ff. Siehe allerdings zum bisher offensichtlich eher vorsichtigen Umgang mit den §§ 299a, 299b Gaede medstra 2018, 264, 265.
[16]
So existieren formelle Schwerpunktstaatsanwaltschaften in Bayern (München, Hof und Nürnberg), in Hessen (GenStA Frankfurt am Main), Thüringen (Meiningen) und Schleswig-Holstein (Lübeck), wobei der Abrechnungsbetrug im Vordergrund steht. In weiteren Bundesländern existieren spezielle Kommissariate zur Verfolgung von Vermögensdelikten im Gesundheitswesen, so in Berlin, Bremen, Brandenburg, Rheinland-Pfalz und im Saarland. Siehe ferner Nds.LT-Drucks. 18/3557 (neu), S. 3 f. und zum Zusammenhang Bausback in: Kubiciel/Hoven (Hrsg.), Korruption im Gesundheitswesen, 2016, S. 33, 41.
[17]
Dabei dürften die niedergelassenen Ärzte bisher weit weniger betroffen sein als der Krankenhausbereich, s. Scheppokat/Neu VersR 2002, 398: 730 von 2.430 Verfahren betrafen den niedergelassenen Arzt, der Rest den Krankenhausbereich.
[18]
Oberstaatsanwalt Badle FAZ vom 12.10.2011, S. 21; ders. medstra 2015, 1 f. Siehe dazu auch Ulsenheimer in: FS Steinhilper, 2013, S. 225 ff. Die gegen Badle erhobenen Vorwürfe entkräften die geltend gemachten sachlichen Gesichtspunkte dabei allein nicht.
[19]
Wohlers/Kudlich ZStW 119 (2007), 361, 375 (allerdings im Konkreten erwägend); zur Vorsicht mahnend auch Gaede medstra 2018, 264, 265 ff., 270 ff. Siehe allerdings zur Korruption deutlich anderen Sinnes etwa Fischer medstra 2015, 1 f.
[20]
Deutsch Arztrecht und Arzneimittelrecht, 1983, S. 125; Krümpelmann GA 1984, 493; Lilie/Orben Zur Verfahrenswirklichkeit des Arztstrafrechts, ZRP 2002, 156 ff.
[21]
S. dazu Peters MedR 2003, 219 f.; Ulrich ÄRP 1985, 386; Ulsenheimer MedR 1987, 208; s. dazu eingehend Lilie/Orben ZRP 2002, 154 ff.; Peters Der strafrechtliche Arzthaftungsprozess, 2000 mit vielen Detailangaben und einer Auswertung von 194 Verfahren zwischen 1992 und 1996. Im Jahr 2009 wurden 32 % der Ermittlungsverfahren mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt (NJW Aktuell 13/2011, S. 10).
[22]
Laufs NJW 1990, 1505; die Anzahl der in den Krankenhäusern acht Tage stationär behandelten Fälle betrug 2016 knapp 19 Mio. (davon 7,1 Mio. Operationen), die Zahl der Krankenhausärzte im Jahr 2018 202.087. 75,5 % aller von den Schlichtungsstellen überprüften Fälle betrafen Kliniken, 24,5 % den ambulanten Bereich (Beerheide DÄBl. 2018, A 628).
[23]
Näher, auch über das Gesundheitswesen hinaus, Gaede ZStW 129 (2017), 911, 912 ff.
[24]
LAG Hessen Urt. v. 5.12.2011 – 7 Sa 524/11.
[25]
Vgl. Ulsenheimer In den Mühlen der Justiz, Der Anästhesist 2004, 1001 ff.; StA Gießen 701 Js 26456/03; StA Krefeld 3 Js 61/06; CHAZ 2005, 7.
[26]
Positives Gegenbeispiel hingegen bei Badle medstra 2015, 2 f. Siehe im Übrigen wieder Fn. 18.
[27]
Zur belastenden Wirkung gerade der Hauptverhandlung, in welcher der Angeklagte de lege lata anwesend sein muss Gaede ZStW 129 (2017), 911, 913 f., 917 ff.
[28]
BGH NJW 1977, 1103.
[29]
Schwarz Der Gerichtssaal 106 (1935), 36; Gaede ZStW 129 (2017), 911, 912 ff.; vgl. BGH NStZ 1996, 34 f.
[30]
Siehe Rn. 2047.
[31]
Siehe Rn. 2032 ff.
[32]
Friedebold Aufklärungspflicht aus ärztlicher Sicht, in: Bericht über die unfallmed. Tagung in Garmisch-Partenkirchen, 1999, Heft 38, S. 35.
[33]
Roemer JZ 1960, 139.
[34]
Laufs MedR 1986, 164; NJW 1991, 1521.
[35]
Eser in: Ethische Probleme des ärztlichen Alltags, 1988, S. 90; s. dazu auch Ulsenheimer Ausgreifende Arzthaftungsjudikatur und Defensivmedizin, ein Verhältnis von Ursache und Wirkung, Berliner Medizinethische Schriften, Heft 17, 1997; ders. Der Unfallchirurg 1993, 43 f.
[36]
Hammerstein in: Defensives Denken in der Medizin – Irrweg oder Notwendigkeit? Schriftenreihe der Hanns-Neuffer-Stiftung, Bd. 11, 1991, Vorwort, S. 7.
[37]
Franzki in: Defensives Denken in der Medizin – Irrweg oder Notwendigkeit? Schriftenreihe der Hanns-Neuffer-Stiftung, Bd. 11, 1991, S. 19; Ulsenheimer Das Gewissen des Arztes in einer verrechtlichten und ökonomisch geprägten Medizin, Anästhesiologie & Intensivmedizin 2012, Bd. 53, S. 553-561.
[38]
Lilie/Orben in: Haft/Hof/Wesche (Hrsg.), Bausteine zu einer Verhaltenstheorie des Rechts, S. 324 ff.
[39]
Müller-Dietz in: Jung/Schreiber (Hrsg.), Arzt und Patient zwischen Therapie und Recht, 1981, S. 45.
[40]
Schreiber Langenbeck's Archiv für klinische Chirurgie 1980, 45; Jungbluth/Müller in: Unfallmedizinische Tagungen der Landesverbände der gewerblichen Berufsgenossenschaften, Heft 38, S. 42.
[41]
Laufs MedR 1986, 163; Eser in: Ethische Probleme des ärztlichen Alltags, 1988, S. 98 ff.; Franzki MedR 1994, 171.
[42]
Grünwald in: Arzt und Recht S. 127.
[43]
Binding Lehrbuch des Gemeinen deutschen Strafrechts, Besonderer Teil, Bd. 1, 1902, S. 20 ff.; siehe dazu auch Ulsenheimer in: FS Steinhilper, 2013, S. 225, 236; Badle in: Duttge (Hrsg.) S. 29 mahnt als Oberstaatsanwalt die „gebotene Zurückhaltung“ bei der Anwendung des Strafrechts an.
[44]
Jescheck/Weigend S. 53 Anm. 10; zur realistischen Bedeutung des ultima ratio-Grundsatzes siehe auch näher m.w.N. Gaede Der Steuerbetrug, 2016, S. 307 ff., 316 ff.
[45]
Zu ihr siehe BVerfGE 126, 170, 196 ff. und näher AnwK/Gaede § 1 Rn. 20, 24, 29 ff.
[46]
Näher Rn. 69 ff., 90 ff.
[47]
Siehe Gaede medstra 2018, 264, 268 ff. und Rn. 1356 ff.
[48]
Anschaulich zu den auch im Gesundheitswesen drohenden Gefahren Ulsenheimer medstra 2017, 323 ff.
[49]
So mit Recht Lilie/Orben ZPR 2002, 159; Wever ZMGR 2006, 120 ff.; Jürgens Die Beschränkung der strafrechtlichen Haftung für ärztliche Behandlungsfehler, 2005.
[50]
Vgl. Ulsenheimer in: Defensives Denken in der Medizin. Irrweg oder Notwendigkeit?, 1991, S. 37; ders. MedR 1987, 207, 216; Franzki Versicherungsmedizin 1990, 4; Maihofer Archiv f. Ohren-, Nasen- und Kehlkopfheilkunde, Bd. 187, 1966, 520; Jürgens Die Beschränkung der strafrechtlichen Haftung für ärztliche Behandlungsfehler, 2005, S. 144; für die prozessuale Entkriminalisierung Wever ZMRG 2006, 120.
[51]
So auch Ulsenheimer, Vorauflage, Rn. 18 f.
[52]
Lilie/Orben ZRP 2002, 154 ff.; konkreter m.w.N. MüKo-EMRK/Gaede Art. 2 Rn. 14, auch Rn. 21 ff., 25.
[53]
Dafür schon Matt/Renzikowski/Gaede § 15 Rn. 30 ff. und Rn. 38 ff.
[54]
Dafür m.w.N. bereits Gaede Limitiert akzessorisches Strafrecht statt hypothetischer Einwilligung, 2014.
[55]
Zum jüngeren Medizinwirtschaftsstrafrecht siehe Kapitel 1 Teil 13 Rn. 1210 ff.
[56]
Franzki Versicherungsmedizin 1990, 2.
[57]
Umbreit Die Verantwortlichkeit des Arztes für fahrlässiges Verhalten anderer Medizinalpersonen, 1992, S. 2.
[58]
Maihofer Archiv für klinische und experimentelle Ohren-, Nasen- und Kehlkopfheilkunde, Bd. 187, 1966, 519.
[59]
Franzki Versicherungsmedizin 1990, 2.
[60]
Dazu schon Stratenwerth in: FS Eb. Schmidt, 1961, S. 383.
[61]
Laufs/Kern/Rehborn/Kern/Rehborn § 100 Rn. 1.
[62]
Gesetzentwurf der Bundesregierung BR-Drucks. 312/12 vom 25.5.2012. In Kraft getreten am 26.2.2013, BGBl. I S. 277.
[63]
So auch Spickhoff NJW 2013, 1714; ders. NJW 2016, 1633, 1636: Anstieg der Arzthaftungsprozesse. Von den Pflichten des Patienten ist im Gesetz kaum die Rede. Nur ein „Zusammenwirken“ mit dem Arzt wird von Patientenseite gefordert (§ 630c Abs. 1 BGB).
[64]
Siehe plastisch Marquard Gynäkologe 1989, 342: Zeitalter der absoluten Ansprüche, die nur enttäuscht werden können.
[65]
Mittlerweile gibt es nach den Angaben der BRAK über 1.700 Fachanwälte für Medizinrecht.
[66]
So früher schon Weissauer in: FS Spann, 1986, S. 511 ff.; Laufs NJW 1987, 1449.
[67]
Laufs MedR 1986, 164.
[68]
Vgl. Laufs NJW 1987, 1449.
[69]
Laufs Der Medizinische Sachverständige 1976, 82.
[70]
Siehe zum Fall Niels H., der auch unter dem Aspekt der Geschäftsherrenhaftung bedeutsam ist, OLG Oldenburg medstra 2019, 101 sowie Dann medstra 2019, 1 f. und Eufinger MedR 2019, 547.
[71]
Gegen diese Praxis aber bereits m.w.N. NK-WSS/Gaede § 299a Rn. 85 ff.; früher auch schon Gaede/Lindemann/Tsambikakis medstra 2015, 142, 151 f.
[72]
Eb. Schmidt Der Arzt im Strafrecht, S. 3.
[73]
Richard Schmidt Die strafrechtliche Verantwortlichkeit des Arztes für verletzende Eingriffe, 1900, S. 1.
[74]
Tröndle MDR 1983, 897.
[75]
Ein positives Beispiel liefert BGH JZ 1984, 893, 897, wo in einer Grenzsituation die ärztliche Gewissensentscheidung „nicht von Rechts wegen als unvertretbar“ angesehen wurde. Weitere Beispiele bei Ulsenheimer Anästhesiologie & Intensivmedizin 2012, Bd. 53, 553-561.
[76]
Maihofer Archiv für klinische und experimentelle Ohren-, Nasen- und Kehlkopfheilkunde, Bd. 187, 1966, 511.
[77]
Zitiert bei Marrubini Anästhesist 7 (1958), 117.
[78]
Ebermayer a.a.O., S. 107.
[79]
BGHSt 40, 257, 264 für den Allgemeinmediziner. Diese Position spiegeln die Fortbildungsordnungen der Landesärztekammern indes noch kaum wider. Nach dem repräsentativen § 2 der Fortbildungsordnung HH heißt es: „Die Fortbildung vermittelt unter Berücksichtigung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse und medizinischer Verfahren das zum Erhalt und zur Weiterentwicklung der beruflichen Kompetenz notwendige Wissen in der Medizin und der medizinischen Technologie. Sie soll sowohl fachspezifische als auch interdisziplinäre und fachübergreifende Kenntnisse, die Einübung von klinisch-praktischen Fähigkeiten sowie die Verbesserung kommunikativer und sozialer Kompetenzen umfassen.“ Zum Beispiel die hessische und saarländische Fortbildungsordnung nennen zudem Methoden der Qualitätssicherung und des Qualitätsmanagements. Immerhin findet sich in der Empfehlung der BÄK zur ärztlichen Fortbildung auf Seite 5 der Hinweis: „Der ärztlichen Berufsausübung dienende […] rechtliche Inhalte können Berücksichtigung finden“.
[80]
Siehe dazu ausführlich Ulsenheimer Anästhesiologie & Intensivmedizin 2012, Bd. 53, 553-561.
[81]
Eb. Schmidt Der Arzt im Strafrecht, S. 2.