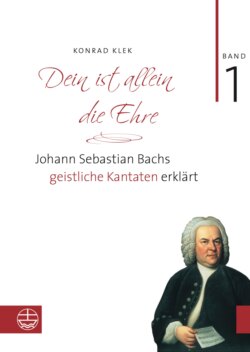Читать книгу Dein ist allein die Ehre - Konrad Klek - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Hinweise zu Methode und Darstellung der Kantatenauslegung
ОглавлениеBachs Kantaten sind schon mehrfach in Gesamtdarstellungen gewürdigt worden. Zu den Standardwerken von Alfred Dürr (dtv/Bärenreiter), Konrad Küster (im Bärenreiter Bach-Handbuch) und Hans-Joachim Schulze (Evang. Verlagsanstalt) kommen die Booklet-Texte in den verfügbaren Gesamteinspielungen, das Bach-Handbuch im Laaber Verlag, die Werkeinführungen zur Basler Gesamtaufführung (Schwabe Verlag) und vor allem das große Projekt Martin Petzoldts, »Bach-Kommentar« als ausführliche »theologisch-musikwissenschaftliche Kommentierung« (Bärenreiter).
Gegenüber den eher musikologisch orientierten Erläuterungen soll hier entschieden mit M. Petzoldt und im Anschluss an die Anliegen der Arbeitsgemeinschaft für theologische Bachforschung (gegründet 1976) die theologische Akzentuierung bei Bachs Vertonungen erhoben werden. Dazu ist die Präsenz der Kantatentexte wichtig. Bei den Erläuterungen sind Sentenzen oder Worte daraus jeweils in Kursivschrift kenntlich. Sachgemäße Verstehenszugänge sind zu erschließen mit der Intention, Musik wie Text zu profilieren. Die ursprüngliche Funktion der gedruckten Kantatenlibretti als Erbauungsliteratur zum inneren Nacherleben des Gehörten kann so durchaus erneuert werden, zumal heute durch die uneingeschränkte Verfügbarkeit der Musik via CD-Einspielung jenes Nacherleben in ein stetes Miterleben verwandelt werden kann. Die Libretti des Choralkantatenzyklus sind ein geistlicher Sprachschatz von höchster Qualität, starker Bildhaftigkeit, biblischer Tiefenschärfe wie Vieldimensionalität. Zudem ist ihr Sprachgestus predigthaft im seelsorgerlich positiven Sinne, dass hier Gnade zugesprochen wird in immer wieder neuen Variationen, oft in gut fasslichen, griffigen Formulierungen, die man sich merken kann. Manches kann in Verbindung mit Bachs Musik zum »Ohrwurm« werden, der durchs Leben – und Sterben – trägt. (Ein allgemeiner Lesehinweis: vor meint das, was heute für sagt und umgekehrt.)
Gegenüber M. Petzoldts ungemein detailreicher Kommentierung ist hier der Versuch unternommen, jeweils Wesentliches auf den Punkt zu bringen. Die von Petzoldt vorgelegten Materialien werden dankbar »ausgeschlachtet«, vor allem die Bibelstellenverweise zu jeder Verszeile, die theologiegeschichtlichen Hintergrundinformationen und die hymnologischen Angaben zur liturgischen Einordnung der Lieder. Die Erläuterungen zur Musik vermeiden hier namentlich bei den zumeist sehr plastischen Rezitativen ein zu detailgenaues Beschreiben der Verläufe und vom Text motivierten Figuren, wozu Notenbeispiele unerlässlich wären. Wichtig sind grundsätzliche hermeneutische Entscheidungen Bachs, die sich bei jedem Satz an Besetzung, Tonart, Taktart, Diktion der Instrumental- und Vokalstimmen erheben lassen. Der Blick richtet sich dann auf spezifische Akzentuierungen im Satzverlauf, auf die Pointen, die Bach setzt.
In diesen Erläuterungen wird deutlich, dass die Spezifika von Bachs damaligem Instrumentarium und Vokalstimmenbesetzung (nur Männer/Knaben) wesentlich sind für die Erfassung des Sinngehalts. So sind die Ausführungen hier nur mit klanglichen Realisationen kompatibel, die mit »historischen Instrumenten« und kleiner Vokalstimmenbesetzung arbeiten. Neben den jüngeren Gesamteinspielungen von Koopman, Gardiner und Suzuki und der Teileinspielung von S. Kuijken behält auch die frühere Edition mit Harnoncourt und Leonhardt ihre Bedeutung, da nur hier Knabenstimmen zu vernehmen sind. Der Begriff »Chor« und die verbreitete Satzbezeichnung »(Eingangs-)Chor« wird hier vermieden, da dies heute das mehr oder weniger krasse Gegenüber von Chor und Vokalsolisten einträgt, was bei Bach als Grundstruktur so nicht gegeben ist. Die Eingangssätze der Kantaten zeichnen sich nicht durch großen Chorklang aus, sondern dadurch, dass alle (im Titel jeweils aufgezählten) Ensemblemitglieder miteinander »konzertieren«. Die jeweilige Besetzung ist im Kantatentext bei den einzelnen Sätzen knapp angegeben. Von der Mitwirkung des Continuobass ist stets auszugehen, ebenso die Beteiligung aller am Schlusschoral, »Streicher« meint Violine I, II und Viola. Die fettgedruckten Satzbezeichnungen sind die originalen, allerdings ins Deutsche transformiert (»Arie« statt »Aria«). Ebenso sind die italienischen Bezeichnungen der Instrumente übersetzt.
Anders als in allen bisher vorliegenden Werkbesprechungen ist die Dimension der Zahlensymbolik hier nicht ausgeblendet. Im Zuge des Studiums der Werke haben sich so viele einschlägige Phänomene aufgedrängt, dass schließlich jede Kantate komplett durchgezählt wurde. Nur besonders signifikante Ergebnisse fließen hier ein. Die obigen Ausführungen zur Gesamtdisposition des Zyklus mit 61-Gnadenjahrsymbolik sind exemplarisch für die Relevanz dieser Dimension in Bachs eigentümlich vollkommener Musik. In der Darstellung signalisieren Großbuchstaben jeweils die Übertragung des Worts in Zahlensummen nach dem lateinischen Zahlenalphabet A=1, B=2 etc. (I/J und U/V sind identisch, sodass gilt Z=24). Ausgehend vom Phänomen, dass BACH=14 und JSBACH=41 ergibt, sind Zahleninversionen theologisch höchst relevant als Umkehrung vom Verderben zum Heil. Mehrfachdeutungen einer Zahl, z. B. 13 als Symbol für Tod (Überschreitung der Zeit) wie für den Messias (12 Stämme Israels bzw. Jünger Jesu plus der dazu Kommende) sind üblich in der Tradition. Hier ist der Bezug zur Thematik des jeweiligen Satzes entscheidend. Als vielfach präsente Schlüsselzahl hat sich 153 ergeben, die Zahl der (nur) mit Jesu worthafter Präsenz gefangenen Fische in Johannes 21,11. Der mit den Tonstufen 1 – 5–3 (oder in anderer Reihenfolge) dem entsprechende Dreiklang ist ebenfalls Sinnträger und korreliert zudem mit der allgemeinen Dreier-Symbolik zu Gottes Trinität (bildlich dargestellt als Dreieck).
Wie bei K.Küster und im Bach-Handbuch des Laaber-Verlags folgt die Kantatenbeschreibung der Reihenfolge ihrer Entstehung. Unter dem hier vorrangigen inhaltlichen Aspekt ergibt sich so ein Gesamtbild von der theologischen Profilierung dieses »Jahrgangs«. Zudem stehen so zum ersten Mal die Kantatentexte in der Reihenfolge, in welcher sie den Leipziger Gottesdienstbesuchern zu Ohren und vor Augen kamen, um ihr Herz zum Glauben zu bewegen.
Bei den Libretti sind die original übernommenen Liedstrophen fett gedruckt. Liedzitate in den Arien und Rezitativen sind fett markiert, sobald es eine Zwei-Wort-Konstellation ist, wozu auch identische Reimworte am Zeilenende zählen. Eingehendere hymnologische Ausführungen zum Lied und seinem Autor, sowie Erörterungen über die Unterschiede zwischen Liedvorlage und Libretto mussten aus Platzgründen unterbleiben. Dazu sei auf M. Petzoldts »Bach-Kommentar« verwiesen, wo auch die Liedtexte jeweils mit abgedruckt sind. Wenn das Lied im heutigen Evangelischen Gesangbuch (EG) zu finden ist, wird die Nummer genannt. Die Bibelstelle des jeweiligen Sonntagsevangeliums (»Evangelium«) als Bezugspunkt von Kantate wie Predigt findet im Zuge der Ausführungen Erwähnung. Manchmal ist die Abständigkeit zwischen damaliger Deutung und heutigen Zugängen enorm, manchmal aber mag es namentlich der sonntäglichen Erbauung durchaus dienlich sein, das Bibelwort zur Musik der Kantate mit aufzuschlagen. Nicht zuletzt verbindet sich mit diesen Kantatenerläuterungen die Hoffnung, dass Predigerinnen und Prediger hier Anregung finden für die Auslegung der Evangelientexte, für die Kultivierung des in den Choralkantaten präsentierten Liedgutes und für Predigten zu diesen Bachkantaten bei einer Aufführung – wie zu Bachs Leipziger Zeiten – im Gottesdienst.
Die theologische Deutung musikalischer Phänomene, erst recht als »Zahlensymbolik«, ist in den Fachwissenschaften sehr umstritten. Diesbezüglich sind diese Erläuterungen »mutig« oder bisweilen sogar »kühn«. Aus sprachlichen Gründen ist auf vorsichtigere Formulierungen mit Vorbehalt verzichtet worden. Die Leserinnen und Leser mögen die Plausibilität der Deutungen jeweils selbst prüfen.
Vielen Menschen hätte ich zu danken, die mich auf dem lebensgeschichtlich nun schon längeren Weg einer solchen Bach-Deutung bestärkt haben, nicht zuletzt Vokalsolisten und Instrumentalisten aus der Alte-Musik-Szene mit ihrem Vermögen, Bachs Musik in ihrer spezifischen Eigenart zum Sprechen zu bringen. Namentlich gewürdigt sei vom Anfang dieses Weges Wolfgang Kelber (München), dessen Einstudierung des Eingangschors O Mensch bewein dein Sünde groß im Bachjahr 1985 dem Studenten als Chorsänger zur Urerfahrung wurde – und der nun mit (partiellem) Gegenlesen der Texte wieder beteiligt war. Einen indirekten, aber nicht unwesentlichen Anteil am Entstehen dieser Erläuterungen haben die aufmerksamen, vorwiegend »reifen Semester« meiner Kantaten-Vorlesung über mehrere Semester. Ihre Hörer-Treue ist des ausdrücklichen Dankes wert.
Erlangen, im Herbst 2014, Konrad Klek