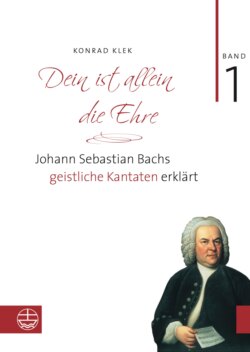| Abruptio | Musikalisch-rhetorische Figur: kurzes Abreißen mit anschließender Pause |
| Abgesang | siehe Barform |
| Accompagnato | Bezeichnung für Rezitative, die neben dem Continuo mit weiteren Instrumenten begleitet werden, zumeist mit Streichern, gelegentlich auch mit Bläsern. |
| Akrostichon | Dichterisches Gestaltungsmittel, beliebt in höfischer Dichtung: Die Anfangsbuchstaben der Strophen sind die Initialen des Widmungsträgers. Bei Gedichten zu Sterbefällen soll so der Name des Verstorbenen ins »Buch des Lebens« eingeschrieben werden (vgl. EG 523). Auch Anfangsworte können einen Sinnzusammenhang über das ganze Lied bilden (vgl. EG 361). |
| Alla breve | Taktbezeichnung, in der Barockmusik als Modifikation des 4/4–Taktes derart, dass die Taktdrei keinen Zwischenakzent erhält zugunsten einer stärkeren Takteins. Wörtlich ausgeschrieben verweist es auf das »tempus imperfectum« der älteren Musik (Stile antico) mit zwei (in der Regel langsamen) Grundschlägen pro Takt. |
| Anapäst | In der Poetik der Versfuß zweimal unbetont, einmal betont; in der Musik rhythmisches Grundmuster zweimal kurz/einmal lang (z. B. zwei Achtel, ein Viertel). |
| Battaglia | Musikalisches Schlachtengemälde, im Barock beliebt als Gestaltungstyp auch in anderen Zusammenhängen: Violinen spielen gestoßene 16tel in Tonrepetitionen, fanfarenartigen Dreiklängen oder mit abspringende Wechselnoten. |
| Barform | Bezeichnung für die häufigste Strophenform bei Liedern: zwei oder mehr Anfangszeilen (»Stollen«) werden melodisch wiederholt, dann folgt der »Abgesang«. »Reprisenbar« ist die Sonderform, dass die letzten Zeilen des Abgesangs wieder mit den Anfangszeilen identisch sind (siehe BWV 92, 111). |
| Bicinium | »Zwiegesang«, im 16. Jahrhundert beliebt als elementare Gattung von Vokalmusik mit nur zwei Stimmen (ohne Begleitung). Der Begriff wird auch übertragen auf spätere, mit Continuo begleitete Zwiegesänge. |
| Cantus firmus | Fachbegriff für die Melodie eines Liedes, die in mehrstimmigen vokalen wie instrumentalen Liedvertonungen hervorgehoben wird durch unverzierte, längere Notenwerte, daher »fester Gesang«. |
| Colla parte | Die Instrumente verdoppeln die Vokalstimmen, haben keine eigenen Partien. |
| Continuo | Eigentlich: »Basso continuo«, fortlaufender Bass, Kennzeichen aller Barockmusik als Fundament, das auch die Harmonik bestimmt. In der Partitur als unterstes System notiert, kann die klangliche Realisierung variieren. Bachs Stimmenmaterial enthält in der Regel drei Continuo – Stimmen, eine davon mit Akkordbezifferung (»Generalbass«) und einen Ton nach unten transponiert für die Orgel, die einen Ton höher gestimmt war. Bisweilen gibt es auch bezifferte untransponierte Stimmen für Cembalo oder Laute. Die anderen Stimmen waren für Violoncello und Violone (eine Oktave tiefer, vgl. Kontrabass). Ob in der Regel zusätzlich ein Fagott mitspielte, ist unklar. |
| Da capo–Arie | Standardform der Arie im Barock mit der Abfolge A–Teil, B–Teil (meist in der Paralleltonart, also Moll statt Dur und umgekehrt), Wiederholung des A–Teils »von vorne«. Ein verkürztes Da capo bringt nur das Instrumentalvorspiel als Wiederholung. |
| Duett | Arie mit zwei Sängern. Bei Bach lautet die Bezeichnung »Aria Duetto«. Bisweilen steht nur »Aria«. |
| Exclamatio | »Ausruf«: Musikalisch–rhetorische Figur der Emphase als Sprung nach oben mit über die Quinte hinausgehendem Intervall, vorwiegend kleine Sexte, auch kleine Septime. |
| Inklusion | Poetisches wie musikalisches Gestaltungsmittel: Anfang und Ende sind gezielt gleich geformt. |
| Libretto | Die Textgrundlage einer mehrsätzigen Vertonung mit unterschiedlichen Satzformen, zunächst bei Opern, dann auch bei Oratorien und Kantaten. Der Textautor (Librettist) kann vorliegende Dichtungen (Liedstrophen) oder – im geistlichen Bereich – Bibelworte integrieren, wechselt ansonsten zwischen der freieren Form des Rezitativs und der konzentrierten Form der Arie, beides in Reimform. |
| Magnificat | Begriff für den viel vertonten Lobgesang der Maria Lukas 1,46 – 55 nach dessen lateinischem Anfangswort. Liturgisch ist dieser Gesang Bestandteil jedes Vespergottesdienstes (in Leipzig der sonntägliche Nachmittagsgottesdienst). |
| Motette | Gattung der Vokalmusik. Bei Liedvertonungen wird jede Liedzeile den variierenden Worten (und Melodietönen) gemäß separat vertont. |
| Nunc dimittis | Begriff für den Lobgesang des greisen Simeon Lukas 2,29-32 nach dessen lateinischem Beginn, Vorbild für Sterbelieder, Bestandteil des täglichen klösterlichen Nachtgebets. |
| Ostinato | Musikalisches Gestaltungsmittel: eine bestimmte melodische und/oder rhythmische Figur wird »beharrlich« wiederholt. Bei Bach ein häufiges Gestaltungsprinzip im Continuo. |
| Parodie | Wiederverwertung einer Musik in anderem Zusammenhang durch Umtextierung, ggf. auch weitergehende Umgestaltung, eine im Barock sehr verbreitete Praxis. |
| Per omnes versus | Vertonung eines Liedes »durch alle Verse«. Alle Strophen werden vertont, die musikalischen Mittel variieren, aber die Melodie ist als Cantus firmus in der Regel stets präsent; eine Grundform der Kantate, ehe sich ab ca. 1715 die moderne Kantatenform mit Arien und Rezitativen durchsetzte. Bachs frühe Kantate BWV 4 Christ lag in Todesbanden repräsentiert diesen Typus. |
| Reprise | Wörtliche Wiederaufnahme der Musik vom Anfang. |
| Ritornell | Das instrumentale Vorspiel einer Arie oder eines Eingangschores, im weiteren Satzverlauf als Zwischenspiel oder Nachspiel erneut eingespielt in modifizierter oder identischer Form. |
| Siciliano | Barocker Satztyp im 6/8– oder 12/8–Takt mit spezifischer Rhythmik (punktiertes Achtel in 3/8–Gruppe), konnotiert als Hirtenmusik mit der Implikation »Idylle«, aber auch Liebeserlebnis (vgl. BWV 68,1). |
| Stile antico | Begriff zur Abgrenzung der Barockmusik des Generalbasszeitalters (nach 1600) von der älteren Stilistik der polyphonen Vokalmusik, die stärker horizontal orientiert ist. Bei Neukompositionen als Stilkopie identifizierbar an großen Notenwerten (Halbe als Grundschlag). Zum einschlägigen »Sound« des »Erhabenen«, Altertümlichen tragen oft colla parte spielende Posaunen mit Zink (Sopran) bei. |
| Stollen | siehe Barform |
| Tripla | In der Renaissance – Musik die Taktform mit drei Ganzen, spezifischer Ausdruck göttlicher Vollkommenheit und Trinität (Drei – Einigkeit), allgemein auch »tempus perfectum« (vollkommenes Zeitmaß) genannt. |
| Tropierung | Erweiterung übernommener Texte durch Kommentare, Ergänzungen, zu neuen Gesängen, in der Liturgie oft praktiziert beim stets gleichen »Kyrie eleison«; dann auch allgemeiner Begriff für Zitation mit Kommentierung in künstlerischem Gestalten. |
| Unio mystica | Vorstellung von der Vereinigung von Gott (Jesus) und Mensch in der Bibel entlehnten Bildwelten (Hochzeit, Einwohnung im Herzen), in der Mystik Leitbild alles religiösen Strebens. |
| Unisono | Unterschiedliche Stimmen singen oder spielen »im Einklang«, also dieselben Töne oder in Oktavparallelen. |
| Vox Christi | »Stimme Christi«. Im gesungenen Vortrag der biblischen Lesungen wurden die Jesusworte stets hervorgehoben durch tiefere Stimmlage, bei den Passionslektionen mit mehreren Sängern durch den Bassisten. Auch bei Bach sind Jesus-Worte stets dem Bass zugeweisen. |