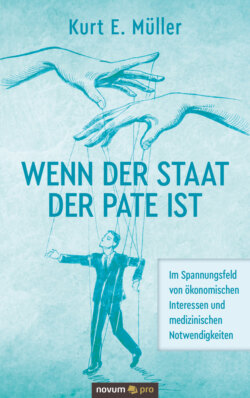Читать книгу Wenn der Staat der Pate ist - Kurt E. Müller - Страница 8
Оглавление3.
Antiscience – wenn Wissenschaft unwissenschaftlich ist
Betrachtet man die Modalitäten wissenschaftlicher Diskussion über einen längeren Zeitraum, so ist man überrascht, in welchem Umfang man auf Machtgebrauch und Machtgebaren, aber auch Unsachlichkeit von Fachleuten trifft. Nur selten wird der bisher als gültig erachtete Kenntnisstand korrigiert, wenn es auf Grund neuer Kenntnisse längst sein müsste, sondern erst dann, wenn die Protagonisten überholter Lehrmeinung die Szene verlassen haben. So sagte einer der renommiertesten Forscher auf einem Kongress für Neuroimmunmodulation, an dem ich als einziger in einer Praxis tätige Arzt teilnahm und noch dazu die Ehre hatte, zu einem Vortrag geladen zu sein, fast resignierend zu mir, dass die aktuell praktizierte Medizin fünfzehn bis zwanzig Jahre hinter dem längst vorhandenen Wissen auf diesem Gebiet hinterherhinke.
Wer erzeugt die innovative Kraft in der Wissenschaft? Folgt man dem Wissenschaftsethiker und -theoretiker Prof. Fröhlich, Johannes Keppler Universität Linz, kommen Kritik aktueller Positionen sowie Korrektur der Wissenschaft und Innovation praktisch immer von Außenseitern. Was würde helfen? Aus meiner Sicht würde es helfen, wenn wir in der Lage wären, den eigenen Standpunkt gelegentlich mit den neugierigen Augen Unkundiger anzuschauen, gewünschte Ziele und erreichte zu vergleichen, Aufwand und Nutzen abzugleichen sowie eigene Interesse und die von außen herangetragenen Interessen zu analysieren. Es gelänge so, die Reflexion ständig in Gang zu halten, Fehler zu korrigieren und Weiterentwicklungen schneller in die Tat umzusetzen. Diese Fähigkeiten fehlen den meisten. Solche Verhaltensmuster kann man an einem medizinhistorisch gut dokumentierten und typischen Beispiel darstellen. Wir ziehen aus solchen historisch wertvollen Beispielen allerdings nicht die notwendigen Schüsse.
Der englische Landarzt Bostock erkannte die Ursache des Heuschnupfens als Erster. Er beschrieb den Zusammenhang 1819 und gebrauchte den Begriff Hayfever (Heufieber), weil sich die Betroffenen fiebrig sowie müde fühlten und Schnupfensymptome aufwiesen, wenn die Gräser blühten und das Heumachen begann. Die etablierten Wissenschaftler der damaligen Zeit hielten diese Einschätzung für abwegig und propagierten eine neurotische Genese. Dieser Position schloss sich auch Laforgue aus Toulouse an. Es hat sich bis heute nicht viel daran geändert, neue Erkrankungen zunächst dem psychischen oder psychosomatischen Formenkreis ohne weiteren Beleg zuzuordnen. Dechambre vermutete meteorologische Ursachen. Friedrich Schönwein aus Basel schuldigte Ozon an. Eine Ansicht, die auch aus heutiger Sicht nicht ganz bedeutungslos ist. Wissen wir doch seit den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, dass Umwelteinflüsse die Pollen veranlassen, Stressproteine an der Oberfläche zu bilden, die viel größeres Potenzial besitzen, Allergien auszulösen. Rehstein behauptete, dass es ein Problem der Intellektuellen sei. Helmholtz erklärte vibrionenartige Erreger der Nasenschleimhaut zur Ursache. Eine Meinung, der sich Zuelzer und Pfuhl in Deutschland sowie Budberg in England anschlossen. Der berühmte Behring hielt die Helmholtz’schen Vibrionen für Streptokokken. Piorry, Kratschmer, Kutter, Daly und Voltolini waren Anhänger der lokalen Reflexauslösung. Wilhelm Haack stellte seine Theorie der Reflexneurose 1882 vor. Mackenzie freute sich darüber, dass man die Pollenätiologie vergessen könne, obwohl Blackly schon 1873 an 700 Arbeitern die Verursachung des Heuschnupfens durch Pollen bewiesen hatte. Es war schließlich Alfred Wolff-Eisner, der erstmals den Begriff Allergie in diesem Zusammenhang gebrauchte, welcher 1906 von Clemens von Pirquet geprägt worden war. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung wogte dennoch weiter. Sie fand erst im Jahr 1967 eine Ordnung, als das Ehepaar Ishizaka und der Schwede Johansson unabhängig voneinander mit dem Immunglobulin E (IgE) die fünfte Klasse der Immunglobuline und damit das treibende Agens der allergischen Reaktion vom Soforttyp gefunden hatten. Clemens von Pirquet hat schon 1919 ein Reagin als Verursacher postuliert, dem dieses IgE entsprach. Nach fast 150 Jahren hatte Bostock Recht bekommen. Da war er längst tot – nach einem Lebensweg der Verunglimpfung und Beleidigung. Auf diesem Weg hatten sich viele der namhaften Wissenschaftler geirrt.
Es ist ein historisches Bedürfnis in der Medizin, auch einfache Sachverhalte in eine schwierige Sprache zu transformieren, um dem Gesagten allein dadurch Gewicht und Bedeutung zu verleihen und damit den Mangel an grundlegendem Verständnis zu verdecken. Es hat medizinhistorische Gründe, dass dieser Weg früher stets gewählt wurde, weil damals die Ebene des Beschreibens viel detaillierter und genauer entwickelt war als die Ebene des Erkennens von Ursachen und Gründen. Diese Diskrepanz ist allerdings auch heutzutage weiterhin vorhanden, wenn auch nicht mehr so ausgeprägt. Die im Gymnasium das große Latinum erworben haben, sind gleich zu Beginn des Studiums im Vorteil, weil ihnen die medizinischen, auf dieser Sprache basierenden Grundbegriffe viel schneller vertraut sind als denen, die nur die „neuen Sprachen“ gelernt haben und sich in dem Fach Terminologie damit erst vertraut machen müssen.
In meinen Seminaren benutzte ich gerne das folgende Beispiel, um auf den Kern des Problems aufmerksam zu machen: Kommt ein Patient zum Arzt und sagt: „Herr Doktor, ich habe plötzlich an meinem Körper in kurzer Zeit einen Hautausschlag bekommen. Können Sie mir sagen, was das ist?“ Der Arzt entgegnet: „Machen Sie sich doch mal frei, dass ich mir das anschauen kann.“ Der Patient entkleidet sich und lässt den Arzt nicht aus den Augen. Beunruhigt stellt er die sorgenvollen Falten auf der Stirn des Arztes fest. „Und, was ist es?“ Der Arzt sagt in gewichtigem Tonfall: „Es ist eine Pityriasis lichenoiden et varioliformis acuta, Mucha-Habermann.“ Der Patient verharrt andächtig und denkt sich: „Unglaublich, was diese Ärzte so alles wissen müssen.“ Nach einer Weile des Zögerns fragt er vorsichtig: „Woher kommt die Krankheit denn?“ Der Arzt entgegnet knapp: „Das weiß man nicht genau.“
Diese Mechanismen haben über Jahrhunderte funktioniert, um akademische Distanz zu schaffen und den Respekt vor dieser akademischen Bildung zu bewahren. Die Ärzte tun sich schwer damit umzugehen, dass diese einfachen Mechanismen nicht mehr funktionieren. Viele Patienten, und das sind längst nicht mehr nur die jüngeren, kommen durch die Möglichkeiten des Internets bestens vorinformiert in die Sprechstunde oder arbeiten nach was sie dort gehört haben. Man versucht die dadurch aufkommende Problematik durch lapidare Feststellungen zu kompensieren und stellt fest, wenn der Patient bestens vorbereitet wiederkommt: „Na, leiden Sie jetzt auch am Morbus Google?“ Zu selten bemühen wir Ärzte uns, die Patienten von vornherein auf Augenhöhe zu behandeln. Die Patienten erkämpfen sich das durch Verbesserung ihres Wissens auf anderen Wegen und wir Ärzte nehmen es zähneknirschend zur Kenntnis.
Bei der Ausbildung der Medizinstudenten muss es stärker als bisher ein Ziel sein, schwierige Sachverhalte in einer allgemein verständlichen, möglichst bildhaften Sprache darzustellen. Bezüge auf alltägliche Situationen sind hilfreich, die den Patienten vertraut sind und das Verständnis erleichtern. Es muss gelingen, den Patienten deutlich zu machen, dass sie Kooperationspartner in der gleichen Angelegenheit sind. Die Aufgaben sind verteilt und den Möglichkeiten der Beteiligten angepasst. Es sind gerade Eigenschaften gefragt, die die Lehrenden der Lernenden oftmals selbst nicht beherrschen und sie offenbar auch nicht beherrschen wollen. Es gibt zu viele Ärzte, die an einem Asperger-Syndrom latent erkrankt sind, bei denen die sozialen analogen Interaktionen wie Gestik, Mimik und Blickkontakt gestört sind, während Hoch- und Inselbegabungen häufig vorkommen. Die Digitalisierung kommt diesen Ärzten entgegen, da die Defizite bei der Zuwendung zu den Patienten unauffällig verdeckt werden können.
Im Rahmen eigener Arbeiten über die Stressregulation der Menschen war ich auf die Bedeutung eines genetisch kodierten Enzyms (Catechol-O-Methyltransferase, COMT) gestoßen, das für den Abbau schnell wirksamer Stresshormone (Katecholamine) von großer Bedeutung ist. Wenigstens 15 % der Menschen haben eine ungenügende Wirkung dieses Enzyms und bauen diese Stresshormone verzögert ab. Das führt dazu, dass Stressreaktionen länger anhalten und sich stärker auswirken. Ich konnte zeigen, dass dieser Personenkreis schon ohne Genanalyse gut erkannt werden kann. Meine klinische Einschätzung an 100 untersuchten Männern und Frauen wurde in 91 % durch die Genanalyse bestätigt.
Die Beachtung dieses Sachverhalts erlaubt es frühzeitig Personen zu identifizieren, die einen deutlich erhöhten Verbrauch an Energie haben, deren Immunfunktion infolge der ständig hohen Ausschüttung und verlängerten Wirkung von Stresshormonen (Katecholamine) verändert ist, deren kognitive Hirnleistung hoch, ihr soziales Verhalten aber oft gestört ist. Die Kontrolle von Affekten ist erschwert. Nicht wenige sind hoch begabt, was oft unbemerkt bleibt, weil sie ihre Begabung nicht optimal umsetzen können. Sie können sich mit der Langsamkeit des Durchschnitts nur schlecht arrangieren, wirken unkonzentriert und schweifen schnell ab. Einzelne dieser Patienten hatten einen IQ von bis zu 170. Die meisten sind gute bis sehr gute Sportler. Sie erleiden mit größerer Wahrscheinlichkeit kardiovaskuläre Erkrankungen, Depressionen und Burnout. Bei Sportlern ist die Gefahr des nicht mehr regenerierbaren Leitungsverlusts nach übertriebenem Training hoch (Overtrained Athlet Syndrome, OAS). Der ständig hohe Verbrauch des Energieträgers Adenosintriphosphat (ATP) hinterlässt Adenosin, eine physiologische Substanz, die die Abwehrleistung stark unterdrückt. Ein wesentlicher Faktor, warum Virusinfekte für diese Personen mit einem hohen Risiko behaftet sind und auch schon bei jungen und körperlich gut trainierten Menschen ein besonderes Risiko sein können. Die jungen Verstorbenen der COVID-19 Pandemie gehören überwiegend in diese Gruppe. Der Verbrauch an Methylgruppen ist bei diesen Personen hoch, was Auswirkung auf die Steuerung epigenetischer Konditionen (s. dort) und die Entgiftung durch Methylierung hat. Auch die Funktion des gegenregulatorischen parasympathischen Nervensystems ist beeinträchtigt. Diese Menschen haben immer einen hohen Bedarf an Mikronährstoffen. Die Angaben der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin hinsichtlich der Deckung des Bedarfs treffen für sie nicht zu. Er ist wesentlich höher. Die Gesellschaft muss eigentlich ein großes Interesse daran haben, diese Menschen gesund und leistungsfähig zu halten, da viele zu ungewöhnlichen Leistungen auf unterschiedlichen Gebieten befähigt sind. Sie sind keine Kandidaten für den Einsatz von Psychopharmaka, sondern benötigen eine zielgerichtete funktionelle Medizin, und das oft schon im Schulalter.
Die Fähigkeit, aus solchen Kenntnissen zu lernen, um es bei aktuellen und künftigen Gelegenheiten besser zu machen, ist nur rudimentär ausgeprägt. Der fast immer notwendige wissenschaftliche Disput wird in vielen Bereichen der Gesellschaft durch platte Diffamierung der anderen Meinung geprägt, wofür die digitalen Medien neue Foren geschaffen haben. Die einseitige Diskussion von COVID-19 ist ein aktuelles Beispiel dafür. Auch Institutionen des Staats schrecken nicht davor zurück mit Hilfe parteiischer Gutachter zu verunglimpfen oder nehmen inzwischen direkten Einfluss auf Darstellungen in den Leitmedien und den sozialen Medien, die berechtigt eine andere Position vertreten.
Die Einführung von 5G ist ein weiteres solches Beispiel. Die entscheidende beratende Institution International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) wurde durch die Industrie eingerichtet. Im wissenschaftlichen Sinn stellt dies einen Bias (wissenschaftliche Verzerrung) dar, so dass alle Feststellungen dieser Institution mit größter Vorsicht zur Kenntnis genommen werden müssten. Selbst von uns als neutral angesehene Einrichtungen wie die Stiftung Warentest hat in ihrer Bericht zum Risiko der Exposition gegenüber elektromagnetischen Feldern wichtige Publikationen nicht berücksichtigt und tendenziell informiert. Ihr informatives Treffen in Berlin war zudem nicht paritätisch besetzt. Auch in diesem Treffen und dem publizierten Artikel vertrat man die gewünschte Ansicht von Prof. Lerchl, dass die ein erhöhtes Krebsrisiko nachweisende REFLEX-Studie wissenschaftlich nicht haltbar sei. Diese Ansicht ist zwischenzeitlich gerichtlich widerlegt. Kann ein Staat ein Interesse daran haben, die Risiken einer technischen Neuerung zu erforschen, wenn er am Gewinn seiner Nutzung unmittelbar beteiligt ist. Er wird seine exekutive Macht nutzen, um Kritiker in irgendeiner Form verstummen zu lassen. Würden wir einem Täter die Beurteilung des Tathergangs überlassen? Der Staat tut das in Fällen von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung. Gerichte können allenfalls bei formalen Fragen etwas beitragen. Inhaltlich können sie keine Lösungen bieten.
Wenn neue Krankheiten mit neuen Symptomen auftauchen, ist dies immer ein Tummelfeld der Psychiatrie und Psychologie. Beide Disziplinen vereinnahmen solche Syndrome in ihr Gebiet und individualisieren dadurch das Problem, weil der Umgang der betroffenen Person mit einer Einwirkung so zum eigentlichen Problem wird. Diese Gebiete waren bei unterschiedlichen gesellschaftlichen und politischen Konditionen immer System stützend. Der Aufarbeitung dieser immanenten Problematik haben sich Psychiatrie und Psychologie ähnlich wie die katholische Kirche in ihrem Bereich nicht angemessen gestellt. Die chemische Industrie hat ein großes Interesse daran, die Zusammenhänge der Exposition gegenüber Chemikalien und der Entstehung neuer Krankheiten ungeklärt zu lassen. Die Berufsgenossenschaften stehen der Realisierung dieses Ziels zur Seite. Die Bewertung der Multiple Chemikal Sensitivity (MCS) ist ein Beispiel solcher Strategien. Die Menschen, die daran erkranken, reagieren auf Stoffkonzentrationen, die anderen nichts ausmachen und die sie selbst zuvor vertragen haben. Es spricht gegen eine toxikologische Ursache. Sie reagieren anders als Allergiker auf eine Vielzahl völlig unterschiedlicher Chemikalien gleich. Die Reaktionen sind bei Menschen verschiedener ethnischer und sozialer Herkunft weltweit identisch. Gerade dies spricht gegen psychosomatische Erkrankungen, die deutliche ethnische Unterschiede aufweisen. Es wundert dennoch nicht, dass für das Konzept der MCS Studie des Robert Koch-Instituts (RKI) im Auftrag des Umweltbundesamts ausschließlich psychiatrische Aspekte gewählt wurden, da von vornherein nur diese Möglichkeit verfolgt werden sollte. Der Vertreter des Umweltbundesamts (UBA) hatte das gleich in der ersten Sitzung deutlich gemacht. Analysen funktioneller Systeme des Körpers, die in der wissenschaftlichen Literatur in diesem Zusammenhang bereits publiziert waren, waren nicht vorgesehen.
Wenn bisher der Eindruck entstanden sein könnte, dass ich an der Redlichkeit von Wissenschaftlern generell zweifle, kann ich beruhigen. Ich kenne eine ganze Reihe renommierter Wissenschaftler persönlich, deren Leistung meinen größten Respekt hat und die sich nie einer billigen Sache dienlich gemacht haben oder machen würden. Dies trifft auch auf den zuvor angesprochenen Sachverhalt zu. Die Evaluierung und Validierung der psychiatrischen Erhebungen der untersuchten 200 Patienten erfolgten unter der Leitung einer Professorin der Psychiatrie. Sie kam zu dem eindeutigen wissenschaftlichen Ergebnis, dass diese Patienten an keiner der uns bekannten psychischen oder psychosomatischen Krankheiten leiden. Es wurde auch festgestellt, dass keine Hysterie, keine unbegründeten ökologischen Ängste und keine Hypochondrie vorliegen. Auch der von einem Hochschulprofessor geprägte Begriff der Ökochondrie fand keinen Widerhall. (Anmerkung: eine Verballhornung der Begriffe Ökologie und Hypochondrie, um unbegründeter Ängste vor gefährlichen ökologischen Einflüssen zu unterstellen)
Die Studie ergab außerdem, dass es sich bei MCS um eine der schwersten uns bekannten Krankheiten handelt. Es gibt für die Bemessung des Schweregrads der Auswirkung von Krankheiten international gültige Standards. Sie wurden angewendet. MCS wurde beispielsweise schwerwiegender eingestuft als Tumorkrankheiten oder die Krankheiten des Herz-/Kreislaufsystems mit Ausnahme der transplantationspflichtigen Herzerkrankung. Diesem Ergebnis tragen bis heute weder die Sozialgerichte mit ihren Entscheidungen noch deren wie gewünscht zuverlässig einschätzenden und abwiegelnden Gutachter Rechnung. Der Grad der Behinderung (GdB) wird im Versicherungswesen und der Rechtsprechung der Sozialgerichte mit 25–30 % anerkannt und müsste bei allen Betroffenen wenigstens 50 % betragen. Er kann in schweren Fällen bis zur völligen Erwerbsunfähigkeit von 100 % reichen. Als Diagnose wird weiterhin insbesondere durch die Rentenversicherung nur eine psychiatrische Diagnose akzeptiert. Dies verhindert, dass das Ausmaß der durch Umwelteinflüsse auf diese Weise erkrankten Personen in der Statistik ersichtlich wird. Die Vorsitzende der Rentenversicherung lehnte diesbezügliche Gespräche kategorisch ab.
Wie bereinigt man ein solches von UBA und RKI nicht gewünschtes Ergebnis? Man inszeniert eine Folgestudie. Was muss geschehen? Die kritische Professorin wurde ebenso wie die beiden aufmerksamen wissenschaftlichen Beiräte nicht mehr berufen, von denen ich einer war. Eine Klinik, die eine große Fallzahl beigetragen und korrekt bewertet hatte, wurde ausgeschlossen. Bei der Nachbetrachtung der kleinen Kollektive von vier bis sechs Patienten durch die „genehmen“ Teilnehmer wurden nun psychische Ursachen als Grund der Erkrankung festgestellt. Staat und Industrie hatten, was sie wollten. Es wäre das erste Mal, dass durch Verkleinerung eines ausgewerteten Kollektivs die wissenschaftliche Genauigkeit zugenommen hätte.
Wie verdeckt man einen Interessenkonflikt? Zum Thema Multiple Chemikalien Sensitivität hatte der Betriebsarzt der BASF einen tendenziösen Artikel im Deutschen Ärzteblatt geschrieben. Es wäre natürlich ungünstig gewesen, wenn unter dem Autorennamen seine Tätigkeit und die Anschrift seiner Abteilung als Betriebsarzt gestanden wären. Also gab man als Korrespondenzadresse die der Co-Autorin an, einen Lehrstuhl für Arbeitsmedizin einer deutschen Universität.
Ein weiteres Beispiel, wie man eine unausgewogene Information in die Öffentlichkeit lanciert und gleichzeitig verdeckt, welche Interessen bestehen und welcher Bias wissenschaftlich vorliegt, ist der bereits angedeutete Workshop über Multiple Chemical Sensitivities im Februar 1996 in Berlin. Beteiligt waren das Bundesministerium für Gesundheit, das Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin (BgVV) und das Umweltbundesamt. Man hatte das Internationale Programm für Chemikaliensicherheit (IPCS) als Veranstalter gewonnen, das der WHO angegliedert ist und wegen seiner Nähe zur Industrie ins Gerede gekommen war. Teilnehmer waren Toxikologen, Neurologen Psychologen und Vertreter der Bereiche Umwelt und Gesundheit sowie Hygiene. Unter den Non-Government-Organisationen (NGO) waren die Vertreter von Bayer, BASF und Monsanto geführt worden. NGO vertreten eigentlich öffentliche Interessen und nicht die der Industrie. Man versuchte dadurch die Beteiligung von Lobbyisten zu verschleiern. Ein besonders interessanter Teilnehmer war der Amerikaner Dr. Ronald Gots, der Präsident des National Medical Advisory Service (NMAS), der Risk Communication International (RCI), und des Environmental Sensitivities Research Institute (ESRI) war. Diese Organisationen wurden durch die Industrie wesentlich unterstützt. Die Direktoren der Gesellschaften waren zu dieser Zeit Manager von Proctor & Gamble, Monsanto und Cosmetic, Toiletry, Fragrance Association. Er selbst hatte sich mit der Agitation gegen MCS-Patienten einen Namen gemacht und hatte zum Zeitpunkt des Workshops seit zwanzig Jahren keinen Patienten mehr gesehen. Nur Claudia Miller, zusammen mit Nicholas Ashford Autorin des Buchs Chemical Exposures, konnte man Neutralität und Sachkenntnis unter den Teilnehmern bescheinigen.
Einen Vertreter, der die klinischen und sozialen Probleme dieser schwer kranken Menschen und die Schwierigkeiten der Behandlung kannte und die Interessen dieser Menschen hätte vertreten können, hatte man nicht eingeladen. Ich hatte als damaliger Vorsitzender Vorstand des Deutschen Berufsverband der Umweltmediziner (dbu) keine Einladung erhalten, obwohl die Mitglieder des dbu die Einzigen waren, die solche Patienten auch in nennenswerter Zahl betreuten. Ziel der Veranstaltung war es, die Diagnose Idiopathic Environmental Illness (IEI) statt MCS zu etablieren. Wer hatte ein Interesse daran? Zuerst der Staat mit seinen beteiligten Behörden selbst. Es sollte nicht deutlich werden, dass Umsätze und Steuern durch Produkte erwirtschaftet werden, die eine nennenswerte Zahl der Bürger schwer erkranken lassen, und die dadurch entstehenden Kosten von der Solidargemeinschaft der Versicherten getragen werden müssen. Vor allem aber auch die chemische Industrie, die durch diese Diagnose bereits als Verursacher gebrandmarkt war.
17 Personen waren abstimmungsberechtigt. Nur 7 von ihnen hatten zum Thema publiziert: Keiner der Teilnehmer behandelte solche Patienten, die isoliert von der Gesellschaft und von ihrem gewohnten sozialen Umfeld, oftmals auch isoliert von ihrer Familie, leben müssen, um jeglichen Chemikalienkontakt vermeiden zu können. Fast alle müssen ihren Beruf aufgeben. Sie können nichts spontan unternehmen und Nahrung nur in eingeschränktem Maß tolerieren. Nach ungewollten Expositionen können sie rasch ihre kognitive Hirnleistung anfangs vorübergehend, mit der Zeit auf Dauer einbüßen, die oftmals hoch war, bevor sie erkrankten. Sie leiden an einer der schwersten Krankheiten, die wir kennen. Es gibt keine speziellen Ambulanzen, Krankenhausbetten oder Rehabilitationen. Sie sind die Lepra-Kranken der Moderne. Da überrascht es, welches Verständnis und Mitgefühl für eine überwiegend gesunde Gesellschaft aufgekommen sind, wenn nur teilweise vergleichbare Einschränkungen, immer auf einige Wochen befristet, während der COVID-19 Pandemie erfolgt sind, mit denen MCS Patienten ab dem Beginn ihrer Erkrankung in der Regel das ganze verbleibende Leben zurechtkommen müssen. Sie haben keine Fürsprecher im Gesundheitswesen, in der Politik oder den Medien. Die sozialen und psychischen Folgen sind in diesen Fällen ohne Belang. Die Gesellschaft behandelt sie als Sonderlinge und lacht hinter vorgehaltener Hand, wenn sie Schutzmasken tragen, die bei der Corona Pandemie große Wertschätzung erfahren haben. In den Talk Shows kommen sie nicht vor.
Das Ergebnis dieser Sitzung in Berlin wurde als WHO-Beschluss in einer Pressekonferenz sofort der Öffentlichkeit mitgeteilt. Auf Grund einer internationalen Protestwelle distanzierten sich WHO, UNEP (United Nations Environmental Program) und die ILO (International Labor Organisation) von dem Berliner Beschluss. Mit Ausnahme der deutschen Behörden und der Vertreter deutscher Universitäten, die allesamt durch Steuergelder finanziert werden, kehrten alle zum ursprünglichen Terminus Multiple Chemikalien Sensitivität (MCS) zurück. Das Beispiel zeigt, dass man durch geeignete Auswahl eines Forums immer versuchen kann, ein von Lobbyisten gestecktes Ziel zu erreichen. Es scheitert nur dann, allerdings längst nicht immer, wenn die Öffentlichkeit oder einzelne Personen wachsam sind. Der Staat ist Pate auch in diesem Deal gewesen.
Zu der ganzen Angelegenheit teilte Dr. M. Marcier, Director International Program on Chemical Savety Herrn Dr. A. Donnay, MCS Referral & Resources an der John Hopkins University, am 21. März 1996 mit:
„The Workshop held in Berlin on 21–23 February on ‚multiple chemical sensitivities‘ and some other environmental intolerances was for the purpose of an exchange of views between invited experts from a number of countries. The views expressed were those of the experts and a report, prepared by the experts, will carry the standard WHO disclaimer to this effect.
International Non-Govermental-Organisations concerned with worker health with which IFCS corresponds are:
ICEM
International Federation of Chemical, Energy, General Workers & Miners Union. Brussels
ICFTU
International Confederation of Free trade Unions. Brussels“