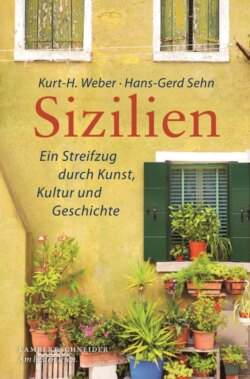Читать книгу Sizilien - Kurt-Heinz Weber - Страница 10
Tote auf Bestellung
ОглавлениеEin anständiges Verbrechen muss schon her, am besten ist immer noch ein Mord. Er falle „mit der Leiche ins Haus“, schrieb Ernst Bloch über den Kriminalroman. Die im Englischen gebräuchliche Bezeichnung „Detektivgeschichte“ verweist darauf, dass noch ein anderes Ingrediens dazugehört, nämlich der Ermittler. Er ist derjenige, der das Verbrechen aufklärt. Er kann schrullig, kauzig oder bärbeißig sein, eine Asphaltratte wie Chandlers Privatdetektiv Philipp Marlowe, ein stiller Pfeifenraucher wie Simenons Kommissar Maigret oder, mein lieber Watson, ein notorischer Besserwisser wie Conan Doyles Sherlock Holmes. Etwas Besonderes ist er allemal und seinen Kollegen, also den anderen Ermittlern, um einiges voraus. Der Leser macht sich mit ihm auf Verbrecherjagd, folgt Hinweisen, sichtet und kombiniert, um am Ende zu erfahren, ob er richtig lag. Die Lösung des Falls ist ein wesentlicher Bestandteil des Krimis. Er ist so angelegt, dass durch das schlüssige Zusammenfügen der Indizien und Fakten der Mörder überführt werden kann. Geschieht das nicht, fühlt sich der Leser genarrt. Dass eine Schuld ungesühnt bleibt, beleidigt überdies seinen Gerechtigkeitssinn. Gerecht soll es doch zugehen, wenn schon nicht in der Welt, so doch wenigstens im Krimi.
Reißerisch sind an Leonardo Sciascias (1921–1989) Kriminalromanen nur die deutschen Titel, sie heißen Tote auf Bestellung oder Tote Richter reden nicht. Doch die damit geweckten Erwartungen erfüllen sie nicht. Korrekt übersetzt, wie in Neuauflagen geschehen, müssten die Titel auch lauten: Jedem das Seine (A ciascuno il suo, 1966) und Der Zusammenhang (Il contesto, 1971). Das entspricht schon eher ihrem Charakter. Die Täter werden nicht gefasst, und das verstößt wie angemerkt gegen die Gesetze des Genres. Auch darauf bezog sich der berühmte italienische Schriftsteller Italo Calvino (1923–1985), als er an Sciascia über eines von dessen Büchern schrieb:
Lieber Leonardo, ich habe deinen Krimi, der kein Krimi ist, mit der gleichen Leidenschaft gelesen, mit der man Krimis zu lesen pflegt, und außerdem mit dem Vergnügen, zu verfolgen, wie die Krimi-Form demontiert wird, oder besser gesagt, wie die Unmöglichkeit des Kriminalromans in sizilianischer Umgebung demonstriert wird.
Auf Sizilien kann es keine Krimis geben, weil die Mörder nicht gefasst werden beziehungsweise weil sie sich oft genug der Strafverfolgung entziehen. Und dafür gibt es ein Wort: Mafia. Sciascias Kriminalromane befassen sich mit Verbrechen, hinter denen diese Vereinigung steht. Dabei geht es nicht einfach um organisierte Kriminalität, die gibt es anderswo auch, sondern um den Zustand einer Gesellschaft, in der die Kriminalität eng verflochten ist mit der Politik, der Verwaltung, der Wirtschaft und der Kirche. Sciascias Verbrechergeschichten sind also zu einem guten Teil Gesellschaftsanalysen, dabei aber so spannend wie richtige Krimis. Exemplarisch für sie ist der Roman Der Tag der Eule (Il giorno della civetta, 1961).
Ein Mann wird erschossen, am helllichten Tag, gerade als er auf dem Dorfplatz in den Bus steigen will. Als die Polizei eintrifft, will keiner etwas gesehen haben, weder in dem vollbesetzten Bus noch auf dem belebten Platz. Bei dem Ermordeten handelt es sich um den Vorsitzenden einer Baugenossenschaft. Der Carabinieri-Hauptmann Bellodi, der die Untersuchungen leitet, kommt vom „Festland“ aus Parma, ein gewissenhafter, pflichtbewusster Beamter. Für ihn deutet alles darauf hin, dass es um Vergabe von Aufträgen und um Schutzgelderpressungen geht. Ein weiterer Mord, der wohl einen Zeugen beseitigen sollte, weist in dieselbe Richtung. Durch einen Polizeispitzel und durch raffiniert durchgeführte Verhöre gelangt Bellodi auf die richtige Fährte. Er kann auch einen der Auftraggeber für die Morde ermitteln, einen ehrenwerten, geachteten Bürger. Aber es endet doch damit, dass der Hauptmann den dringend Tatverdächtigen nichts nachweisen kann.
Dass die zunächst erfolgreichen Nachforschungen der Polizei scheitern, ist darauf zurückzuführen, dass im Verborgenen Regie geführt wird. Da gibt es das Netz von Beziehungen, das bis nach Palermo und Rom reicht, bis zum Abgeordneten und zum Minister. Bei einer Tasse Kaffee lässt man eine Bemerkung fallen über einen nach Sizilien beorderten Polizeioffizier, der etwas zu eifrig ist; der überdies im Krieg bei den Partisanen war, also Kommunist sein muss. Oder seine Exzellenz zeigt sich am Telefon ungehalten darüber, dass in der Provinz die Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollten. Da müssen die zuständigen Leute gefälligst für Ordnung sorgen. Man kann vieles regeln, indem man einen Polizeioffizier versetzen lässt oder indem man Verdächtigen ein sicheres Alibi verschafft. Dass es Personen und Instanzen gibt, die hinter den Kulissen die Verfahren und Aktionen steuern, spiegelt die Erzählstruktur wider. In die Berichte über den Gang der Ermittlungen und in die Wiedergabe der Verhöre sind Gespräche und Telefonate von Personen eingeblendet, die teilweise anonym bleiben. Die Organisation, die hinter den Verbrechen steht, die zudem über die Macht verfügt, die Täter vor Strafverfolgung zu schützen, ist nicht zu fassen. Das macht auch ihre Unheimlichkeit aus.
Einer wie Hauptmann Bellodi passt nicht nach Sizilien. Er handelt im Glauben an das Recht. Zwar können die Gesetze nur begrenzt für Gerechtigkeit sorgen, aber sie sind doch nötig, um ein Zusammenleben überhaupt zu ermöglichen. Die Polizei ist dafür da, ihre Einhaltung zu überwachen. Was dem Hauptmann jedoch entgegenschlägt, ist ein tief sitzendes Misstrauen, wenn nicht gar offene Ablehnung. Über die Vernehmung von Zeugen heißt es: „Jahrhundertealtes Schweigen schien auf ihren Gesichtern zu liegen.“ Diese Haltung erstreckt sich auf den ganzen Staat und seine Einrichtungen. Offensichtlich erwarten die Sizilianer die Regelung ihrer Angelegenheiten von anderen Stellen. Da ist der kleine Mann, der der festen Überzeugung ist, das Gesetz mache der, „der die Macht hat“, es nehme „von den Gedanken und Launen dieses Mannes seinen Ausgang“. Das entspricht wohl auch der Lebenserfahrung dieses Mannes. Von einem redegewandten Verteidiger muss sich Bellodi einen Vortrag über Gerechtigkeit anhören. Danach bestünde diese darin, für einen Ausgleich der Interessen zu sorgen, „Frieden zu stiften“. Das könne aber das Gesetz nicht verbürgen. Sein Mandant, eben der Ehrenmann, den die Polizei verhaftet hat, habe in diesem Sinne gewirkt. Dass dieser honorige, sich um das Wohl seiner Mitmenschen kümmernde Bürger bei seinem Eintreten für das, was er unter Gerechtigkeit versteht, auch vor Mord nicht zurückschreckt, sagt der Advokat natürlich nicht. „Die Familie ist der eigentliche Staat des Sizilianers“, resümiert Sciascia. Und bitter sarkastisch ist seine Bemerkung von „der Regierung der Schrotflinten“. Es ist diese Verfassung der Gesellschaft, die eine Organisation wie die Mafia entstehen lässt und sie begünstigt. Dabei soll dem Hauptmann eingeredet werden, dass eine solche Vereinigung gar nicht existiere, sondern nur einem auf dem Festland gepflegten Vorurteil entspringe. Wozu noch zu sagen wäre, dass Bellodi keineswegs voreingenommen ist, dass er versucht, sich in die sizilianischen Verhältnisse und in die Mentalität der Sizilianer hineinzudenken.
In Sciascias Darstellung wird die Mafia nicht mit einer Gloriole versehen. Ihre Mitglieder haben nicht die Größe von Gesetzesbrechern, die nur ihren eigenen Vorstellungen von Treue, Anstand, Gerechtigkeit und Ehre folgen. Es wird also nicht ein Bild entworfen wie in anderen Mafia-Romanen, beispielsweise in Mario Puzos Paten, in dem ein Gangster-Clan geradezu das Ansehen einer adligen Dynastie gewinnt. Gar nicht fein sind die Methoden, derer sich die Mafia bedient. Es beginnt mit einer als freundlichen Hinweis getarnten Aufforderung, eine gewisse Leistung zu erbringen. Reagiert der Angesprochene nicht, geht man zu Drohungen über, die dann auch massiver werden, das heißt, in Tätlichkeiten übergehen. Schließlich liquidiert man den Widerspenstigen. Diejenigen, die die Drecksarbeit machen, sind schäbige kleine Ganoven, die ohne Gewissensbisse heimtückisch morden. Dabei kann es auch einen Unbeteiligten treffen, der nur das Pech hatte, zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort zu sein. Falls einer dieser Kriminellen doch gestellt wird, funktioniert er nach einem vorgegebenen Muster. Die Schuld wälzt er nach unten ab, und dass es Anstifter gegeben hat, wird er unter allen Umständen leugnen. Diejenigen, die hinter diesen Taten stehen, geben sich als rechtschaffene Bürger, als Wohltäter und gute Christen aus, haben aber nur die eigene Bereicherung im Sinn. Von einer „ehrenwerten Gesellschaft“ kann also nicht die Rede sein.
Der Zustand, den Sciascia beschreibt, ist freilich überholt; heute hat die organisierte Kriminalität andere Formen angenommen. Das, was sich bis in die Achtziger- und Neunzigerjahre des vorigen Jahrhunderts lähmend auf das sizilianische Leben legte, der zum Alltäglichen gewordene Mord, die Atmosphäre der Angst und der Einschüchterung, die selbst der Tourist spürte, gibt es nicht mehr. Worauf allerdings auch der heutige Besucher trifft, sind die ungeheuren Zerstörungen, die die Mafia im Verein mit korrupten Politikern angerichtet hat. Vor allem Palermo wurde das Opfer einer beispiellosen Boden- und Bauspekulation, die man „sacco di Palermo“ (Plünderung Palermos) genannt hat, worüber noch zu reden sein wird. Vincenzo Consolo hat diese Vorgänge in seinem Roman Palermo. Der Schmerz (Lo spasimo di Palermo, 1998) verarbeitet. Die Trauer über das brutale Niederreißen von ganzen in Gärten gelegenen Wohnbezirken, von wunderbaren, grünen Refugien, teilt sich einem noch beim Lesen mit.
Für Leonardo Sciascia ist der Kriminalroman nur eine Möglichkeit, über sein eigentliches Thema zu reden, und das ist „Sizilien“, wie er im Vorwort zu Le parrocchie di Regalpetra (1956, Salz, Messer und Brot) ausdrücklich vermerkt. Mit der fiktiven Gemeinde Regalpetra – sie trägt Züge seines Geburtsortes Racalmuto – entwirft er das Bild einer für Sizilien typischen Kleinstadt. Dieses entsteht aus einer Zusammenstellung von Erzählungen, Berichten, Reportagen, Gesprächen, Statistiken. Es sei ihm darum gegangen, „die schmerzhaften Punkte der Vergangenheit und Gegenwart zu“ berühren, sagt er. Eindrucksvoll ist vor allem, was er – er war Volksschullehrer in seiner Vaterstadt – über die Verhältnisse in der Schule mitzuteilen hat. Es ist dies eine Studie über die Verwüstungen, die die Armut an Leib und Seele anrichten kann. Sciascias Schüler kommen aus den unteren Schichten der Gesellschaft. Die Dürftigkeit und die Entbehrungen, die sie erdulden müssen, hat sie verrohen lassen. Schon früh sind sie gezwungen, neben der Schule zu arbeiten, um zum Unterhalt der Familie beizutragen. Die Not, in der sie leben, ist „stagnierend und ausweglos“. „Ihre Wirklichkeit“ besteht „aus Elend und Groll“, und die Verhältnisse machen sie zu „Lügnern“; sie „entwickeln eine vertrackte, grundlose Bosheit“. Sciascia schildert das mit spürbarer Anteilnahme, er bleibt dabei aber nüchtern und lässt die Tatsachen sprechen, und gerade dadurch wirkt seine Darstellung so erschütternd. Ähnlich verfährt er bei der Beschreibung der Arbeitsverhältnisse auf dem Land und in den Bergwerken. Bei der Wiedergabe sozialer Missstände dürfe man nicht ins „Literarische“ verfallen, fordert er, mit Recht, denn dadurch läuft man Gefahr, der Misere einen gefälligen Anstrich zu geben.
Sciascia galt in Italien als moralische Instanz, nicht nur weil er als Schriftsteller eine engagierte Haltung einnahm, sich gegen soziale Missstände, gegen die Mafia und die Korruption wandte. Er hat sich auch als Politiker für seine Vorstellungen eingesetzt, saß als Vertreter der Linken und der Unabhängigen im Stadtrat von Palermo und war Mitglied des italienischen und des europäischen Parlaments. Zu dem, was er für die Wesensart seiner Landleute hält, hat er sich in dem Essayband Mein Sizilien geäußert. Der Nationalcharakter ist für ihn keine mythische Größe, sondern das Ergebnis der Erfahrungen mit der Natur und der Geschichte des Landes. „Unsicherheit“ sei der hervorstechende Zug der sicilitudine, des Sizilianischen. Sie gründe schon in der insularen Existenz. Das Meer bedeute für den Sizilianer nicht die Verlockung des Unbekannten, vielmehr habe es den Feinden und Invasoren als Einfallstraße gedient, von den Griechen bis zu den Amerikaner. Daher das „Misstrauen des Sizilianers gegenüber dem Meer“. Sciascia zitiert zahlreiche sizilianische Sprichwörter, die vor ihm warnen, zum Beispiel: „Wer über Land gehen kann, der fahre nicht übers Meer“. Immer wieder andere Eroberer aus Übersee hätten die Sizilianer zu erdulden gehabt, die die Insel zu ihrer „Kolonie“ machten. Die Unsicherheit ist, Sciascia zufolge, auch durch die Geologie bedingt. Er führt die Ausbrüche des Ätna an, und neben der zerstörerischen Kraft des Vulkanismus sind es verheerende Erdbeben, die Sizilien immer wieder erschütterten. Das Gefühl der Gefährdung und der Furcht könne, so Sciascia, auch umschlagen in „trotzige, dünkelhafte, arrogante Haltungen“, in den Wahn, etwas Besonderes zu sein, wie es Lampedusa richtig diagnostiziert habe. Es widerspricht dem nicht, gehört vielmehr zu dieser Gefühlslage, wenn Sciascia seinen Landsleuten einen gewissen Minderwertigkeitskomplex bescheinigt. Er manifestiere sich im „Mythos vom Festland“, im Trugbild vom „ordentlichen, sauberen Festland“. Von dem speziellen Verhältnis der Sizilianer zum Staat wurde schon gesprochen.