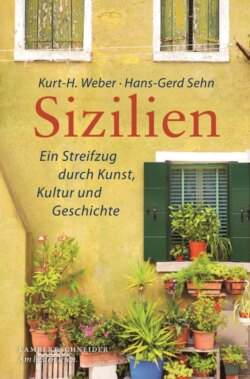Читать книгу Sizilien - Kurt-Heinz Weber - Страница 6
Zur Einführung
ОглавлениеSie ist eine Quelle wie andere auch. Doch wenn man erfährt, dass die Arethusa-Quelle ihren Namen von den Griechen hat und benannt ist nach der Nymphe Arethusa, einem antiken Fabelwesen, sieht man sie mit anderen Augen an. Dann ist sie mehr als nur ein beliebter Treffpunkt auf der Insel Ortigia im alten Zentrum von Syrakus. Dann bekommt der Umstand eine besondere Bedeutung, dass es von ihr nur einige Schritte zum Meer sind, welches noch heute nach einem griechischen Volksstamm das „Ionische“ heißt. Über dieses Meer sind die Griechen nach Sizilien gekommen. Sie gründeten Syrakus und andere Städte und machten die Insel zu einem Teil des hellenischen Kulturkreises. Die hübsche Sage, die sich um die Quelle gebildet hat, will wissen, dass sie ihr Wasser direkt aus Griechenland, aus Olympia bezieht. Dies ist keineswegs nur eine phantasievolle Geschichte, denn in ihr manifestiert sich auch die Verbundenheit der antiken Sizilianer mit der alten Heimat. Sie haben Arethusa sehr verehrt, und auf einer der schönsten Münzen aus Syrakus ist deren Bild zu sehen: Es ist das Gesicht eines anmutigen Mädchens, das umrahmt ist von wallendem, langem Haar, ein wahres Wasser- und Brunnenhaupt. Platon hat an der Quelle gestanden und Archimedes und viele andere berühmte und weniger berühmte Menschen, und ohne ihr lebensspendendes Wasser wäre eine der größten und prächtigsten Metropolen der alten Welt, wäre Syrakus gar nicht erst entstanden.
Die Arethusa-Quelle ist lediglich ein Beispiel dafür, dass Orte verknüpft sind mit Ereignissen und Menschen der Vergangenheit. Was früher war, hat Spuren hinterlassen in Namen und Gebäuden, in Ruinen und Wegmarken, in Siedlungsformen und im Landschaftsbild. All das bleibt zunächst stumm. Es beginnt erst zu sprechen, wenn man den Hinweisen nachgeht. Dann erzählen die Dinge von dem, was doch Teil ihres Wesens ist, von ihrem Ursprung und ihrer Bestimmung, von den Menschen, die ihnen die Namen gaben und die sie schufen. Sie erinnern an Schicksale und Begebenheiten, sind geprägt von einem früheren Leben. Die Gegenstände gewinnen eine Dimension hinzu, die der Geschichte. Nun erst entfalten sie ihren ganzen Reichtum, ihre Eigenart tritt hervor und sie zeigen bis dahin verborgene Seiten. „Was man weiß, sieht man erst“, hat Goethe gesagt – und das gilt natürlich auch für das Reisen.
Es gibt viel zu sehen auf Sizilien. Was sich hinter den Eindrücken verbirgt, davon will dieses Buch berichten; es will empfänglich machen für die Gegebenheiten, die sich dem Besucher darbieten. Es ist kein Reiseführer im engeren Sinne, der in der Art eines Nachschlagewerkes oder Kompendiums knappe Informationen über das Reiseland bereitstellt. Vielmehr ist der vorliegende Band als Reisebuch angelegt, denn er holt weiter aus und beleuchtet kulturelle, historische, gesellschaftliche und politische Zusammenhänge. Dabei ist der Ausgangspunkt stets eine Ansicht, eine Szenerie, ein Bild oder ein Name. Das ist überhaupt das Prinzip der Darstellung: Sie nimmt zunächst auf, was einem auf Streifzügen durch das Land begegnet, um daran eine Erläuterung anzuschließen, die zum Verständnis des Wahrgenommenen beitragen soll. So werden im Zusammenhang mit den Tempeln von Agrigent einige Gedanken zur griechischen Religion vorgetragen, und der Besuch des Doms von Palermo gibt Anlass dazu, der Gestalt Friedrichs II. nachzugehen. Zugegeben, man kann auch anders unterwegs sein, kann einfach losfahren, kann sich treiben und überraschen lassen, unbelastet von irgendwelchen Kenntnissen, einzig dem hingegeben, was einem zufällig vor die Augen kommt. Das wäre jedoch eine andere Art des Reisens, die natürlich ihren Reiz hat, allerdings Gefahr läuft, am Sehenswerten vorbeizugehen.
Es sind drei große Kulturen, die das Erscheinungsbild und das Leben Siziliens nachhaltig bestimmten: das antike Griechentum, die Verschmelzung byzantinischer, arabischer und normannischer Elemente im Mittelalter und das Barock. Diesen Blütezeiten widmet sich je ein Kapitel (3, 4, 5), während sich die ersten beiden mit der Literatur der Sizilianer beschäftigen und damit, worauf seit jeher die Anziehungskraft Siziliens für Reisende beruhte. Mehr der Gegenwart zugewandt sind die letzten beiden Kapitel: Eines stellt die Küche der Insel vor, das andere befasst sich mit der Mafia.
Wie die Sizilianer ihr Land sehen, wie sie ihre Geschichte deuten, wie sie sich selbst einschätzen, das erfährt man am besten von ihren Schriftstellern. Deshalb nähert sich das erste Kapitel der größten Insel Italiens über deren Literatur. Sie erzählt vom Leben der Menschen dort, beschreibt ihre Daseinsbedingungen, ihre Denk- und Verhaltensweisen, sie geht ein auf die Natur und die Geschichte des Landes. Das Kapitel folgt den großen Themen der sizilianischen Literatur: Es geht um die Lage und das Leben der armen Landbevölkerung, um die Umbrüche in den Zeiten des sogenannten „Risorgimento“, der Einigung Italiens, um die spezifisch sizilianische Vorstellung von Männlichkeit und nicht zuletzt um die sozialen Folgen des organisierten Verbrechens.
Nach diesem über die Literatur vermittelten Blick auf Sizilien aus der Sicht der Einheimischen, geht es im zweiten Kapitel darum, was die Fremden auf Sizilien suchten. Italien war schon früh ein Reiseland. Seine Kunstschätze und seine Kultur zogen Fremde an. Davon ausgenommen war zunächst Sizilien. Es wurde als eine abgelegene Insel angesehen, die zu besuchen, sich kaum lohnte. Das änderte sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Nun erschien Sizilien als ein attraktives Reiseziel. Gefördert wurde diese Entwicklung durch berühmte Besucher – einer von ihnen war Goethe. Insbesondere die Deutschen suchten nach den Zeugnissen einer glanzvollen Vergangenheit, nach den Hinterlassenschaften der Griechen und der deutschen Kaiser. Die Begegnung mit dem Süden ist zugleich ein exemplarisches Stück aus der Geschichte des Reisens.
Ihre Tempel stehen auf den Hügeln, in Agrigent und anderswo. Von den antiken Völkerschaften, die nach Sizilien kamen und es beherrschten, waren die Griechen diejenigen, die das Land am stärksten prägten. Ihnen ist das dritte Kapitel gewidmet. Zu ihren Gründungen zählte Syrakus, zeitweilig die größte und mächtigste Metropole der alten Welt. Dichter und Philosophen kamen hierher, der Philosoph Platon und der Dramatiker Aischylos. Doch hat Sizilien auch selbst berühmte Männer hervorgebracht, etwa den Philosophen, Arzt und Staatsmann Empedokles. Die Redekunst (Rhetorik) und die Hirtendichtung (Bukolik), Inventionen des europäischen Geistes von bleibender Bedeutung, haben ihren Ursprung auf Sizilien. Das Kapitel sucht die antiken Stätten auf und erläutert an ihrem Beispiel verschiedene Seiten der griechischen Kultur: am Theater von Syrakus das Schauspielwesen, an den Tempeln von Agrigent die Religion, an der Stadtanlage von Selinunt die Ordnung der Polis.
Er wurde bewundert und gehasst. Dass er ein ungewöhnlicher Mann war, eine herausragende Gestalt der mittelalterlichen Geschichte, darüber besteht kein Zweifel. Die Rede ist von dem Stauferkaiser Friedrich II., dem sich das vierte Kapitel widmet. Friedrich wuchs in Palermo auf und trug als Erbe der normannischen Eroberer auch die Krone des Königs von Sizilien. Er war vielseitig begabt, war ein weitblickender Staatsmann, ein Wissenschaftler und Dichter. Vieles von dem, was er anstrebte, hat er jedoch nicht erreicht, und so gestaltete sich sein Leben als eine einzigartige, große Tragödie. Auf Sizilien schuf der Stauferkaiser eine für das damalige Europa neuartige und den Feudalismus überwindende Staatsverfassung. Doch Friedrich wird man nicht gerecht, ohne auch die Zeit der arabischen und normannischen Herrschaft über die Insel in den Blick zu nehmen.
Im fünften Kapitel muss zunächst von einer gewaltigen Katastrophe berichtet werden. Sie machte aus einem Teil Siziliens ein Trümmerfeld und forderte unzählige Opfer. Was aber danach entstand, war eine Region, die in Europa ihresgleichen sucht. Sie steht ganz im Zeichen des Barock. Es wurden Städte von beeindruckender Einheitlichkeit errichtet, Städte, die wie Gesamtkunstwerke wirken. Aber der Barock war eine gesamteuropäische Erscheinung. Wie die Entwicklung auf Sizilien im europäischen Zusammenhang zu sehen ist, soll hier beleuchtet werden.
Auch das Essen ist ein Teil der Kultur, und auf Sizilien kamen die Köche aus ganz verschiedenen Kulturen. Was sie angerichtet haben, ist eingegangen in die Kochkunst der Insel. Sie hat also Einflüsse sehr unterschiedlicher Art in sich aufgenommen. Appetit machen auf die sizilianische Küche will das sechste Kapitel.
Der Name Sizilien ist eine unglückselige Verbindung eingegangen mit dem der Mafia. Ein Buch über Sizilien muss zwangsläufig auch auf diese dunkle Seite des Landes eingehen. Eine Flut von Veröffentlichungen gibt es darüber. Die Geschichte des organisierten Verbrechens auf Sizilien soll daher nur gestreift werden. Der Schwerpunkt dieses Kapitels liegt darauf, wie sich die aktuelle Situation darstellt und wie diese im Zusammenhang der politisch-gesellschaftlichen Entwicklung zu beurteilen ist. Dazu wurden Recherchen vor Ort angestellt und Zeitzeugen, Opfer und Betroffene befragt. Der für dieses Thema wichtige Begriff des „identitären Verbrechens“ verdankt sich einem Gespräch mit Leoluca Orlando, dem Bürgermeister von Palermo.