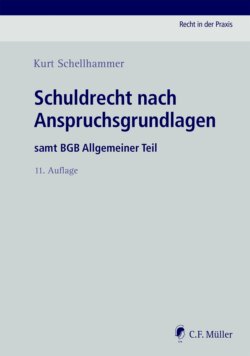Читать книгу Schuldrecht nach Anspruchsgrundlagen - Kurt Schellhammer - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Inhaltsverzeichnis
ОглавлениеVorwort
Vorwort zur 1. Auflage
Inhaltsübersicht
Verzeichnis der Bilder
Abkürzungsverzeichnis
Einleitung Zivilrecht und Bürgerliches Gesetzbuch, Anspruch und Beweislast
1. Kapitel Recht und Rechtsordnung1 – 3
1. Die Rechtsnormen1
2. Die Rechtsquellen2
3. Objektives und subjektives Recht3
2. Kapitel Das Zivilrecht4, 5
1. Die Abgrenzung der großen Rechtsblöcke4
2. Das allgemeine bürgerliche Recht und das Sonderrecht einzelner Lebensbereiche5
3. Kapitel Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB)6 – 10
1. Die Entstehung des BGB6
2. Das System des BGB7
3. Die Sprache des BGB8
4. Das Menschenbild des BGB einst und jetzt9, 10
4. Kapitel Die Rechtsanwendung11 – 15
1. Die Subsumtion des Sachverhalts unter die Rechtsnormen11
2. Die juristische Methode der Falllösung12, 13
3. Die Auslegung des Gesetzes14, 15
5. Kapitel Der Anspruch16 – 19
1. Das System des Zivilrechts16
2. Das subjektive Recht17
3. Der Anspruch des BGB18
4. Der Anspruch im Rechtsstreit19
6. Kapitel Die Behauptungs- und Beweislast20 – 27
1. Das gesetzliche Fundament des Zivilrechts20
2. Eine Last, keine Pflicht
3. Tatsachen und Rechtsfolgen21
4. Die gesetzlichen Beweislastregeln22
5. Die ungeschriebene allgemeine Beweislastregel23
6. Anspruchsgrundlagen, Gegennormen und Hilfsnormen24 – 26
7. Die Behauptungs- und Beweislast für negative Tatsachen27
1. Buch Schuldrecht Besonderer Teil oder: Vom Kauf bis zur unerlaubten Handlung
1. Teil Der Kauf
1. Kapitel Das gesetzliche System des Kaufrechts28, 29
1. Kaufvertrag, Verpflichtungsvertrag, Vertrag28
2. Besonderes und allgemeines Schuldrecht
3. Schuld- und Sachenrecht
4. Das Kaufrecht nach der Schuldrechtsreform29
2. Kapitel Die Ansprüche aus dem Kaufvertrag30 – 47
1. Die Anspruchsgrundlage30
2. Die Rechtsfolgen des Kaufvertrags31 – 34
3. Die Anspruchsvoraussetzung: ein Kaufvertrag35 – 39
4. Der Kaufgegenstand40 – 42
5. Der Kaufpreis43, 44
6. Die Form des Kaufvertrags45
7. Die behördliche Genehmigung des Kaufvertrags46
8. Nebenpflichten aus Kaufvertrag und Kaufverhandlungen47
3. Kapitel Die Haftung des Verkäufers für Sachmängel48 – 53
1. Eine Haftung wegen Vertragsverletzung48
2. Der gesetzliche Vorrang der Nacherfüllung49
3. Die Sachmängelrechte des Käufers auf einen Blick50
4. Die Modernisierungskunst des Gesetzgebers
5. Die Rechtsgrundlagen für die Sachmängelhaftung und ihre Ausnahmen51 – 53
4. Kapitel Der Anspruch des Käufers auf Nacherfüllung54 – 59
1. Die Anspruchsgrundlage54
2. Die Rechtsfolge des Anspruchs auf Nacherfüllung55, 56
3. Die Voraussetzungen des Nacherfüllungsanspruchs57
4. Der Ausschluss des Nacherfüllungsanspruchs58, 59
5. Kapitel Das Rücktrittsrecht des Käufers60 – 65
1. Die Rechtsgrundlage60
2. Die Rechtsfolgen des Rücktrittsrechts und des Rücktritts61
3. Die Voraussetzungen des Rücktrittrechts62 – 64
4. Der Ausschluss des Rücktrittsrechts65
6. Kapitel Das Minderungsrecht des Käufers66 – 68
1. Die Rechtsgrundlage66
2. Die Rechtsfolgen des Minderungsrechts67
3. Die Voraussetzungen des Minderungsrechts68
4. Der Ausschluss des Minderungsrechts
7. Kapitel Der Anspruch des Käufers auf Schadensersatz oder Aufwendungsersatz69 – 80
1. Die bunte Palette der Ersatzansprüche69
2. Die Abgrenzung der unterschiedlichen Arten des Schadensersatzes70
3. Der Anspruch des Käufers auf Ersatz des durch den Sachmangel verursachten Schadens71
4. Der Anspruch des Käufers auf Schadensersatz statt der Leistung72 – 75
5. Der Anspruch des Käufers auf Ersatz des Verzögerungsschadens76, 77
6. Der Anspruch des Käufers auf Ersatz seiner vergeblichen Aufwendungen78, 79
7. Der Rückgriff des Verkäufers80
8. Kapitel Der Sachmangel der Kaufsache81 – 95
1. Der Sachmangel als Vertragsverletzung81
2. Die gesetzliche Definition des Sachmangels
3. Die Beweislast82
4. Die vereinbarte Beschaffenheit der Kaufsache83 – 85
5. Die Brauchbarkeit der Kaufsache zur vertraglich vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung86 – 89
6. Die fehlerhafte Montage90, 91
7. Die Falschlieferung und der Mengenfehler92 – 94
8. Der Sachmangel beim Gefahrübergang95
9. Kapitel Der Gefahrübergang sowie Nutzungen und Lasten beim Kauf96 – 100
1. Das gesetzliche System96
2. Der Gefahrübergang durch Übergabe an den Käufer97
3. Der Gefahrübergang durch Auslieferung beim Versendungskauf98, 99
4. Die Nutzungen und Lasten der Kaufsache100
5. Die Kosten der Übergabe oder Versendung
10. Kapitel Die Einwendungen und Einreden des Verkäufers gegen die Sachmängelrechte des Käufers101 – 114
1. Die Verteidigung des Verkäufers101
2. Die vereinbarte Haftungsbeschränkung102 – 106
3. Die Kenntnis und die grobfahrlässige Unkenntnis des Käufers vom Sachmangel107
4. Die Haftungsbeschränkung des Verkäufers bei einer öffentlichen Versteigerung
5. Die Entlastung des Verkäufers von der Schadensersatzpflicht108, 109
6. Die Verjährung der Sachmängelansprüche110 – 114
11. Kapitel Die Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie115, 116
1. Die vertragliche Garantie einst und jetzt115
2. Die Rechtsfolge der Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie
3. Die Voraussetzungen einer Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie116
12. Kapitel Die Haftung des Verkäufers für Rechtsmängel der Kaufsache117 – 123
1. Das gesetzliche System der Rechtsmängelhaftung117
2. Die Rechtsfolgen des Rechtsmangels der Kaufsache118
3. Der Rechtsmangel der Kaufsache119 – 122
4. Die Einwendungen und Einreden des Verkäufers gegen die Rechtsmängelhaftung123
13. Kapitel Der Kauf von Rechten und sonstigen Gegenständen124 – 128
1. Aus alt mach neu und aus zwei mach eins124
2. Die Ansprüche auf Erfüllung des Kaufvertrags125, 126
3. Die Rechts- und Sachmängelhaftung beim Rechtskauf127
4. Die Rechts- und Sachmängelhaftung beim Unternehmenskauf128
14. Kapitel Die Konkurrenz der Mängelrechte mit anderen Rechten des Käufers129 – 131
1. Der Vorrang des Kaufrechts vor dem allgemeinen Schuldrecht129
2. Die unerlaubte Handlung des Verkäufers130
3. Die Pflichtverletzung des Verkäufers außerhalb von Mängeln131
4. Die Irrtumsanfechtung des Verkäufers
15. Kapitel Die Mängelhaftung des Verkäufers beim Verbrauchsgüterkauf132 – 137
1. Das gesetzliche System132, 133
2. Keine vertragliche Haftungsbeschränkung im Voraus134
3. Die Umgehung des Verbraucherschutzes
4. Die gesetzliche Vermutung für einen Sachmangel beim Gefahrübergang135
5. Die Beschaffenheitsgarantie des Unternehmers136
6. Die Verwirkung des Verbraucherschutzes
7. Der Rückgriff des Unternehmers137
16. Kapitel Besondere Arten des Kaufs138 – 150
1. Der Vorbehaltskauf138 – 141
2. Der Kauf auf Probe142
3. Der Wiederkauf143
4. Der Vorkauf144 – 146
5. Der Handelskauf147 – 150
2. Teil Die Schenkung
1. Kapitel Das gesetzliche System151
2. Kapitel Der Anspruch auf das versprochene Geschenk152 – 158
1. Die Anspruchsgrundlage152
2. Die Rechtsfolge des Schenkungsversprechens
3. Die Voraussetzungen des Schenkungsversprechens153 – 156
4. Die Form des Schenkungsversprechens157
5. Die Haftung des Schenkers158
3. Kapitel Die Schenkung unter Auflage159
4. Kapitel Die Verarmung des Schenkers160, 161
1. Die Notbedarfseinrede des Schenkers160
2. Der Anspruch des verarmten Schenkers auf Herausgabe des Geschenks161
5. Kapitel Der Widerruf der Schenkung wegen groben Undanks162 – 166
1. Der Anspruch des Schenkers auf Herausgabe des Geschenks162, 163
2. Die Voraussetzungen des Herausgabeanspruchs164, 165
3. Der Ausschluss des Widerrufs und andere Einwendungen gegen den Herausgabeanspruch166
3. Teil Die Miete
1. Kapitel Das gesetzliche System167 – 169
1. Die gesetzliche Struktur der Miete167
2. Die Mietrechtsreform 2001168, 169
3. Der Gang der Darstellung
2. Kapitel Die Ansprüche aus dem Mietvertrag170 – 175
1. Die Anspruchsgrundlage170
2. Der Anspruch des Mieters auf Gebrauchsgewährung171 – 173
3. Der Anspruch des Vermieters auf den Mietzins174
4. Der Mietvertrag als Anspruchsvoraussetzung175
3. Kapitel Die Mietsache176 – 178
1. Sachen176
2. Wohnräume177
3. Andere Räume178
4. Grundstücke
5. Bewegliche Sachen
6. Die Mischmiete
4. Kapitel Der Mietzins179 – 186
1.1 Die freie Vereinbarung des Mietzinses179
1.2 Die Mietbremse179a
2. Die Entstehung und Fälligkeit des Mietzinsanspruchs180
3. Die Staffel- und die Indexmiete181
4. Die Mieterhöhung182
5. Die Betriebskosten der Mietsache183
6. Die Schönheitsreparaturen184
7. Die Mietkaution185
8. Die Aufrechnung des Wohnungsmieters186
9. Die persönliche Verhinderung des Mieters
5. Kapitel Die Partner des Mietvertrags187 – 194
1. Die freie Wahl des Vermieters und die vertragliche oder gesetzliche Beschränkung187
2. Mehrere Vermieter oder Mieter188
3. Der Mieterwechsel189
4. Der Vermieterwechsel nach gewerblicher Weitervermietung zum Wohnen190
5. Der Vermieterwechsel durch Veräußerung der Mietsache191 – 194
6. Kapitel Die Mietzeit195
1. Das Mietverhältnis auf bestimmte Zeit195
2. Das Mietverhältnis auf unbestimmte Zeit
7. Kapitel Besondere Erscheinungsformen der Miete, Abgrenzung und vertragliche Nebenpflichten196 – 199
1. Sonderformen der Miete196
2. Die Abgrenzung des Mietvertrags von anderen Vertragstypen197
3. Die Miete in Mischverträgen198
4. Mietvertragliche Nebenpflichten199
8. Kapitel Die Haftung des Vermieters für Sach- und Rechtsmängel200 – 216
1. Das gesetzliche System200, 201
2. Die Minderung des Mietzinses202 – 209
3. Der Anspruch des Mieters auf Schadensersatz210, 211
4. Der Anspruch des Mieters auf Ersatz seiner Aufwendungen212
5. Die Konkurrenz der Mängelrechte des Mieters213
6. Die Einwendungen des Vermieters gegen die Mängelrechte des Mieters214 – 216
9. Kapitel Die Ansprüche des Vermieters auf Unterlassung, Duldung und Schadensersatz217 – 221
1. Der Anspruch des Vermieters auf Unterlassung vertragswidrigen Gebrauchs217 – 219
2. Der Anspruch des Vermieters auf Duldung von Erhaltungs- und Verbesserungsmaßnahmen220
3. Der Anspruch des Vermieters auf Schadensersatz wegen unterlassener Mängelanzeige221
10. Kapitel Das Wegnahmerecht des Mieters und sein Anspruch auf „Barrierefreiheit“222 – 224
1. Das Wegnahmerecht des Mieters222, 223
2. Der Anspruch des Wohnungsmieters auf „Barrierefreiheit“224
11. Kapitel Die Untermiete225 – 228
1. Das gesetzliche System225
2. Erlaubte und unerlaubte Untervermietung oder sonstige Gebrauchsüberlassung226
3. Die Erlaubnis des Vermieters zur Untervermietung oder sonstigen Gebrauchsüberlassung227
4. Der Untermieter als Erfüllungsgehilfe des Mieters228
12. Kapitel Das Vermieterpfandrecht229 – 237
1. Ein besitzloses gesetzliches Pfandrecht und seine Rechtsfolgen229, 230
2. Die Voraussetzungen des Vermieterpfandrechts231 – 233
3. Die Einwendungen des Mieters gegen das Vermieterpfandrecht234, 235
4. Das Selbsthilferecht des Vermieters236, 237
13. Kapitel Das Ende des Mietverhältnisses und seine Rechtsfolgen238 – 246
1. Das gesetzliche System238, 239
2. Der Anspruch des Vermieters auf Rückgabe der Mietsache240, 241
3. Der Anspruch des Vermieters auf Nutzungsentschädigung242 – 244
4. Der Anspruch des Mieters auf Rückzahlung vorausbezahlten Mietzinses245
5. Das Ende der Mietzeit246
14. Kapitel Die ordentliche Kündigung des unbefristeten Mietverhältnisses247 – 249
1. Kündigungsrecht und Kündigungserklärung247
2. Die Kündigungsfrist248
3. Die unberechtigte Kündigung249
15. Kapitel Der Schutz des Wohnungsmieters vor der ordentlichen Kündigung250 – 264
1. Das gesetzliche System250
2. Die formale Beschränkung der ordentlichen Kündigung von Wohnraum251
3. Das berechtigte Interesse des Vermieters, die Mietwohnung ordentlich zu kündigen252 – 256
4. Ausnahmen vom Kündigungsschutz257
5. Der Anspruch des Wohnungsmieters auf Fortsetzung des gekündigten Mietverhältnisses258 – 264
16. Kapitel Die fristlose Kündigung des Mietverhältnisses aus wichtigem Grund265 – 281
1. Kündigungsrecht und Kündigungserklärung265 – 268
2. Der wichtige Grund zur fristlosen Kündigung des Mietverhältnisses269, 270
3. Das Vorenthalten und die Entziehung des Mietgebrauchs271, 272
4. Die Gefährdung der Gesundheit des Mieters273
5. Der vertragswidrige Mietgebrauch durch den Mieter274
6. Der Zahlungsverzug des Mieters275 – 277
7. Die Störung des Hausfriedens278
8. Die Konkurrenz der Kündigungsgründe279
9. Der Ersatz des Kündigungsschadens280
10. Die außerordentliche befristete Kündigung des Mietverhältnisses281
17. Kapitel Die Verjährung der Ersatzansprüche aus dem beendeten Mietverhältnis282 – 286
1. Die kurze Verjährungsfrist282
2. Die Verjährung der Ersatzansprüche des Vermieters283 – 285
3. Die Verjährung der Ansprüche des Mieters286
18. Kapitel Wohnungsmiete und Wohnungseigentum287
1. Das gesetzliche Vorkaufsrecht des Wohnungsmieters287
2. Die gesetzliche Konstruktion des Vorkaufsrechts
3. Der Anspruch des Wohnungsmieters auf Schadensersatz
4. Die Beschränkung der ordentlichen Kündigung
5. Die Realteilung
19. Kapitel Das Leasing288 – 298
1. Das Erscheinungsbild des Leasings288, 289
2. Leasing und Miete290
3. Das Leasing als Miete mit kaufrechtlicher Mängelhaftung291, 292
4. Die Abwälzung der Sach- und Preisgefahr auf den Leasingnehmer293
5. Die Vollamortisation des Erwerbsaufwandes des Leasinggebers294
6. Der Kauf als Geschäftsgrundlage des Leasing295, 296
7. Die Haftung für Hilfspersonen im Leasingverhältnis297
8. Das Ende des Leasingverhältnisses298
20. Kapitel Die Pacht299 – 305
1. Das gesetzliche System299
2. Die Ansprüche auf Erfüllung des Pachtvertrags300 – 302
3. Das Pachtinventar303
4. Sonstige Besonderheiten der Pacht304
5. Die Landpacht305
21. Kapitel Die Leihe306
1. Der unentgeltliche Ableger der Miete306
2. Die Anspruchsgrundlage
3. Die beschränkte Haftung des Verleihers
4. Die Haftung des Entleihers
5. Das Ende der Leihe
4. Teil Das Darlehen
1. Kapitel Das gesetzliche System307, 308
1. Die rechtliche Struktur des Darlehens307
2. Die Erscheinungsformen des Darlehens
3. Das Darlehen im System des BGB308
2. Kapitel Die Ansprüche auf Erfüllung des Darlehensvertrags309, 310
1. Der Anspruch des Darlehensnehmers auf Gewährung des Darlehens309
2. Der Anspruch des Darlehensgebers auf die vereinbarten Zinsen310
3. Kapitel Der Anspruch des Darlehensgebers auf Rückzahlung des Darlehens311 – 315
1. Anspruchsgrundlage und Beweislast311
2. Der Darlehensvertrag312
3. Der Empfang des Darlehens313
4. Die Fälligkeit der Rückzahlung des Darlehens314, 315
4. Kapitel Einwendungen des Darlehensnehmers gegen die Rückzahlungs- und Zinszahlungspflicht316
1. Die Nichtigkeit des Darlehensvertrags316
2. Der Einwendungsdurchgriff
3. Der Tilgungseinwand
4. Die Verjährungseinrede
5. Die Einrede der Wechselhingabe
5. Kapitel Leistungsstörungen im Darlehensverhältnis317
1. Das gesetzliche System317
2. Die Aufklärungspflicht des Darlehensgebers
3. Die Beratungspflicht des Darlehensgebers
4. Versuche des Darlehensgebers, Vertragsverletzungen des Darlehensnehmers abzuwehren
6. Kapitel Das Verbraucherdarlehen318 – 326
1. Modernisierung total, aber für wen?318
2. Das gesetzliche System des Verbraucherdarlehens und seiner Ableger319
3. Die Voraussetzungen des Verbraucherdarlehens
4. Schriftform und Inhalt des Darlehensvertrags320
5. Formfehler und ihre Rechtsfolgen
6. Die Informationspflicht des Darlehensgebers321
7. Der Widerruf des Verbrauchers322
8. Die verbundenen Verträge323, 324
9. Sonstige Maßnahmen des Verbraucherschutzes325
10. Das Immobiliar-Verbraucherdarlehen326
11. Der Überziehungskredit
12. Die entgeltliche Finanzierungshilfe
13. Das unabdingbare Verbraucherschutzrecht
14. Existenzgründer
15. Unentgeltliche Darlehen und Finanzierungshilfen
5. Teil Der Dienstvertrag
1. Kapitel Das gesetzliche System327, 328
2. Kapitel Die Ansprüche aus dem Dienstvertrag329 – 334
1. Die Anspruchsgrundlage und ihre Rechtsfolgen329
2. Der Vergütungsanspruch330 – 334
3. Kapitel Der Dienstvertrag als Anspruchsvoraussetzung335 – 343
1. Ein gegenseitiger Verpflichtungsvertrag335, 336
2. Eine Verpflichtung nur zur Tätigkeit, nicht zum Erfolg337
3. Die bunte Vielfalt der Dienstverträge338
4. Die Abgrenzung des Dienstvertrags von anderen Vertragstypen339 – 343
4. Kapitel Leistungsstörungen im Dienstverhältnis344 – 348
1. Allgemeines Schuldrecht344
2. Der Anspruch auf Dienstlohn ohne Dienstleistung345 – 347
3. Die Fürsorgepflicht des Dienstberechtigten348
5. Kapitel Das Ende des Dienstverhältnisses349 – 360
1. Voraussetzungen und Rechtsfolgen349
2. Das Ende des Dienstverhältnisses durch Zeitablauf350
3. Die Beendigung des Dienstverhältnisses durch Kündigung351
4. Die ordentliche befristete Kündigung des Dienstverhältnisses
5. Die fristlose Kündigung des Dienstverhältnisses aus wichtigem Grund352 – 356
6. Die fristlose Kündigung höherer Dienste357
7. Die Vergütung nach fristloser Kündigung358
8. Der Anspruch auf Ersatz des Kündigungsschadens359
9. Der Anspruch des Dienstpflichtigen auf ein Zeugnis360
6. Kapitel Der Anwaltsvertrag361 – 364
1. Ein Dienst- und Geschäftsbesorgungsvertrag361
2. Die Vergütung des Rechtsanwalts362, 363
3. Das Berufsbild des Rechtsanwalts364
7. Kapitel Die Anwaltshaftung365 – 377
1. Die Anspruchsgrundlage365
2. Die Rechtsfolge: Ein Anspruch des Mandanten auf Schadensersatz366
3. Die Voraussetzungen der Anwaltshaftung367
4. Die Pflichtverletzung des Anwalts368 – 370
5. Der Schaden des Mandanten371
6. Die Schadensverursachung durch den Anwaltsfehler372 – 375
7. Einwendungen und Einreden des Anwalts gegen seine Haftung376, 377
8. Kapitel Der Krankenhausaufnahmevertrag378 – 381
1. Drei Varianten378
2. Die Krankenhaushaftung379 – 381
9. Kapitel Der Behandlungsvertrag382 – 395
1. Das gesetzliche System382
2. Die Ansprüche aus dem Behandlungsvertrag383 – 386
3. Die Informationspflicht des Behandlers387 – 389
4. Die Einwilligung des Patienten und die Aufklärungspflicht des Behandlers390 – 392
5. Die Dokumentationspflicht des Behandlers393 – 395
10. Kapitel Die Haftung des Behandlers396 – 421
1. Zwei Anspruchsgrundlagen396
2. Die Rechtsfolge: ein Anspruch auf Schadensersatz397, 398
3. Das Mitverschulden des Patienten399
4. Noch einmal zwei Anspruchsgrundlagen
5. Der Behandlungsfehler als Vertragsverletzung400 – 410
6. Der Behandlungsfehler als unerlaubte Handlung411 – 419
7. Der Behandlungsfehler420
8. Der Gesundheitsschaden und seine Verursachung421
6. Teil Der Werkvertrag
1. Kapitel Das gesetzliche System422, 423
1. Das neue System des Titels 9 im 2. Buch Recht der Schuldverhältnisse des BGB422
2. Das System des Werkvertragsrechts423
2. Kapitel Die Ansprüche aus dem Werkvertrag424 – 444
1. Die Anspruchsgrundlagen424
2. Die Rechtsfolgen des Werkvertrags425 – 427
3. Der Werkvertrag als Anspruchsvoraussetzung428 – 432
4. Der Vergütungsanspruch des Unternehmers433 – 437
5. Die Fälligkeit der Vergütung438 – 444
3. Kapitel Die Haftung des Unternehmers für Mängel seines Werks445 – 448
1. Das gesetzliche System der Mängelhaftung des Unternehmers445 – 447
2. Die Anspruchs- und Rechtsgrundlagen der Mängelrechte und ihre Ausnahmen448
4. Kapitel Der Anspruch des Bestellers auf Nacherfüllung449 – 454
1. Die Anspruchsgrundlage449
2. Die Rechtsfolge des Nacherfüllungsanspruchs
3. Die Voraussetzungen des Nacherfüllungsanspruchs450 – 453
4. Die Verletzung des Nacherfüllungsanspruchs454
5. Das Erlöschen des Nacherfüllungsanspruchs
5. Kapitel Der Anspruch des Bestellers auf Erstattung der Mängelbeseitigungskosten und auf Vorschuss455 – 457
1. Die Erstattung der Mängelbeseitigungskosten455
2. Die Anspruchsvoraussetzungen
3. Der Vorschuss auf die Mängelbeseitigungskosten456
4. Die abschließende gesetzliche Regelung457
6. Kapitel Das Rücktritts- oder Minderungsrecht des Bestellers458, 459
1. Rechtsgrundlage und Rechtsfolge458
2. Die Voraussetzungen des Rücktritts und der Minderung459
7. Kapitel Der Anspruch des Bestellers auf Schadensersatz oder Ersatz seiner vergeblichen Aufwendungen460 – 464
1. Die bunte Vielfalt der Ersatzansprüche460
2. Die Abgrenzung zwischen den verschiedenen Ersatzansprüchen461
3. Der Anspruch des Bestellers auf „einfachen“ Schadensersatz462
4. Der Anspruch des Bestellers auf Schadensersatz statt der Leistung463
5. Der Anspruch des Bestellers auf Ersatz seines Verzögerungsschadens464
6. Der Anspruch des Bestellers auf Ersatz seiner nutzlosen Aufwendungen
8. Kapitel Die Mängeleinrede des Bestellers und seine Aufrechnung465
9. Kapitel Die Haftung für Baumängel am Wohnungseigentum466
1. Das Wohnungseigentum466
2. Mängel des Sondereigentums
3. Mängel des gemeinschaftlichen Eigentums
10. Kapitel Einwendungen und Einreden des Unternehmers gegen die Mängelrechte467 – 480
1. Die vertragliche Beschränkung der Mängelrechte467, 468
2. Die Mangelkenntnis des Bestellers bei der Abnahme469
3. Die Entlastung des Unternehmers
4. Das Mitverschulden des Bestellers470 – 474
5. Der Vorteilsausgleich für „Sowieso-Kosten“475
6. Die Verjährung der Mängelansprüche476 – 480
11. Kapitel Der Mangel des Werks und andere Leistungsstörungen481 – 489
1. Der Vorrang der Mängelrechte481
2. Die Unmöglichkeit der Herstellung und die Vergütungsgefahr482 – 485
3. Sonstige Vertragsverletzungen des Unternehmers486
4. Die vorvertragliche Pflichtverletzung des Unternehmers487
5. Die unerlaubte Handlung des Unternehmers488
6. Der Annahmeverzug des Bestellers489
12. Kapitel Die Sicherungsrechte des Unternehmers490 – 494
1. Das Unternehmerpfandrecht490 – 493
2. Der Anspruch des Inhabers einer Schiffswerft auf eine Sicherungshypothek494
13. Kapitel Das Kündigungsrecht495, 496
1. Die ordentliche Kündigung des Bestellers und der Werklohn495
2. Die fristlose Kündigung aus wichtigem Grund496
14. Kapitel Der Architektenvertrag und der Ingenieurvertrag497 – 505
1. Das Architekten- und Ingenieurwerk497
2. Anwendbare Vorschriften498
3. Das Sonderkündigungsrecht des Bestellers und weitere Sonderregeln
4. Der vereinbarte Umfang der Architektenleistung499
5. Die Architektenvollmacht
6. Das Architektenhonorar500 – 505
15. Kapitel Der Bauvertrag506 – 510
1. Der Vertragsinhalt506
2. Die Erscheinungsformen des Bauvertrags
3. Die Änderung des Bauvertrags und das Anordnungsrecht des Bestellers507
4. Die Sicherungsrechte des Unternehmers508, 509
5. Die Feststellung des Bautenstandes510
6. Die Schriftform der Kündigung
16. Kapitel Der Verbraucherbauvertrag511
17. Kapitel Der Bauträgervertrag512
18. Kapitel Der VOB-Bauvertrag513 – 524
1. Die VOB und andere AGB513
2. Die Vereinbarung der VOB/B514
3. Wer stellt wem die VOB/B?
4. Der Werklohn nach der VOB/B515 – 518
5. Die Bauausführung nach der VOB/B519
6. Die Mängelhaftung des Unternehmers nach der VOB/B520 – 524
19. Kapitel Der Pauschalreisevertrag525 – 544
1. Das gesetzliche System525
2. Die Ansprüche und Verpflichtungen des Pauschalreisevertrags526 – 533
3. Die Haftung des Reiseveranstalters für Reisemängel534 – 541
4. Der Rücktritt vor Reisebeginn542
5. Die Beistandspflicht des Reiseveranstalters
6. Die Insolvenzsicherung543
7. Der Gastschulaufenthalt544
8. Die Reisevermittlung
9. Die Haftung für Buchungsfehler
10. Abweichende Vereinbarungen
7. Teil Der Maklervertrag
1. Kapitel Das gesetzliche System545
1. Erfolgsprovision und Entscheidungsfreiheit des Kunden545
2. Sonderregeln
2. Kapitel Der Anspruch des Maklers auf den Maklerlohn546 – 567
1. Die Anspruchsgrundlage und ihre Rechtsfolge546
2. Die Anspruchsvoraussetzungen
3. Die erste Anspruchsvoraussetzung: ein Maklervertrag547 – 552
4. Die zweite Anspruchsvoraussetzung: eine erfolgreiche Maklertätigkeit553 – 559
5. Einwendungen des Kunden gegen den Provisionsanspruch des Maklers560 – 567
3. Kapitel Besondere Erscheinungsformen des Maklervertrags568 – 572
1. Der Alleinauftrag568
2. Der Maklerdienst- und Maklerwerkvertrag569
3. Die Darlehensvermittlung570
4. Die Heiratsvermittlung571
5. Die Vermittlung von Kaufverträgen über Wohnungen und Einfamilienhäuser572
6. Die Wohnungsvermittlung
8. Teil Auftrag, Geschäftsbesorgungsvertrag und Zahlungsdienste
1. Kapitel Der Auftrag573 – 589
1. Das gesetzliche System573 – 575
2. Der Anspruch des Auftraggebers auf die vereinbarte Geschäftsbesorgung576 – 580
3. Der Anspruch des Auftraggebers auf Auskunft und Rechnungslegung581
4. Der Anspruch des Auftraggebers auf Herausgabe582, 583
5. Der Anspruch des Beauftragten auf Ersatz seiner Aufwendungen584, 585
6. Der Anspruch auf Schadensersatz wegen Verletzung des Auftrags586 – 588
7. Das Ende des Auftrags589
2. Kapitel Der Geschäftsbesorgungsvertrag590, 591
1. Die entgeltliche Besorgung eines fremden Geschäfts590
2. Die Ansprüche aus dem Geschäftsbesorgungsvertrag591
3. Kapitel Der Bankvertrag alias Zahlungsdienstevertrag592 – 612
1. Das alte BGB und der moderne Zeitgeist592
2. Die modernisierte Stoffgliederung593
3. Die modernisierte Begriffswelt des Bankvertragsrechts594
4. Die Rechte und Pflichten der an einem Zahlungsvorgang Beteiligten595 – 601
5. Die Gutschrift602
6. Das Kontokorrent603
7. Die Vergütung der Zahlungsdienstleistung604
8. Die Haftung des Zahlungsdienstleisters605 – 607
9. Die Haftung des Zahlers608
10. Der Haftungsausschluss
11. Das Lastschriftverfahren609
12. Das Scheckinkasso610
13. Der Scheckvertrag611
14. Das Akkreditiv612
4. Kapitel Der Baubetreuungsvertrag613, 614
1. Die rechtliche Konstruktion613
2. Die Abgrenzung
3. Die Haftung des Baubetreuers
4. Die Baugeldsicherung614
5. Die Bauträgerverordnung
5. Kapitel Der Treuhandvertrag615 – 618
1. Die rechtliche Konstruktion615
2. Rechtliches Können und rechtliches Dürfen616
3. Verwaltungs- und Sicherungstreuhand617, 618
6. Kapitel Rat und Empfehlung, Auskunfts- und Beratungsvertrag619 – 622
1. Die Haftung für einen falschen Rat619
2. Der Auskunfts- oder Beratungsvertrag620 – 622
9. Teil Der Verwahrungsvertrag
1. Kapitel Das gesetzliche System623
2. Kapitel Die Ansprüche aus dem Verwahrungsvertrag624 – 628
1. Der Anspruch des Hinterlegers auf Verwahrung624
2. Der Anspruch des Verwahrers auf Vergütung und Aufwendungsersatz625
3. Der Anspruch des Hinterlegers auf Herausgabe626
4. Der Schadensersatzanspruch des Hinterlegers627
5. Der Schadensersatzanspruch des Verwahrers628
10. Teil Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts
1. Kapitel Das gesetzliche System und die Rechtsprechung629 – 643
1. Die Gesellschaft als Schuldverhältnis629
2. Die Gesamthandsgemeinschaft der Gesellschafter630
3. Die Rechts- und Parteifähigkeit der Außengesellschaft
4. Die rechtsfähige Gesamthand – ein moderner Zwitter
5. Innen- und Außengesellschaft631 – 634
6. Erscheinungsformen der BGB-Gesellschaft635 – 643
2. Kapitel Ansprüche des Gesellschafters und Ansprüche der Gesellschaft644 – 647
1. Die Ansprüche auf Erfüllung und auf Abwicklung des Gesellschaftsvertrags644
2. Die Ansprüche auf Schadensersatz wegen Verletzung des Gesellschaftsvertrags645, 646
3. Die Ansprüche der Gesellschaft gegen Dritte647
3. Kapitel Der Anspruch auf Vertragserfüllung durch Leistung des versprochenen Beitrags648 – 656
1. Der Anspruch des Gesellschafters und der Anspruch der Gesellschaft648
2. Die Gesellschafterbeiträge649
3. Der Gesellschaftsvertrag als Anspruchsvoraussetzung650 – 652
4. Die Einwendungen des Gesellschafters gegen die Beitragspflicht653 – 655
5. Die Beitragserhöhung656
4. Kapitel Die Gewinn- und Verlustbeteiligung des Gesellschafters657 – 659
5. Kapitel Die Haftung des Gesellschafters für Gesellschaftsschulden660 – 665
1. Die Gesellschaftsschulden aus Vertrag660, 661
2. Die vertragliche Haftungsbeschränkung662
3. Die Gesellschaftsschulden aus Bereicherung663
4. Die Haftung der Gesellschaft und der Gesellschafter aus unerlaubter Handlung664
5. Der Gesamtschuldnerausgleich665
6. Kapitel Die Organisation der Gesellschaft666 – 677
1. Die rechtliche Struktur der Gesellschaft666
2. Der Gesellschafterbeschluss667 – 669
3. Die Geschäftsführung der Gesellschaft670 – 676
4. Die Vertretung der Gesellschaft677
7. Kapitel Die Mitgliedschaft678 – 681
1. Die Summe der Gesellschafterrechte678
2. Die Übertragbarkeit der Mitgliedschaft679, 680
3. Der Eintritt eines neuen Gesellschafters in die Gesellschaft681
8. Kapitel Das Ende der Gesellschaft682 – 691
1. Der Anspruch des Gesellschafters auf Auseinandersetzung der aufgelösten Gesellschaft und auf Auszahlung seines Auseinandersetzungsguthabens682 – 686
2. Die Auflösung der Gesellschaft687 – 691
9. Kapitel Der Anspruch des ausscheidenden Gesellschafters auf sein Auseinandersetzungsguthaben692 – 700
1. Das Ausscheiden eines Gesellschafters aus der Gesellschaft692 – 697
2. Das Ausscheiden des einen Gesellschafters und die Übernahme des Gesellschaftsvermögens durch den anderen698
3. Der Ausschluss eines Gesellschafters699
4. Das Recht eines Gesellschafters auf Übernahme des Gesellschaftsvermögens700
11. Teil Die Gemeinschaft
1. Kapitel Das gesetzliche System701 – 704
1. Entweder Gesamthands- oder Bruchteilsgemeinschaft701
2. Die Entstehung der Gemeinschaft702
3. Ein gesetzliches Schuldverhältnis703
4. Die Verfügung über den Anteil und über das gemeinschaftliche Recht704
2. Kapitel Nutzung, Kosten und Lasten der Gemeinschaft705, 706
1. Die Nutzung des gemeinschaftlichen Gegenstandes705
2. Die Kosten und Lasten des gemeinschaftlichen Gegenstandes706
3. Kapitel Die Verwaltung des gemeinschaftlichen Gegenstandes707 – 712
1. Das gesetzliche System707
2. Die Verwaltungsvereinbarung708
3. Der Mehrheitsbeschluss709
4. Die gemeinschaftliche Verwaltung710
5. Der Anspruch des Teilhabers auf eine billige Neuregelung711
6. Das Notverwaltungsrecht des Teilhabers712
4. Kapitel Die Aufhebung und Teilung der Gemeinschaft713 – 719
1. Das gesetzliche System713
2. Realteilung oder Versilberung des gemeinschaftlichen Gegenstandes714, 715
3. Die Tilgung der gemeinschaftlichen Schulden716
4. Die Verteilung des Reinerlöses717, 718
5. Die Beschränkung der Aufhebung der Gemeinschaft719
6. Das Ende der Gemeinschaft
12. Teil Die juristischen Personen des BGB: der Verein und die Stiftung
1. Kapitel Die Rechtsfähigkeit720 – 722
1. Natürliche und juristische Person720
2. Die körperschaftliche Organisation721
3. Die Rechtsgrundlagen der juristischen Person722
2. Kapitel Gründung, Ende und Organisation des Vereins723 – 727
1. Die Vereinsgründung723, 724
2. Das Ende des Vereins725
3. Die Vereinsorgane726, 727
3. Kapitel Der Verein im Geschäfts- und Rechtsverkehr728 – 730
1. Die Geschäfts- und Deliktsfähigkeit des Vereins728
2. Die Haftung des Vereins729, 730
4. Kapitel Vereinsmitgliedschaft und Vereinsautonomie731, 732
1. Der Beitritt zum und die Aufnahme in den Verein731
2. Die Vereinsmitgliedschaft
3. Der Ausschluss aus dem Verein und andere Vereinsstrafen732
5. Kapitel Das Vereinsregister733
6. Kapitel Der nichtrechtsfähige Verein734
7. Kapitel Die Stiftung735
13. Teil Die Bürgschaft
1. Kapitel Das gesetzliche System736 – 738
1. Eine schuldrechtliche, forderungsabhängige Sicherheit736
2. Das hohe Risiko des Bürgen
3. Das Dreiecksverhältnis737
4. Anspruchsgrundlagen und Gegennormen738
5. Sonderformen der Bürgschaft
2. Kapitel Der Anspruch des Gläubigers gegen den Bürgen aus der Bürgschaft739 – 763
1. Die Anspruchsgrundlage und ihre Rechtsfolge739
2. Die Anspruchsvoraussetzungen740
3. Die erste Anspruchsvoraussetzung: ein Bürgschaftsvertrag741 – 747
4. Die zweite Anspruchsvoraussetzung: eine verbürgte Hauptschuld748 – 751
5. Einwendungen und Einreden des Bürgen752 – 762
6. Der Schadensersatzanspruch des Bürgen gegen den Gläubiger763
3. Kapitel Der Rückgriff des Bürgen gegen den Hauptschuldner764 – 766
1. Der Anspruch des Bürgen auf Ersatz seiner Aufwendungen764
2. Der gesetzliche Forderungsübergang765
3. Die Voraussetzung des gesetzlichen Forderungsübergangs766
4. Einwendungen und Einreden des Hauptschuldners
4. Kapitel Besondere Erscheinungsformen der Bürgschaft767 – 780
1. Die Bürgschaft auf erstes Anfordern767 – 769
2. Die Ausfallbürgschaft770
3. Die Höchstbetragsbürgschaft771
4. Die Mitbürgschaft772
5. Die Nachbürgschaft773
6. Die Rückbürgschaft774
7. Die Prozessbürgschaft775
8. Die Zeitbürgschaft776 – 778
9. Gesetzliche Bürgschaften779
10. Wechsel- und Scheckbürgschaft780
5. Kapitel Andere schuldrechtliche Sicherheiten781, 782
1. Der Schuldbeitritt781
2. Der Garantievertrag782
14. Teil Der Vergleich
1. Kapitel Das gesetzliche System783 – 788
1. Der Vergleich im Gesetz und im Rechtsleben783
2. Die rechtliche Struktur des Vergleichs
3. Der Vergleich als Anspruchsgrundlage784
4. Die Nichtigkeit des Vergleichs wegen eines gemeinsamen Irrtums über die Vergleichsgrundlage785 – 787
5. Die Geschäftsgrundlage des Vergleichs788
6. Sonstige Nichtigkeitsgründe
2. Kapitel Besondere Erscheinungsformen des Vergleichs789 – 792
1. Der Abfindungsvergleich789
2. Der Prozessvergleich790
3. Der Anwaltsvergleich
4. Der Sanierungsvergleich791
5. Das Teilungsabkommen792
15. Teil Schuldversprechen und Schuldanerkenntnis
1. Kapitel Das gesetzliche System793
1. Selbstständige, abstrakte Verpflichtungen793
2. Das Anerkenntnis im Rechtsleben
2. Kapitel Das selbstständige Schuldversprechen und Schuldanerkenntnis794 – 798
1. Die Anspruchsgrundlage und ihre Rechtsfolge794
2. Die Anspruchsvoraussetzung: ein Vertrag über eine selbstständige Verpflichtung795, 796
3. Die Form des selbstständigen Schuldversprechens oder Schuldanerkenntnisses797
4. Die Einwendungen des Schuldners gegen das selbstständige Schuldversprechen oder Schuldanerkenntnis798
3. Kapitel Das deklaratorische Schuldanerkenntnis799 – 802
1. Ein vertraglicher Einwendungsverzicht799
2. Das deklaratorische Anerkenntnis als Anspruchsgrundlage800
3. Die Voraussetzung eines deklaratorischen Anerkenntnisses801, 802
16. Teil Anweisung und Inhaberschuldverschreibung
1. Kapitel Die Wertpapiere im System des Zivilrechts803 – 806
1. Das verbriefte Recht803
2. Das Namenspapier804
3. Das Inhaberpapier805
4. Das Orderpapier806
2. Kapitel Die Anweisung807 – 812
1. Das gesetzliche Muster für Wechsel und Scheck807
2. Die Anweisung als Doppelermächtigung808
3. Das Valuta- und das Deckungsverhältnis809
4. Form, Widerruf und Übertragung der Anweisung810
5. Die Annahme der Anweisung811, 812
3. Kapitel Die Schuldverschreibung auf den Inhaber813 – 818
1. Der Anspruch aus der Inhaberschuldverschreibung813 – 815
2. Einwendungen des Ausstellers gegen die Inhaberschuldverschreibung816 – 818
4. Kapitel Das Namenspapier mit Inhaberklausel819
5. Kapitel Der Anspruch auf Vorlegung einer Sache und auf Einsicht in eine Urkunde820
17. Teil Auslobung und Gewinnmitteilung, Leibrente, Spiel und Wette
1. Kapitel Die Auslobung821 – 823
1. Ein einseitiges Verpflichtungsgeschäft821
2. Das Preisausschreiben822
3. Die Gewinnmitteilung823
2. Kapitel Die Leibrente824
3. Kapitel Spiel und Wette825, 826
1. Die unvollkommene Verbindlichkeit825
2. Der verbindliche Spielvertrag826
3. Der Spielsperrvertrag
18. Teil Die Geschäftsführung ohne Auftrag
1. Kapitel Das gesetzliche System827 – 830
1. Ein gesetzliches Schuldverhältnis827
2. Die berechtigte Geschäftsführung ohne Auftrag828
3. Die unberechtigte Geschäftsführung ohne Auftrag829
4. Die vermeintliche und die unechte Geschäftsführung ohne Auftrag830
2. Kapitel Die berechtigte Geschäftsführung ohne Auftrag831 – 842
1. Der Anspruch des Geschäftsführers auf Ersatz seiner Aufwendungen831 – 840
2. Die Ansprüche des Geschäftsherrn aus einer auftraglosen Geschäftsführung841, 842
3. Kapitel Die unberechtigte Geschäftsführung ohne Auftrag843, 844
1. Der Anspruch des Geschäftsführers auf Herausgabe der Bereicherung843
2. Der Anspruch des Geschäftsherrn auf Schadensersatz844
4. Kapitel Die vermeintliche und die unechte Geschäftsführung ohne Auftrag845
19. Teil Die ungerechtfertigte Bereicherung
1. Kapitel Das gesetzliche System846 – 849
1. Der Ausgleich rechtsgrundloser Vermögensverschiebungen846
2. Die Anspruchsgrundlagen847
3. Die Gegennormen
4. Die Abgrenzung des Bereicherungsanspruchs von anderen Ausgleichsansprüchen848, 849
2. Kapitel Die ungerechtfertigte Bereicherung durch Leistung (Leistungskondiktion)850 – 865
1. Die Anspruchsgrundlage und ihre Rechtsfolge850 – 852
2. Die Anspruchsvoraussetzungen der Leistungskondiktion und die Beweislast853
3. Die Leistung des Anspruchstellers854 – 856
4. Die Bereicherung des Anspruchsgegners857
5. Die Bereicherung auf Kosten des Anspruchstellers858
6. Die Bereicherung durch eine Leistung ohne rechtlichen Grund859 – 865
3. Kapitel Der Bereicherungsausgleich nach einer Leistung im Dreiecksverhältnis866 – 879
1. Das Problem866
2. Die Leistung durch oder an einen Vertreter867
3. Die Leistung durch Vertrag zugunsten Dritter868 – 870
4. Die Leistung auf Anweisung871 – 875
5. Die Leistung durch Banküberweisung876, 877
6. Die Leistung auf fremde Schuld878
7. Die Leistung nach Abtretung der Forderung879
4. Kapitel Die ungerechtfertigte Bereicherung in sonstiger Weise880 – 889
1. Die Anspruchsgrundlage und ihre Rechtsfolge880, 881
2. Die Voraussetzungen einer Bereicherung „in sonstiger Weise“882 – 889
5. Kapitel Die ungerechtfertigte Bereicherung durch unberechtigte Verfügung über ein fremdes Recht oder durch unberechtigte Annahme einer Leistung890 – 896
1. Das gesetzliche System890
2. Der unberechtigte Eingriff durch entgeltliche Verfügung über ein fremdes Recht891, 892
3. Der unberechtigte Eingriff durch unentgeltliche Verfügung über ein fremdes Recht893, 894
4. Der unberechtigte Eingriff durch schuldbefreiende Annahme einer Leistung895, 896
6. Kapitel Die mittelbare Bereicherung durch unentgeltlichen Erwerb vom Bereicherungsschuldner897
1. Die Anspruchsgrundlage897
2. Die Rechtsfolge
3. Die Anspruchsvoraussetzungen
7. Kapitel Die Einrede der Bereicherung898
8. Kapitel Die Einwendungen und Einreden des Bereicherungsschuldners899 – 920
1. Das gesetzliche System899
2. Die Einwendung der Entreicherung aus § 818 III900 – 909
3. Die Einwendung aus § 814 gegen die Leistungskondiktion wegen einer Nichtschuld910, 911
4. Die Einwendung aus § 815 gegen die Leistungskondiktion wegen Zweckverfehlung912
5. Die Einwendung aus § 817 S. 2 gegen die Leistungskondiktion913 – 917
6. Der Einwand des Rechtsmissbrauchs918
7. Der Einwand der aufgedrängten Bereicherung919
8. Die Verjährungseinrede920
20. Teil Die unerlaubte Handlung
1. Kapitel Das gesetzliche System921 – 927
1. Die Vielfalt der Anspruchsgrundlagen mit und ohne Verschulden921, 922
2. Die unterschiedlichen Haftungssysteme923
3. Die Konkurrenz der Schadensersatzansprüche924, 925
4. Die Anspruchsgrundlagen des Rechts der unerlaubten Handlung926
5. Die Einwendungen und Einreden des Rechts der unerlaubten Handlung927
6. Der Gang der Darstellung
2. Kapitel Die Rechtsfolge der unerlaubten Handlung: ein Anspruch auf Schadensersatz928 – 938
1. Art und Umfang des Schadensersatzes928
2. Der Ersatz des Verdienstausfalls929, 930
3. Die Schadensrente für Mehrbedarf und Verdienstausfall931, 932
4. Das Schmerzensgeld933 – 936
5. Der Schadensersatz wegen der Entziehung oder Beschädigung einer Sache937
6. Schadensersatz, Beseitigung vorhandener und Unterlassung künftiger Störungen938
3. Kapitel Gläubiger und Schuldner des gesetzlichen Schadensersatzanspruchs939 – 951
1. Der Ersatzberechtigte939 – 944
2. Der Schadensersatzschuldner945 – 951
4. Kapitel Der Grundtatbestand des § 823 I: die Verletzung eines absoluten Rechts oder Rechtsguts952 – 1003
1. Anspruchsvoraussetzungen und Beweislast952
2. Die Rechtsgutsverletzung953 – 967
3. Die Verletzungshandlung968
4. Das pflichtwidrige Unterlassen969 – 985
5. Die Schadensverursachung durch die Verletzungshandlung986
6. Die Rechtswidrigkeit der Rechtsgutsverletzung987 – 997
7. Das Verschulden des Verletzers998 – 1003
5. Kapitel Das Namensrecht1004 – 1010
1. Das gesetzliche System1004, 1005
2. Der Anspruch des Namensträgers auf Beseitigung der Namensstörung1006 – 1009
3. Der Anspruch auf Unterlassung weiterer Namensstörungen1010
6. Kapitel Das allgemeine Persönlichkeitsrecht1011 – 1025
1. Ein Rahmenrecht ohne scharfe Konturen1011
2. Die Rechtsgrundlage des allgemeinen Persönlichkeitsrechts1012
3. Die Abwehransprüche1013, 1014
4. Der Anspruch auf Schadensersatz1015, 1016
5. Die rechtswidrige Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts1017, 1018
6. Die Menschenwürde1019
7. Das Recht auf ein ungestörtes Intimleben1020
8. Das Recht auf ein ungestörtes Privatleben1021
9. Das Privatleben Prominenter1022
10. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung1023
11. Das Recht am eigenen Wort1024
12. Das Recht am eigenen Bild1025
7. Kapitel Der zivilrechtliche Schutz der Ehre1026 – 1034
1. Das gesetzliche System1026
2. Der Anspruch auf Schadensersatz1027 – 1030
3. Der Anspruch auf Beseitigung der Störung und auf Widerruf1031, 1032
4. Der Anspruch auf Unterlassung weiterer Ehrverletzungen1033
5. Der Anspruch auf Gegendarstellung1034
8. Kapitel Das allgemeine Persönlichkeitsrecht und das Recht auf freie Meinungsäußerung1035 – 1044
1. Der Widerstreit zweier Grundrechte1035
2. Die Kriterien der Abwägung1036
3. Tatsachenbehauptungen und Werturteile1037 – 1039
4. Die Freiheit der Rede im öffentlichen Meinungskampf1040 – 1042
5. Die Schmähkritik1043
6. Die Freiheit von Kunst und Wissenschaft1044
9. Kapitel Das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb1045 – 1052
1. Die Anspruchsgrundlage für Schadensersatz1045
2. Ein Rahmenrecht und Auffangtatbestand1046
3. Das Unternehmen1047
4. Der unmittelbare Eingriff in das Unternehmen1048 – 1052
5. Die Abwehransprüche
10. Kapitel Der Grundtatbestand des § 823 II: die Verletzung eines Schutzgesetzes1053 – 1055
1. Die Anspruchsvoraussetzungen1053
2. Das Schutzgesetz1054
3. Das Verschulden1055
11. Kapitel Der Grundtatbestand des § 826: die vorsätzlich sittenwidrige Schädigung1056 – 1060
1. Der Schutzumfang des § 8261056, 1057
2. Die sittenwidrige Schädigung1058
3. Der Schädigungsvorsatz1059
4. Typische Fälle einer vorsätzlich sittenwidrigen Schädigung1060
12. Kapitel Die Kreditgefährdung1061
1. Die Anspruchsgrundlage und ihre Rechtsfolge1061
2. Die Anspruchsvoraussetzungen
13. Kapitel Die Bestimmung zu sexuellen Handlungen1062
14. Kapitel Die Haftung des Geschäftsherrn für Verrichtungsgehilfen1063 – 1069
1. Die Haftung für vermutetes Auswahl- und Überwachungsverschulden1063
2. Die Anspruchsgrundlage und ihre Rechtsfolge1064
3. Die Anspruchsvoraussetzungen1065 – 1068
4. Der Einwand der Entlastung1069
15. Kapitel Die Haftung für die Verletzung einer Aufsichtspflicht1070 – 1075
1. Die Haftung für vermutetes Aufsichtsverschulden1070
2. Die Anspruchsgrundlage und ihre Rechtsfolge1071
3. Die Anspruchsvoraussetzungen1072, 1073
4. Der Einwand der Entlastung1074
5. Typische Fälle einer Verletzung der Aufsichtspflicht1075
16. Kapitel Die Haftung des Tierhalters1076 – 1082
1. Das gesetzliche System1076
2. Die Anspruchsgrundlage und ihre Rechtsfolge1077
3. Die Anspruchsvoraussetzungen1078, 1079
4. Die Entlastung für ein Nutz-Haustier1080
5. Der Tierhüter1081
6. Der vertragliche Haftungsausschluss und die Selbstgefährdung1082
17. Kapitel Die Haftung für den Einsturz eines Gebäudes1083 – 1087
1. Die Haftung für vermutetes Verschulden1083
2. Die Anspruchsgrundlage und ihre Voraussetzungen1084, 1085
3. Anspruchsberechtigter und Anspruchsgegner1086
4. Der Einwand der Entlastung1087
18. Kapitel Die Amtshaftung1088 – 1122
1. Staatshaftung statt Beamtenhaftung1088
2. Die Konkurrenz der Amtshaftung mit anderen Schadensersatzansprüchen1089
3. Die Rechtsfolge der Amtshaftung1090, 1091
4. Das System der Amtshaftung und die Beweislast1092
5. Gläubiger und Schuldner des Schadensersatzanspruchs1093 – 1096
6. Die Staatshaftung nur für hoheitliche Verwaltungstätigkeiten1097, 1098
7. Die Verletzung einer Amtspflicht gegenüber einem Dritten1099 – 1110
8. Der Schaden und seine Verursachung1111
9. Das Verschulden des Beamten1112
10. Das Fehlen einer anderen Ersatzmöglichkeit1113 – 1117
11. Das „Spruchrichterprivileg“1118
12. Der Ausschluss der Amtshaftung durch Versäumung von Rechtsmitteln1119
13. Die Entschädigung für überlange Verfahrensdauer1120
14. Die Notarhaftung1121
15. Die Haftung des gerichtlichen Sachverständigen und des Zeugen1122
19. Kapitel Die Verjährung der Ansprüche aus unerlaubter Handlung1123 – 1129
1. Regelverjährung statt Sonderregel1123
2. Der Beginn der Regelverjährung1124 – 1127
3. Der Anspruch auf Herausgabe der Bereicherung trotz Verjährung1128
4. Die Einrede der unerlaubten Handlung1129
20. Kapitel Die Produkthaftung1130 – 1134
1. Unerlaubte Handlung oder Gefährdungshaftung1130
2. Die Abgrenzung1131
3. Die Gefährdungshaftung nach dem ProdHaftG1132, 1133
4. Der gesetzliche Haftungsausschluss1134
5. Das Mitverschulden des Geschädigten
6. Verjährung und Ausschlussfrist
21. Kapitel Die Halter- und Fahrerhaftung nach dem Straßenverkehrsgesetz1135 – 1155
1. Das gesetzliche System1135 – 1137
2. Die Halterhaftung: Rechtsfolgen und Voraussetzungen1138 – 1143
3. Der Ausschluss der Halterhaftung1144 – 1146
4. Das Mitverschulden des Geschädigten1147
5. Die mitwirkende Betriebsgefahr des anderen unfallbeteiligten Kraftfahrzeugs1148 – 1152
6. Die Schwarzfahrt1153
7. Sonstige Einwendungen gegen die Halterhaftung1154
8. Die Fahrerhaftung1155
22. Kapitel Die Haftung des Gastwirts für eingebrachte Sachen1156 – 1158
1. Der Anspruch des Gastes auf Schadensersatz1156, 1157
2. Der Haftungsausschluss1158
2. Buch Schuldrecht Allgemeiner Teil oder: Das Schuldverhältnis
21. Teil Das gesetzliche System des Schuldrechts
1. Kapitel Allgemeines und besonderes Schuldrecht1159
2. Kapitel Das Schuldverhältnis als Programm des gesamten Schuldrechts1160 – 1166
1. Der Gegenstand des Schuldverhältnisses1160
2. Die Rechtsfolge des Schuldverhältnisses1161
3. Die Voraussetzungen des Schuldverhältnisses1162
4. Das Schuldverhältnis im engeren und im weiteren Sinn1163
5. Schuldverhältnisse außerhalb des Schuldrechts1164
6. Die Relativität des Schuldverhältnisses1165
7. Schuld und Haftung1166
8. Kein Schuldverhältnis durch unbestellte Leistung
3. Kapitel Die schuldrechtliche Leistung1167 – 1170
1. Das gesetzliche System1167
2. Der Gegenstand der Leistung im Prozess und in der Zwangsvollstreckung1168
3. Die Leistungshandlung und der Leistungserfolg1169, 1170
22. Teil Treu und Glauben
1. Kapitel Ein fundamentaler Rechtsgrundsatz1171 – 1175
1. Der Geltungsbereich1171
2. Die Grundwerte der Verfassung als Maßstab1172, 1173
3. Das Gebot von Treu und Glauben als vielschichtige Generalklausel1174, 1175
2. Kapitel Die Rechtsfolgen von Treu und Glauben1176 – 1188
1. Anspruch oder Einwendung1176
2. Die Ansprüche aus Treu und Glauben1177, 1178
3. Die gebotene Rücksicht auf den anderen1179
4. Die fristlose Kündigung des Dauerschuldverhältnisses1180 – 1188
3. Kapitel Die unzulässige Rechtsausübung und der Rechtsmissbrauch1189 – 1205
1. Die Rechtsfolge1189 – 1191
2. Der unredliche Rechtserwerb1192
3. Die unredliche Verhinderung fremden Rechtserwerbs1193
4. Das widersprüchliche Verhalten1194 – 1196
5. Die Verpflichtung zur sofortigen Rückgabe der geforderten Leistung1197
6. Das fehlende Eigeninteresse des Berechtigten1198
7. Unzumutbarkeit und Übermaßverbot1199 – 1201
8. Der Einwendungsdurchgriff1202
9. Die Durchgriffshaftung1203
10. Die Inhaltskontrolle von Verträgen nach Treu und Glauben1204
11. Das nachbarrechtliche Gemeinschaftsverhältnis1205
4. Kapitel Die Störung der Geschäftsgrundlage1206 – 1222
1. Die Risikoverteilung zwischen Vertragspartnern1206
2. Geschäftsgrundlage und Geschäftsinhalt1207 – 1210
3. Die Vertragstreue und ihre Ausnahmen1211
4. Die Rechtsfolgen einer Störung der Geschäftsgrundlage1212 – 1215
5. Wann ist die vertragliche Geschäftsgrundlage gestört?1216 – 1222
5. Kapitel Die Verwirkung1223 – 1226
1. Ein außerordentlicher Rechtsbehelf1223, 1224
2. Die Rechtsfolge der Verwirkung1225
3. Die Voraussetzungen der Verwirkung1226
23. Teil Der Gegenstand der Leistung
1. Kapitel Die Gattungsschuld1227 – 1231
1. Das gesetzliche System1227
2. Die Vereinbarung1228
3. Die Rechtsfolgen der Gattungsschuld1229 – 1231
2. Kapitel Die Geldschuld1232 – 1246
1. Das gesetzliche System1232
2. Das Geld1233 – 1235
3. Geldsummen- und Geldwertschuld1236, 1237
4. Das Nominalprinzip1238
5. Die Wertsicherung der Geldschuld1239 – 1242
6. Die Fremdwährungsschuld1243
7. Die Zinsschuld1244 – 1246
3. Kapitel Die Schuldbefreiung1247, 1248
1. Der geschuldete Erfolg1247
2. Die Anspruchsgrundlage1248
3. Die Abtretung des Schuldbefreiungsanspruchs
4. Die Verjährung der Schuldbefreiungsanspruchs
4. Kapitel Auskunft, Rechenschaft, Bestandsverzeichnis und eidesstattliche Versicherung1249 – 1254
1. Hilfsansprüche auf Mitteilung von Tatsachen1249
2. Die Auskunft1250
3. Die Rechenschaft1251
4. Das Bestandsverzeichnis1252
5. Die eidesstattliche Versicherung1253
6. Die Erfüllung der Auskunftspflicht1254
5. Kapitel Wahlschuld und Ersetzungsbefugnis1255
1. Die Wahlschuld1255
2. Die Ersetzungsbefugnis
24. Teil Der Schadensersatz
1. Kapitel Das Ob und das Wie des Schadensersatzes1256 – 1258
1. Das gesetzliche System1256
2. Der vereinbarte Schadensersatz1257
3. Individueller und sozialer Schadensausgleich1258
4. Der Gang der Darstellung
2. Kapitel Der anspruchsberechtigte Geschädigte1259 – 1265
1. Unmittelbar und mittelbar Geschädigter1259
2. Die Drittschadensliquidation1260 – 1265
3. Kapitel Das System der gesetzlichen Schadensabwicklung1266, 1267
1. Herstellung und Wertersatz, entgangener Gewinn und Mitverschulden1266
2. Die besonderen Probleme des Schadensersatzrechts1267
4. Kapitel Der Schaden1268 – 1283
1. Mittelbarer und unmittelbarer Schaden1268
2. Vermögens- und Nichtvermögensschaden1269
3. Nichterfüllungs- und Vertrauensschaden1270 – 1273
4. Differenzschaden und normativer Schaden1274 – 1278
5. Die Art und Weise der Schadensberechnung1279 – 1281
6. Der Schadensnachweis1282
7. Der Zeitpunkt der Schadensberechnung1283
5. Kapitel Die Verursachung eines Schadens1284 – 1294
1. Das ungeschriebene gesetzliche System1284
2. Haftungsbegründende und haftungsausfüllende Kausalität1285, 1286
3. Conditio sine qua non und Äquivalenz1287 – 1294
6. Kapitel Die rechtliche Zurechnung eines Schadens1295 – 1309
1. Die Adäquanz als Korrektiv einer uferlosen Kausalität1295 – 1298
2. Der Schutzzweck der verletzten Vertrags- oder Rechtsnorm1299 – 1304
3. Die hypothetische Schadensursache1305 – 1308
4. Das rechtmäßige Alternativverhalten1309
7. Kapitel Der Vorteilsausgleich1310 – 1324
1. Die Vor- und Nachteile einer Schädigung1310, 1311
2. Die Voraussetzungen des Vorteilsausgleichs1312
3. Die Schadensminderung durch den Geschädigten1313, 1314
4. Die Freigebigkeit Dritter1315
5. Die Lohn- oder Gehaltsfortzahlung1316
6. Die Versicherungsleistung1317
7. Die Unterhaltsleistung Dritter1318
8. Der vorzeitige Anfall einer Erbschaft1319
9. Ersparte Aufwendungen des Geschädigten1320, 1321
10. Der Steuervorteil1322
11. Die Wertsteigerung durch Schadensersatz1323, 1324
8. Kapitel Die Art und Weise der Schadensersatzleistung1325 – 1349
1. Die Herstellung eines schadensfreien Zustands1325
2. Der Ersatz der „erforderlichen“ Herstellungskosten1326 – 1342
3. Der Anspruch auf Wertersatz1343 – 1345
4. Der Gewinn- oder Verdienstausfall1346 – 1349
9. Kapitel Das Mitverschulden des Geschädigten1350 – 1375
1. Das gesetzliche System1350 – 1354
2. Die Rechtsfolge des Mitverschuldens1355 – 1359
3. Das Mitverschulden des Geschädigten an der Entstehung des Schadens1360 – 1365
4. Das Mitverschulden durch Unterlassen einer Schadensminderung1366, 1367
5. Das Mitverschulden der Hilfspersonen des Geschädigten1368 – 1371
6. Das Handeln auf eigene Gefahr1372 – 1375
25. Teil Art und Weise, Ort und Zeit der Leistung
1. Kapitel Die Leistung durch Dritte und an Dritte1376 – 1380
1. Die Leistung eines Dritten1376 – 1379
2. Die Leistung des Schuldners an einen Dritten
3. Das Ablösungsrecht des Dritten1380
2. Kapitel Die Teilleistung1381, 1382
1. Die gesetzliche Regel1381
2. Die vertraglichen und gesetzlichen Ausnahmen
3. Teilbare und unteilbare Leistungen1382
3. Kapitel Der Leistungsort1383 – 1393
1. Der Ort der Leistungshandlung1383, 1384
2. Hol-, Bring- und Schickschulden1385, 1386
3. Der Maßstab im Einzelfall1387 – 1389
4. Einheitlicher oder gespaltener Leistungsort für Ansprüche aus dem Vertrag1390
5. Der Zahlungsort1391 – 1393
4. Kapitel Die Leistungszeit1394 – 1399
1. Die Fälligkeit und die Erfüllbarkeit der Leistungspflicht1394, 1395
2. Vereinbarte und gesetzliche Leistungszeit1396
3. Die Stundung und ähnliche Abreden1397, 1398
4. Die Fälligkeit nach den Umständen1399
5. Die Fälligkeit der Geldforderung und die Rechnung
6. Die Vereinbarung der Fälligkeit einer Entgeltforderung
5. Kapitel Das Zurückbehaltungsrecht1400 – 1409
1. Ein Gegenrecht des Schuldners1400, 1401
2. Das gesetzliche System1402
3. Die Rechtsfolge der berechtigten Leistungsverweigerung1403, 1404
4. Die Voraussetzungen des Zurückbehaltungsrechts1405 – 1407
5. Die Einwendungen des Gläubigers gegen das Zurückbehaltungsrecht des Schuldners1408
6. Der Anspruch auf Verwendungsersatz gegen den Herausgabeanspruch1409
26. Teil Das Vertragsschuldverhältnis
1. Kapitel Der Vertrag und das Gesetz1410 – 1416
1. Das gesetzliche System1410
2. Der Verpflichtungsvertrag und das gesetzliche Schuldrecht1411, 1412
3. Das gesetzliche Leitbild für Allgemeine Geschäftsbedingungen1413
4. Änderung, Ersetzung und Aufhebung eines Schuldverhältnisses1414 – 1416
2. Kapitel Der Verpflichtungsvertrag1417 – 1425
1. Die Vereinbarung einer Verpflichtung1417
2. Der einseitig, mehrseitig oder gegenseitig verpflichtende Vertrag1418
3. Die kausale und die abstrakte Verpflichtung1419
4. Typische und atypische Verpflichtungsverträge1420 – 1423
5. Die Form des Verpflichtungsvertrags1424, 1425
3. Kapitel Der Formzwang für die vertragliche Verpflichtung zur Veräußerung oder zum Erwerb eines Grundstücks1426 – 1441
1. Der Zweck der notariellen Beurkundung1426
2. Der Formfehler und seine Rechtsfolge1427 – 1430
3. Die vertragliche Verpflichtung zur Veräußerung oder zum Erwerb eines Grundstücks1431, 1432
4. Die unmittelbare vertragliche Verpflichtung zur Veräußerung oder zum Erwerb eines Grundstücks1433, 1434
5. Die mittelbare und die bedingte vertragliche Verpflichtung zur Veräußerung oder zum Erwerb eines Grundstücks1435
6. Die Beurkundung des ganzen Verpflichtungsvertrags1436
7. Die Beurkundung mehrer zusammengehöriger Verträge1437
8. Die Änderung oder Aufhebung der vertraglichen Verpflichtung zur Veräußerung oder zum Erwerb eines Grundstücks1438
9. Die Heilung des Formmangels1439 – 1441
4. Kapitel Die Nichtigkeitsgründe des allgemeinen Schuldrechts1442, 1443
1. Die vertragliche Verpflichtung zur Übertragung des künftigen Vermögens1442
2. Der Verpflichtungsvertrag über den Nachlass eines lebenden Dritten1443
5. Kapitel Die nachträgliche Bestimmung der Leistung1444 – 1453
1. Das gesetzliche System1444
2. Die nachträgliche Bestimmung der Leistung durch eine Partei1445 – 1447
3. Die nachträgliche Bestimmung der Leistung durch einen Dritten1448 – 1451
4. Das Schiedsgutachten1452, 1453
6. Kapitel Der Vorvertrag1454 – 1457
1. Eine gesetzlich nicht geregelte Rechtsfigur des allgemeinen Schuldrechts1454
2. Die Rechtsfolge des Vorvertrags1455
3. Die Voraussetzungen des Vorvertrags1456
4. Ähnliche rechtliche Konstruktionen1457
7. Kapitel Der Vertrag zugunsten Dritter1458 – 1471
1. Eine gesetzliche Rechtsfigur des allgemeinen Schuldrechts1458
2. Die Dreiecksbeziehung zwischen den Vertragspartnern und dem Dritten1459
3. Die Rechtsfolge des Vertrags zugunsten Dritter1460
4. Die Voraussetzungen des Vertrags zugunsten Dritter1461 – 1468
5. Einwendungen des Versprechenden gegen den Anspruch des Dritten1469
6. Der Rechtsgrund der Zuwendung an den Dritten1470
7. Der Anspruch des Versprechensempfängers1471
8. Kapitel Der Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte1472 – 1480
1. Eine gesetzlich nicht geregelte Rechtsfigur des allgemeinen Schuldrechts1472
2. Die Rechtsfolge der vertraglichen Schutzwirkung für Dritte1473
3. Die Voraussetzungen des Schadensersatzanspruchs des Dritten1474 – 1478
4. Die Einwendungen des Schuldners1479
5. Die Verjährungseinrede des schutzbedürftigen Dritten1480
9. Kapitel Die Vertragsstrafe1481 – 1499
1. Das gesetzliche System1481
2. Die Rechtsfolge der vereinbarten Vertragsstrafe1482 – 1484
3. Die Voraussetzungen des Anspruchs auf die Vertragsstrafe1485 – 1494
4. Einwendungen des Schuldners gegen die Vertragsstrafe1495 – 1499
10. Kapitel Der Rücktritt vom Vertrag1500 – 1520
1. Das gesetzliche System1500
2. Der Rücktritt als Einwendung gegen Vertragsansprüche1501, 1502
3. Der Anspruch auf Rückgewähr der Leistung oder auf Wertersatz1503 – 1510
4. Einwendungen gegen den Rückgewähranspruch nach Rücktritt1511 – 1513
5. Einwendungen gegen den Anspruch auf Wertersatz nach Rücktritt1514 – 1517
6. Die Haftung des Vertragspartners nach Rücktritt vom Vertrag1518 – 1520
27. Teil Das Erlöschen des Schuldverhältnisses
1. Kapitel Das gesetzliche System1521
1. Die Erlöschensgründe1521
2. Die Beweislast für das Erlöschen des Schuldverhältnisses1521
2. Kapitel Die Erfüllung1522 – 1546
1. Der Leistungserfolg1522
2. Die Rechtsfolge der Erfüllung1523
3. Die Voraussetzung der Erfüllung1524 – 1532
4. Die Leistung an Erfüllungs Statt1533 – 1537
5. Die Leistung erfüllungshalber1538 – 1541
6. Die unzureichende Leistung auf mehrere Verpflichtungen1542, 1543
7. Die Leistung auf das Darlehen oder auf die Grundschuld?1544
8. Der Anspruch des Schuldners auf eine Quittung1545
9. Der Anspruch des Schuldners auf Rückgabe des Schuldscheins1546
3. Kapitel Die Hinterlegung1547 – 1557
1. Das gesetzliche System1547
2. Die anspruchsvernichtende Einwendung der Hinterlegung1548 – 1552
3. Die anspruchshemmende Einrede der Hinterlegung1553
4. Der Anspruch des Gläubigers auf die hinterlegte Sache oder Geldsumme1554 – 1556
5. Der Selbsthilfeverkauf1557
4. Kapitel Die Aufrechnung1558 – 1582
1. Eine Rechtsgestaltung mit doppelter Wirkung1558
2. Das gesetzliche System1559
3. Die Rechtsfolge der Aufrechnung1560
4. Die Voraussetzungen der Aufrechnung1561 – 1570
5. Die Aufrechnung im Prozess1571 – 1574
6. Die Aufrechnungshindernisse1575 – 1581
7. Der Aufrechnungsvertrag1582
5. Kapitel Der Schulderlass1583 – 1586
1. Eine schuldrechtliche Verfügung über die Forderung1583
2. Der Erlassvertrag1584
3. Das negative Schuldanerkenntnis1585
4. Die Skontoabrede1586
28. Teil Die Verletzung einer schuldrechtlichen Pflicht und ihre Rechtsfolgen
1. Kapitel Erfüllung und Nichterfüllung einer schuldrechtlichen Pflicht1587 – 1591
1. Der gesetzliche Normalfall1587
2. Die abnormalen Störfälle1588
3. Das alte BGB und die Schuldrechtsmodernisierung1589, 1590
4. Der Gang der Darstellung1591
2. Kapitel Das alte System der Leistungsstörungen1592 – 1599
1. Eine bunte Vielfalt1592
2. Die Unmöglichkeit der Leistung nach altem Recht1593, 1594
3. Der Schuldnerverzug nach altem Recht1595, 1596
4. Die positive Forderungsverletzung nach altem ungeschriebenem Recht1597, 1598
5. Das Verschulden bei Vertragsverhandlungen nach altem ungeschriebenem Recht1599
3. Kapitel Das neue System der Verletzung einer schuldrechtlichen Pflicht1600 – 1606
1. Die Schuldrechtsmodernisierung1600
2. Die neue Einheit statt der alten Vielfalt1601, 1602
3. Die Unmöglichkeit der Leistung nach neuem Recht1603
4. Der Schuldnerverzug nach neuem Recht1604
5. Die positive Forderungsverletzung nach neuem Recht1605
6. Das Verschulden bei Vertragsverhandlungen nach neuem Recht1606
4. Kapitel Der Anspruch auf Schadensersatz wegen Verletzung einer schuldrechtlichen Pflicht1607 – 1611
1. Ein Grundtatbestand und mehrere spezielle Tatbestände1607
2. Keine Verschuldenshaftung, sondern Haftung für vermutetes Verschulden1608
3. Die Abgrenzung der unterschiedlichen Ansprüche auf Schadensersatz1609
4. Die Anspruchsgrundlagen und Gegennormen1610
5. Die Gläubigerrechte nach einer Pflichtverletzung des Schuldners1611
5. Kapitel Der Anspruch des Gläubigers auf „einfachen“ Schadensersatz1612 – 1614
1. Die Anspruchsgrundlage1612
2. Die Rechtsfolge
3. Die Voraussetzungen des Anspruchs auf einfachen Schadensersatz1613
4. Die Entlastung des Schuldners1614
6. Kapitel Der Anspruch des Gläubigers auf Schadensersatz statt der Leistung1615 – 1626
1. Die Anspruchsgrundlagen1615
2. Die Rechtsfolge1616 – 1619
3. Die Voraussetzungen des Anspruchs auf Schadensersatz statt der Leistung1620 – 1625
4. Der Ausschluss des Schadensersatzes statt der Leistung1626
7. Kapitel Der Anspruch des Gläubigers auf Ersatz des Verzögerungsschadens1627 – 1631
1. Die Anspruchsgrundlage1627
2. Die Rechtsfolge1628, 1629
3. Die Voraussetzungen des Anspruchs auf Ersatz des Verzögerungsschadens1630
4. Der Ausschluss des Anspruchs auf Ersatz des Verzögerungsschadens1631
8. Kapitel Der Anspruch des Gläubigers auf Ersatz seiner Aufwendungen1632
1. Die Anspruchsgrundlage und ihre Rechtsfolge1632
2. Die Anspruchsvoraussetzungen
3. Der Ausschluss des Anspruchs auf Ersatz der Aufwendungen
9. Kapitel Der Anspruch des Gläubigers auf Ersatzherausgabe1633
1. Die Anspruchsgrundlage und ihre Rechtsfolge1633
2. Die Anspruchsvoraussetzungen
10. Kapitel Das gesetzliche Recht des Gläubigers, vom gegenseitigen Vertrag zurückzutreten1634 – 1640
1. Die Rechtsgrundlage1634
2. Die Rechtsfolge
3. Der Rücktritt wegen Verletzung einer vertraglichen Leistungspflicht1635 – 1638
4. Der Rücktritt wegen Verletzung einer vertraglichen Pflicht zur Rücksicht1639
5. Der Rücktritt wegen Unmöglichkeit der Leistung1640
11. Kapitel Der Schuldnerverzug1641 – 1654
1. Die unberechtigte Leistungsverzögerung1641
2. Die Rechtsfolgen des Schuldnerverzugs1642 – 1644
3. Die Voraussetzungen des Schuldnerverzugs1645 – 1650
4. Der Ausschluss des Schuldnerverzugs1651 – 1654
12. Kapitel Die Unmöglichkeit der Leistung1655 – 1668
1. Das gesetzliche System1655, 1656
2. Die Rechtsfolgen der Unmöglichkeit1657
3. Die Befreiung des Schuldners von der unerfüllbaren Leistungspflicht1658 – 1660
4. Das Leistungsverweigerungsrecht des Schuldners1661 – 1663
5. Die Unmöglichkeit der Leistung im gegenseitigen Vertrag1664 – 1668
13. Kapitel Die Verletzung der schuldrechtlich gebotenen Rücksicht (vormals die positive Forderungsverletzung)1669 – 1689
1. Das gesetzliche System1669, 1670
2. Der Anspruch auf Schadensersatz wegen Verletzung der schuldrechtlich gebotenen Rücksicht1671
3. Die Anspruchsvoraussetzungen und die Beweislast1672 – 1675
4. Das Rücktrittsrecht des Gläubigers1676
5. Die schuldrechtliche Pflicht zur Rücksicht1677 – 1687
6. Die Entlastung des Schuldners1688, 1689
7. Die Verjährung
14. Kapitel Die Verletzung der vorvertraglich gebotenen Rücksicht (vormals das Verschulden bei Vertragsverhandlungen)1690 – 1709
1. Das gesetzliche System1690, 1691
2. Der Anspruch auf Schadensersatz wegen Verletzung einer vorvertraglichen Pflicht zur Rücksicht1692
3. Die Rechtsfolge: ein Anspruch auf Schadensersatz1693 – 1696
4. Das vorvertragliche Schuldverhältnis1697, 1698
5. Die Verletzung einer vorvertraglichen Pflicht zur Rücksicht1699 – 1703
6. Der Schuldner des Schadensersatzes1704 – 1707
7. Einwendungen des Schuldners gegen den Schadensersatzanspruch1708, 1709
15. Kapitel Was der Schuldner zu vertreten hat1710 – 1731
1. Das gesetzliche System1710
2. Das Verschulden des Schuldners1711
3. Der Vorsatz des Schuldners1712, 1713
4. Die Fahrlässigkeit des Schuldners1714 – 1719
5. Die Schuldunfähigkeit des Schuldners1720
6. Der vertragliche Haftungsausschluss1721
7. Das Verschulden der Hilfspersonen des Schuldners1722 – 1726
8. Das Beschaffungsrisiko des Schuldners1727, 1728
9. Die Zahlungsunfähigkeit des Schuldners1729
10. Die Haftungsverschärfung durch Verzug des Schuldners1730
11. Die verschärfte Haftung des Herausgabeschuldners ab Rechtshängigkeit1731
16. Kapitel Die Einrede des nicht erfüllten gegenseitigen Vertrags1732 – 1743
1. Das System des gegenseitigen Vertrags1732
2. Die Rechtsfolge der Einrede des nicht erfüllten gegenseitigen Vertrags1733, 1734
3. Die Voraussetzungen der Einrede des nicht erfüllten gegenseitigen Vertrags1735, 1736
4. Die Einwendungen gegen die Einrede des nicht erfüllten gegenseitigen Vertrags1737 – 1742
5. Das Zurückbehaltungsrecht trotz Vorleistungspflicht des Schuldners1743
6. Der gegenseitige Vertrag in der Insolvenz des Schuldners
17. Kapitel Der Annahmeverzug des Gläubigers1744 – 1749
1. Die Verletzung einer Obliegenheit1744
2. Die Rechtsfolgen des Annahmeverzugs1745
3. Die Voraussetzungen des Annahmeverzugs1746 – 1748
4. Das Unvermögen des Schuldners1749
29. Teil Die Abtretung der Forderung
1. Kapitel Das gesetzliche System1750, 1751
1. Die Abtretung als Anspruchsgrundlage und Anspruchsverlust1750
2. Der Schuldnerschutz
3. Der gesetzliche Forderungsübergang und die Übertragung anderer Rechte
4. Die Wertpapiere1751
2. Kapitel Die Rechtsfolgen der Abtretung1752 – 1754
1. Der Übergang der Forderung1752
2. Der Übergang forderungsabhängiger Sicherheiten und Vorzugsrechte1753, 1754
3. Kapitel Die Voraussetzung der Abtretung1755 – 1778
1. Die Beweislast1755
2. Der Abtretungsvertrag1756 – 1758
3. Die Blankozession1759
4. Die Teilabtretung1760
5. Die Vorausabtretung1761 – 1765
6. Die Sicherungsabtretung1766 – 1770
7. Die Inkassozession1771
8. Das Factoring1772, 1773
9. Die Einziehungsermächtigung1774 – 1778
4. Kapitel Die Abtretungshindernisse1779 – 1785
1. Die Beweislast1779
2. Der vertragliche Ausschluss der Abtretung1780 – 1783
3. Der Ausschluss der Abtretung wegen Veränderung des Inhalts der Forderung1784
4. Der Ausschluss der Abtretung unpfändbarer Forderungen1785
5. Die verbots- und die sittenwidrige Abtretung
5. Kapitel Der Schutz des Schuldners nach einer Abtretung1786 – 1801
1. Das gesetzliche System1786
2. Die Einwendungen des Schuldners gegen die abgetretene Forderung1787 – 1789
3. Der Aufrechnungseinwand des Schuldners gegen die abgetretene Forderung1790 – 1793
4. Die Leistung des Schuldners an den Zedenten und sonstige Rechtsgeschäfte des Schuldners mit dem Zedenten über die abgetretene Forderung1794, 1795
5. Der Prozesssieg des Schuldners über den Zedenten1796, 1797
6. Die Mehrfachabtretung1798
7. Die Abtretungsanzeige des Zedenten1799
8. Die Leistung des Schuldners an den Zessionar nur gegen Aushändigung der Abtretungsurkunde1800
9. Kein gutgläubiger Forderungserwerb vom Nichtberechtigten1801
6. Kapitel Der gesetzliche Forderungsübergang1802, 1803
7. Kapitel Die Übertragung anderer Rechte1804
8. Kapitel Die Verpfändung und Pfändung der Forderung1805
30. Teil Die Schuldübernahme
1. Kapitel Das gesetzliche System1806
2. Kapitel Die Rechtsfolge der Schuldübernahme1807
3. Kapitel Die Voraussetzungen der Schuldübernahme1808 – 1812
1. Die Schuldübernahme zwischen Übernehmer und Gläubiger1808
2. Die Schuldübernahme zwischen Übernehmer und Schuldner1809 – 1811
3. Die Übernahme einer Hypothekenschuld1812
4. Kapitel Die Einwendungen des Übernehmers gegen die übernommene Schuld1813 – 1815
1. Die Einwendungen gegen die Schuldübernahme1813
2. Die Einwendungen gegen die übernommene Schuld1814
3. Die Einwendungen aus dem Schuldverhältnis zwischen Schuldner und Übernehmer1815
5. Kapitel Der Schuldbeitritt1816 – 1819
1. Die rechtliche Konstruktion und ihre Rechtsfolge1816
2. Die Voraussetzungen des vertraglichen Schuldbeitritts1817, 1818
3. Die Einwendungen des beitretenden Schuldners1819
6. Kapitel Die Vertragsübernahme1820 – 1822
1. Das gesetzliche System1820
2. Die Rechtsfolge der Vertragsübernahme
3. Die Vereinbarung der Vertragsübernahme1821
4. Der Vertragsbeitritt1822
5. Die Entlassung aus einem Vertrag
31. Teil Mehrere Schuldner oder Gläubiger
1. Kapitel Das gesetzliche System1823, 1824
2. Kapitel Teilschuldner und Teilgläubiger1825, 1826
1. Eine gesetzliche Auslegungsregel1825
2. Die teilbare Leistung1826
3. Kapitel Die Gesamtschuldner1827 – 1836
1. Die gesetzliche Konstruktion der Gesamtschuld1827
2. Die Rechtsfolge der Gesamtschuld1828, 1829
3. Die Voraussetzungen der Gesamtschuld1830 – 1832
4. Die Gesamtwirkung der Erfüllung durch einen Gesamtschuldner1833
5. Die Gesamtwirkung des Erlasses der Schuld eines Gesamtschuldners1834
6. Die Gesamtwirkung weiterer Rechtsfolgen1835
7. Die Einzelwirkung aller anderen Tatsachen1836
4. Kapitel Der Gesamtschuldnerausgleich1837 – 1853
1. Das gesetzliche System1837 – 1840
2. Der Gesamtschuldnerausgleich zu gleichen Anteilen1841 – 1843
3. Der Gesamtschuldnerausgleich, „soweit ein anderes bestimmt ist“1844 – 1849
4. Die Anspruchsvoraussetzungen des Gesamtschuldnerausgleichs1850
5. Die Einwendungen gegen den Gesamtschuldnerausgleich1851
6. Der gesetzliche Forderungsübergang1852
7. Der Ausgleich im „gestörten Gesamtschuldverhältnis“1853
5. Kapitel Die Gesamtgläubiger1854 – 1857
1. Die Rechtsfolge1854
2. Die Voraussetzung1855
3. Gesamtwirkung und Einzelwirkung1856
4. Der Gesamtgläubigerausgleich1857
6. Kapitel Die Gläubiger einer unteilbaren Leistung1858, 1859
1. Die Rechtsfolge1858
2. Die Voraussetzung1859
7. Kapitel Die Gesamthandsgläubiger1860
8. Kapitel Die Gesamthandsschuldner1861
32. Teil Das Sonderrecht des Verbraucherschutzes
1. Kapitel Der Verbraucherschutz im BGB1862, 1863
1. Die vergebliche Suche nach einem gesetzlichen System1862
2. Die verstreuten Standorte des Verbraucherschutzrechts1863
2. Kapitel Der Verbrauchervertrag1864 – 1867
3. Kapitel Besondere Vertriebsformen1868 – 1879
1. Der außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Vertrag, vormals das Haustürgeschäft1868 – 1876
2. Der Fernabsatzvertrag1877, 1878
3. Der elektronische Geschäftsverkehr1879
4. Abweichende Vereinbarung und Beweislast
4. Kapitel Der Ratenlieferungsvertrag1880
5. Kapitel Teilzeit-Wohnrechteverträge, Verträge über langfristige Urlaubsprodukte, Vermittlungsverträge und Tauschsystemverträge1881
3. Buch BGB Allgemeiner Teil oder: Das Rechtsgeschäft
33. Teil Die Privatautonomie
1. Kapitel Die Rechtsgrundlage der Privatautonomie1882
2. Kapitel Die Vertragsfreiheit1883 – 1885
1. Die Aspekte der Vertragsfreiheit1883
2. Vertragsfreiheit und Wirtschaftsordnung
3. Vertragsfreiheit und Grundgesetz1884, 1885
3. Kapitel Abschlussfreiheit und Abschlusszwang nach dem BGB1886 – 1889
4. Kapitel Gestaltungsfreiheit und Typenzwang nach dem BGB1890 – 1895
1. Die freie Vereinbarung des Vertragsinhalts1890
2. Der schuldrechtliche Verpflichtungsvertrag1891 – 1893
3. Dingliche und schuldrechtliche Verfügung1894
4. Ehe- und Erbvertrag1895
5. Kapitel Die Beschränkung der Vertragsfreiheit durch das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz1896 – 1899
1. Das gesetzliche System1896
2. Das zivilrechtliche Benachteiligungsverbot1897
3. Die Rechtsfolgen einer unzulässigen Benachteiligung1898
4. Die unabsehbaren Folgen des AGG1899
6. Kapitel Formfreiheit und Formzwang1900 – 1918
1. Der Grundsatz der Formfreiheit1900
2. Wirk- oder Zweckform1901
3. Die Beweislast1902, 1903
4. Die Rechtsfolge eines Formfehlers1904 – 1909
5. Die gesetzliche Form1910 – 1917
6. Die rechtsgeschäftliche Form1918
34. Teil Das Rechtsgeschäft
1. Kapitel Willenserklärung, Vertrag und Rechtsgeschäft im System des BGB1919 – 1924
1. Instrumente der Privatautonomie und Grundbegriffe des Vertragsrechts1919
2. Die Willenserklärung1920
3. Der Vertrag
4. Das Rechtsgeschäft1921 – 1923
5. Die Grundformen privatautonomen Handelns1924
2. Kapitel Die bunte Vielfalt der Rechtsgeschäfte1925 – 1950
1. Die verschiedenen Schubladen1925
2. Einseitiges und mehrseitiges Rechtsgeschäft1926, 1927
3. Verpflichtung und Verfügung1928 – 1934
4. Kausales und abstraktes Rechtsgeschäft1935 – 1946
5. Rechtsgeschäfte unter Lebenden und von Todes wegen1947 – 1950
35. Teil Die Auslegung des Rechtsgeschäfts
1. Kapitel Ziel und Methode der Auslegung1951 – 1956
1. Die juristische Auslegung1951
2. Willenserforschung oder Sinnermittlung?1952 – 1955
3. Willenserklärung: ja oder nein?1956
2. Kapitel Das übereinstimmende Verständnis trotz Falschbezeichnung1957 – 1966
1. Die Rechtsfolge1957, 1958
2. Die Beweislast für das übereinstimmende Verständnis1959
3. Die Falschbezeichnung und der gesetzliche Formzwang1960 – 1966
3. Kapitel Die normative Auslegung nach Treu und Glauben1967 – 1985
1. Ein Notbehelf im Auslegungsstreit1967, 1968
2. Die Beweislast im Auslegungsstreit1969
3. Normative Auslegung und Vertragsfreiheit1970
4. Das Ziel der normativen Auslegung1971, 1972
5. Der Maßstab der normativen Auslegung1973
6. Der Gegenstand der normativen Auslegung1974
7. Das Material der normativen Auslegung1975 – 1977
8. Die normative Auslegung in der Praxis1978 – 1982
9. Die objektive Auslegung im öffentlichen Interesse1983, 1984
10. Gesetzliche Auslegungsregeln1985
11. Die Vertragsauslegung im Prozess
4. Kapitel Die ergänzende Auslegung1986 – 1998
1. Das lückenhafte Rechtsgeschäft1986, 1987
2. Die Ergänzung des lückenhaften Vertrags durch das Gesetz1988
3. Die Ergänzung des lückenhaften Vertrags durch Auslegung1989 – 1991
4. Die ergänzende Vertragsauslegung in der Praxis1992 – 1997
5. Ergänzende Vertragsauslegung und Störung der Geschäftsgrundlage1998
36. Teil Die Willenserklärung
1. Kapitel Das Ziel der Willenserklärung und ihre Bestandteile1999 – 2007
1. Die Erklärung eines Rechtsfolgewillens1999, 2000
2. Der Rechtsfolgewille und seine Erklärung2001, 2002
3. Der Handlungs-, Erklärungs- und Geschäftswille2003 – 2007
2. Kapitel Die Möglichkeiten, einen Rechtsfolgewillen auszudrücken2008 – 2017
1. Die Kundgabe einer Rechtsfolge2008
2. Die ausdrückliche Willenserklärung2009
3. Die stillschweigende Willenserklärung durch schlüssiges Verhalten2010 – 2013
4. Das Schweigen als Willenserklärung2014, 2015
5. Das Schweigen an Erklärungs Statt2016
6. Die geschäftsähnliche Handlung2017
3. Kapitel Das Wirksamwerden der Willenserklärung2018 – 2036
1. Das gesetzliche System2018, 2019
2. Die Rechtsfolge der Willenserklärung2020
3. Die Beweislast für das Wirksamwerden der Willenserklärung2021, 2022
4. Die empfangsbedürftige Willenserklärung2023 – 2034
5. Die Willenserklärung unter Anwesenden2035
6. Die Willenserklärung ohne Adressaten2036
37. Teil Der Vertrag
1. Kapitel Das gesetzliche System2037, 2038
2. Kapitel Vertragliche und gesetzliche Regelung2039 – 2043
1. Der Mindestinhalt des Vertrags2039, 2040
2. Die vertraglichen Nebenabreden2041
3. Die gesetzliche Ergänzung des Vertragsinhalts2042
4. Der rechtliche Zusammenhang zwischen vertraglicher und gesetzlicher Regelung2043
3. Kapitel Vertragsverhandlungen und Vertrag2045, 2046
1. Die Vertragsverhandlungen2045
2. Die vertragliche Bindung2046
4. Kapitel Vertrag und Gefälligkeit2047 – 2054
1. Entweder – oder2047, 2048
2. Ein Problem der Auslegung2049 – 2052
3. Die Gefälligkeitsfahrt2053, 2054
5. Kapitel Das Verhandlungsergebnis: Konsens oder Dissens2055 – 2065
1. Die vertragliche Einigung2055
2. Das Ergebnis der Auslegung: Konsens, Dissens oder Irrtum?2056
3. Die Beweislast für die vertragliche Einigung2057
4. Die Methode der rechtlichen Prüfung2058 – 2061
5. Der offene Dissens2062, 2063
6. Der versteckte Dissens2064, 2065
6. Kapitel Der Vertragsschluss2066 – 2083
1. Die gesetzliche Konstruktion2066
2. Das Vertragsangebot2067 – 2074
3. Die Annahme des Vertragsangebots2075 – 2079
4. Der Vertragsschluss durch eine Versteigerung2080
5. Der „faktische“ Vertrag2081 – 2083
7. Kapitel Der vorformulierte AGB-Vertrag2084 – 2123
1. Das Diktat des Stärkeren und die Abwehr des Schwächeren2084, 2085
2. Was unterscheidet den AGB-Vertrag vom BGB-Vertrag?2086 – 2088
3. Die Beweislast für und gegen die Vereinbarung von AGB2089
4. Die Methode der rechtlichen Prüfung2090
5. Der Geltungsbereich des AGB-Rechts2091
6. Allgemeine Geschäftsbedingungen2092 – 2098
7. Die Vereinbarung allgemeiner Geschäftsbedingungen2099 – 2106
8. Überraschende allgemeine Geschäftsbedingungen2107
9. Der Vorrang der Individualabrede vor allgemeinen Geschäftsbedingungen2108
10. Die Auslegung allgemeiner Geschäftsbedingungen2109 – 2113
11. Die Unwirksamkeit allgemeiner Geschäftsbedingungen2114 – 2121
12. Die Verbandsklage auf Unterlassung und Widerruf2122, 2123
8. Kapitel Der Vertrag durch Schweigen auf ein kaufmännisches Bestätigungsschreiben2124 – 2130
1. Das kaufmännische Bestätigungsschreiben2124
2. Die Rechtsfolge: Schweigen als Zustimmung2125
3. Das Bestätigungsschreiben und die Beweislast2126
4. Das Bestätigungsschreiben als Anspruchsgrundlage2127 – 2129
5. Die Einwendungen gegen das Bestätigungsschreiben2130
38. Teil Das bedingte Rechtsgeschäft
1. Kapitel Die rechtsgeschäftliche Bedingung2131 – 2136
1. Das gesetzliche System2131
2. Die Bedingung2132, 2133
3. Die Potestativbedingung2134
4. Die Wollensbedingung2135
5. Die aufschiebende und die auflösende Bedingung2136
2. Kapitel Das rechtsgeschäftliche Setzen der Bedingung2137 – 2142
1. Die Vereinbarung der Bedingung2137, 2138
2. Das einseitige Setzen der Bedingung2139
3. Die wirksame und die unwirksame Bedingung2140, 2141
4. Die Beweislast für und gegen einen bedingten Vertrag2142
3. Kapitel Die Rechtsfolgen des bedingten Rechtsgeschäfts2143 – 2155
1. Die Rechtsfolge der aufschiebenden Bedingung2143
2. Die Rechtsfolge der auflösenden Bedingung2144
3. Das Anwartschaftsrecht2145
4. Der Eintritt der Bedingung2146
5. Der Schadensersatzanspruch des bedingt Berechtigten2147
6. Die Zwischenverfügung während der Schwebezeit einer bedingten Verfügung2148 – 2150
7. Der Ausfall der Bedingung2151
8. Die Manipulation der Bedingung2152 – 2155
4. Kapitel Die rechtsgeschäftliche Befristung2156
39. Teil Die Stellvertretung
1. Kapitel Das gesetzliche System2157, 2158
1. Ein Instrument der Privatautonomie2157
2. Die Stellvertretung im rechtsgeschäftlichen System2158
2. Kapitel Vertretergeschäft oder Eigengeschäft2159 – 2162
1. Das Vertretergeschäft und seine Rechtsfolge2159
2. Eigengeschäft und Vertretergeschäft, Regel und Ausnahme2160 – 2162
3. Kapitel Der Vertreter und andere Hilfspersonen des Zivilrechts2163 – 2172
1. Der Vertreter2163
2. Der amtliche Verwalter eines Sondervermögens2164
3. Der Bote2165
4. Der mittelbare Vertreter2166
5. Strohmann und Treuhänder2167, 2168
6. Die Verfügung über ein fremdes Recht2169, 2170
7. Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfe2171
8. Der Besitzdiener2172
4. Kapitel Das rechtsgeschäftliche Handeln in fremdem Namen2173 – 2181
1. Das Offenlegen der Stellvertretung2173 – 2175
2. Das unternehmensbezogene Geschäft2176
3. Das Handeln unter fremdem Namen2177, 2178
4. Das Geschäft für den, den es angeht2179 – 2181
5. Kapitel Die Vertretungsmacht2182 – 2188
1. Die Rechtsgrundlage2182
2. Vertretungsmacht und Schuldverhältnis2183 – 2185
3. Einzel- und Gesamtvertretungsmacht2186
4. Die gesetzliche Vertretungsmacht2187, 2188
6. Kapitel Die Vollmacht2189 – 2223
1. Die rechtsgeschäftliche Vertretungsmacht2189
2. Die Erteilung der Vollmacht2190 – 2193
3. Die Vollmachtsurkunde2194, 2195
4. Der Umfang der Vollmacht2196 – 2198
5. Das Erlöschen der Vollmacht2199 – 2203
6. Die unwiderrufliche Vollmacht2204 – 2206
7. Die Untervollmacht2207, 2208
8. Die Duldungs- und die Anscheinsvollmacht2209 – 2211
9. Die Prokura2212 – 2218
10. Die Handlungsvollmacht2219 – 2221
11. Die Ladenvollmacht2222
12. Die Vollmacht des Versicherungsvertreters
13. Die Prozessvollmacht2223
7. Kapitel Das Vertretergeschäft2224 – 2230
1. Die Willenserklärung des Vertreters2224, 2225
2. Der Willensmangel des Vertreters2226
3. Das Wissen oder Wissenmüssen des Vertreters2227
4. Das Wissen oder Wissenmüssen des Vollmachtgebers2228, 2229
5. Der Wissensvertreter2230
8. Kapitel Der Vertreter ohne Vertretungsmacht2231 – 2234
1. Die Rechtsfolgen rechtsgeschäftlichen Handelns ohne Vertretungsmacht2231
2. Der Mangel der Vertretungsmacht2232
3. Der Vertrag ohne Vertretungsmacht2233, 2234
9. Kapitel Die Haftung des Vertreters ohne Vertretungsmacht2235 – 2241
1. Das gesetzliche System2235
2. Die Garantiehaftung des Vertreters ohne Vertretungsmacht2236 – 2239
3. Die Vertrauenshaftung des Vertreters ohne Vertretungsmacht2240
4. Der Ausschluss der Vertreterhaftung2241
10. Kapitel Der Missbrauch der Vertretungsmacht2242 – 2244
1. Die Rechtsfolge2242
2. Eine Einwendung gegen das Vertretergeschäft2243
3. Der Missbrauch des Vertreters
4. Die Kenntnis oder das Kennenmüssen des Geschäftsgegners2244
11. Kapitel Das Insichgeschäft2245 – 2255
1. Das gesetzliche System2245, 2246
2. Die Rechtsfolge des Insichgeschäfts2247
3. Die Voraussetzungen des Insichgeschäfts2248 – 2252
4. Das wirksame Insichgeschäft als Ausnahme2253, 2254
5. Die Kundgabe des Insichgeschäfts2255
40. Teil Die Zustimmung
1. Kapitel Eine allgemeine Rechtsfigur des Zivilrechts2256 – 2265
1. Das gesetzliche System2256
2. Gesetzliche und vereinbarte Zustimmung2257
3. Die behördliche und gerichtliche Genehmigung2258
4. Die Zustimmung des Dritten als einseitiges Rechtsgeschäft2259, 2260
5. Die Einwilligung des Dritten2261, 2262
6. Die Genehmigung des Dritten2263 – 2265
2. Kapitel Die Zustimmung zur Verfügung des Nichtberechtigten2266 – 2272
1. Die Verfügung des Nichtberechtigten2266, 2267
2. Die Verfügungsermächtigung2268
3. Keine Verpflichtungsermächtigung2269
4. Die Genehmigung der unberechtigten Verfügung des Nichtberechtigten2270, 2271
5. Die Heilung der unwirksamen Verfügung des Nichtberechtigten2272
41. Teil Das nichtige Rechtsgeschäft
1. Kapitel Das fehlerhafte Rechtsgeschäft und seine Rechtsfolgen2273 – 2280
1. Nichtigkeit, Unwirksamkeit, Anfechtbarkeit2273
2. Absolute und relative Unwirksamkeit2274, 2275
3. Nichtiges und unfertiges Rechtsgeschäft2276, 2277
4. Die Rechtsfolge Nichtigkeit2278, 2279
5. Die Beweislast für den Nichtigkeitsgrund2280
2. Kapitel Total- und Teilnichtigkeit des Rechtsgeschäfts2281 – 2293
1. Die gesetzliche Auslegungsregel für Totalnichtigkeit und die Beweislast2281
2. Das teilbare Rechtsgeschäft2282 – 2284
3. Der rechtliche Zusammenhang mehrerer Rechtsgeschäfte2285 – 2290
4. Die personelle Teilbarkeit eines Rechtsgeschäfts2291
5. Die Teilwirksamkeit eines Rechtsgeschäfts durch Auslegung2292
6. Die Grenzen der Totalnichtigkeit2293
3. Kapitel Die Umdeutung des nichtigen Rechtsgeschäfts2294 – 2298
1. Die Rechtsfolge der Umdeutung2294, 2295
2. Das nichtige und das andere Rechtsgeschäft2296
3. Die Umdeutung des nichtigen Rechtsgeschäfts durch Auslegung2297
4. Die Bestätigung des nichtigen Rechtsgeschäfts2298
4. Kapitel Die Geschäftsunfähigkeit2299 – 2305
1. Das gesetzliche System2299, 2300
2. Der Schutz des Geschäftsunfähigen
3. Die Einwendung der Geschäftsunfähigkeit2301, 2302
4. Die Rechtsfolge der Geschäftsunfähigkeit oder sonstigen Geistesstörung2303
5. Die Geschäftsunfähigkeit2304
6. Die partielle Geschäftsunfähigkeit2305
5. Kapitel Die beschränkte Geschäftsfähigkeit2306 – 2326
1. Das gesetzliche System2306
2. Die Einwendung der beschränkten Geschäftsfähigkeit2307, 2308
3. Das zustimmungsbedürftige Geschäft des Minderjährigen2309 – 2317
4. Das zustimmungsfreie Geschäft des Minderjährigen2318 – 2324
5. Umfang und Grenzen des Minderjährigenschutzes2325, 2326
6. Kapitel Das verbotene Rechtsgeschäft2327 – 2348
1. Eine anspruchshindernde Einwendung2327
2. Die Rechtsfolge des verbotenen Rechtsgeschäfts2328 – 2330
3. Das gesetzliche Verbot2331 – 2346
4. Umgehungsgeschäfte2347, 2348
7. Kapitel Das sittenwidrige Rechtsgeschäft2349 – 2395
1. Eine anspruchshindernde Einwendung2349
2. Die Rechtsfolgen des sittenwidrigen Rechtsgeschäfts2350 – 2353
3. Die guten Sitten2354 – 2359
4. Der Verstoß gegen die guten Sitten2360 – 2367
5. Die Fallgruppen des sittenwidrigen Rechtsgeschäfts2368
6. Die sittenwidrige Vertragsbindung2369
7. Die maßlose Vertragsbindung2370 – 2372
8. Die sittenwidrige Leistung und die Bestechlichkeit2373 – 2377
9. Der Wucher2378 – 2381
10. Das wucherähnliche Geschäft2382 – 2391
11. Der sittenwidrige Geschäftszweck2392 – 2394
12. Das standeswidrige Rechtsgeschäft2395
8. Kapitel Das „Veräußerungsverbot“2396 – 2407
1. Eine Verfügungsbeschränkung2396
2. Das absolute gesetzliche „Veräußerungsverbot“2397
3. Das relative behördliche „Veräußerungsverbot“2398 – 2403
4. Das relative Erwerbsverbot2404
5. Keine rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkung2405 – 2407
42. Teil Das Rechtsgeschäft und die Willensmängel
1. Kapitel Die „kranke“ Willenserklärung als Störfall2408, 2409
1. Der Willensmangel2408
2. Die Beweislast für den Willensmangel2409
2. Kapitel Der geheime Vorbehalt und die Scherzerklärung2410, 2411
1. Der geheime Vorbehalt2410
2. Die Scherzerklärung2411
3. Die Abgrenzung
3. Kapitel Das Scheingeschäft2412 – 2415
1. Die Rechtsfolge des Scheingeschäfts2412
2. Die Voraussetzungen des Scheingeschäfts2413, 2414
3. Das verdeckte Rechtsgeschäft2415
4. Kapitel Die Anfechtung der Willenserklärung2416 – 2466
1. Selbstbestimmung und Vertrauensschutz2416
2. Das gesetzliche System der Anfechtung2417, 2418
3. Die Rechtsfolge der Anfechtung2419, 2420
4. Die Anfechtungserklärung2421 – 2427
5. Der Anfechtungsgrund und die Kausalität2428
6. Der Irrtum als Anfechtungsgrund2429 – 2431
7. Der Erklärungsirrtum2432 – 2435
8. Der Inhaltsirrtum2436 – 2442
9. Der Motivirrtum2443
10. Der Eigenschaftsirrtum2444, 2445
11. Die arglistige Täuschung als Anfechtungsgrund2446 – 2452
12. Die widerrechtliche Drohung als Anfechtungsgrund2453 – 2459
13. Die Anfechtungsfrist2460 – 2462
14. Die Bestätigung des anfechtbaren Rechtsgeschäfts2463
15. Die rechtsmissbräuchliche Anfechtung2464
16. Der Anspruch auf Schadensersatz nach einer Irrtumsanfechtung2465, 2466
43. Teil Die Verjährung
1. Kapitel Die Modernisierung einer altmodischen Verjährung2467 – 2469
2. Kapitel Die Verjährung im System des BGB2470 – 2472
1. Verjährung und Ausschlussfrist2470
2. Verjährung und Gerechtigkeit2471
3. Die Methode der rechtlichen Prüfung und die Beweislast2472
3. Kapitel Die Rechtsfolgen der Verjährung2473 – 2477
1. Leistungsverweigerungsrecht und Verjährungseinrede des Schuldners2473
2. Die Erfüllbarkeit des verjährten Anspruchs2474
3. Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht trotz Verjährung2475
4. Die dingliche Sicherheit für einen verjährten Anspruch2476, 2477
4. Kapitel Der verjährbare Anspruch2478 – 2480
1. Die gesetzliche Regel und ihre Ausnahmen2478, 2479
2. Die selbstständige Verjährung jedes Anspruchs2480
5. Kapitel Die Verjährungsfristen2481 – 2484
1. Regelfrist und Sonderfristen2481
2. Die Verjährungsfrist von 10 Jahren als Ausnahme2482
3. Die Verjährungsfrist von 30 Jahren als Ausnahme mit Gegenausnahmen2483
4. Die Regelverjährung von 3 Jahren2484
6. Kapitel Der Beginn der Verjährung2485 – 2490
1. Das gesetzliche System2485
2. Der Beginn der Regelverjährung im Normalfall2486 – 2488
3. Die Höchstfristen für den Beginn der Regelverjährung2489
4. Der Beginn der anderen Verjährungsfristen2490
7. Kapitel Der Neubeginn der Verjährung2491 – 2493
1. Das gesetzliche System2491
2. Die Rechtsfolge des Neubeginns der Verjährung
3. Das Anerkenntnis des Schuldners2492
4. Die Vollstreckungshandlung des Gläubigers2493
8. Kapitel Die Hemmung der Verjährung2494 – 2503
1. Die Rechtsfolge der Hemmung2494
2. Die Hemmung der Verjährung durch Verhandlungen
3. Die Hemmung der Verjährung durch Rechtsverfolgung2495 – 2498
4. Sonstige Hemmungsgründe2499 – 2502
5. Die Ablaufhemmung2503
9. Kapitel Die Vereinbarung über die Verjährung2504, 2505
1. Die Vertragsfreiheit2504
2. Vorformulierte Verjährungsabreden
3. Der Verbrauchsgüterkauf2505
Sachregister