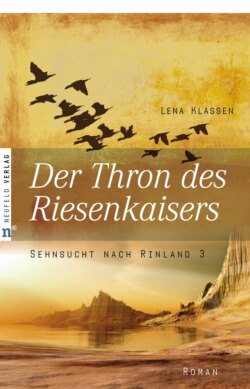Читать книгу Der Thron des Riesenkaisers - Lena Klassen - Страница 13
2. Der Silberne Krug und eine Kette aus Eisen
ОглавлениеD E RJ U N G EM A N Nauf der Lichtung schien so fest zu schlafen, als gäbe es nichts Böses auf der Welt. Sein Pferd, ein langbeiniger Brauner mit schwarzer Mähne, rupfte gemächlich die hohen Halme ab, so weit der Strick an seinem Halfter es zuließ. Als das Mädchen zwischen den Bäumen hervortrat, stutzte der Hengst nur kurz und ließ sich nicht weiter beim Grasen stören.
Der Schläfer lag auf dem Rücken, den Kopf auf einen aus grobem Stoff genähten Reisesack gebettet. Sein blondes Haar klebte ihm verschwitzt an der Stirn. Manina lächelte unwillkürlich. Die Spätsommersonne schien ihm voll ins Gesicht; wenn er nicht bald aufwachte, würde er sich einen schlimmen Sonnenbrand holen. Wahrscheinlich schlief er hier schon länger, als er beabsichtigt hatte. Das hieß, dass er sehr müde gewesen war, als er hier angekommen war, und es nicht einmal mehr bis ins Dorf geschafft hatte, wo es im Silbernen Krug alles gegeben hätte, was Reisende benötigten, um sich zu erfrischen und gut zu erholen. Sie betrachtete ihn und überlegte, von wo er wohl kommen mochte, aus welchem der vierundzwanzig Königreiche Deret-Aifs.
Der Fremde öffnete die Augen und blickte sie verträumt an. Er gähnte, wischte sich die Haare aus der Stirn und setzte sich auf.
»Was für ein wunderschöner Traum«, sagte er. »Oder bist du wirklich?«
Die junge Prinzessin lachte. »Ganz wirklich«, versicherte sie. Seine Stimme war ebenso angenehm wie sein Äußeres. Und ja, auch sie hatte das Gefühl, dass diese Begegnung nicht wirklich stattfand. Nie hätte sie sich träumen lassen, dass hier, auf dem Weg ins Gasthaus, in dem sie arbeitete, etwas passierte, das ihr Leben von Grund auf änderte. Sie musste nur das staunende Lächeln in seinem attraktiven Gesicht erwidern, in seine ernsten grauen Augen blicken, um zu wissen, dass nichts mehr so war wie zuvor.
Solche Dinge passierten sonst immer nur anderen. Wenn Maja davon erzählte, wie sie auf einer Lichtung ihren tot geglaubten Brieffreund getroffen hatte, senkte die ehemalige Kaiserin manchmal traurig den Kopf. Und kam doch ständig darauf zurück. Sie konnte nicht anders, als immer wieder zu fragen: Wie war es? Wie war dieser Moment, als du ihn erkannt hast? Als du wusstest, dass es Sorayn war?
Aber ihr selbst begegnete niemand, den sie hätte lieben können. Früher war sie davon ausgegangen, dass sie eine Verbindung zum Wohle des Kaiserreichs würde eingehen müssen, dass irgendein König oder Prinz eines Tages neben ihr auf dem Thron saß und mit ihr regierte; eine Aussicht, die damals nicht einmal schmerzte oder ihr Angst einjagte, so selbstverständlich war eine Pflichtheirat, wenn man im Schloss von Kirifas lebte. Doch nun war sie an diesem sonnigen Tag einem Reisenden begegnet, und nun hatte auch sie endlich eine Geschichte, in der eine Lichtung eine Rolle spielte.
»Da hinten«, sagte sie und wies nach Norden, »dort ist das nächste Dorf.« Und dann, sie wusste selbst nicht, warum, ergriff sie die Flucht. Sie eilte an seinem Pferd vorbei, über das hohe Gras zum Pfad, der durch den Wald führte, und sah sich nicht einmal um. Als sie losrannte, verwünschte sie ihre Feigheit. Hatte sie nicht mit Königen und Fürsten gesprochen, Heerführern und Würdenträgern befohlen, zu jener Zeit, als sie noch die Kaiserin von ganz Deret-Aif gewesen war? Aber jetzt lief sie vor einem blonden Fremden davon, der ihr schläfrig in die Augen geblickt hatte, floh vor dieser Lichtung und vor der Geschichte, die dort vielleicht begonnen hatte und genauso schnell wieder zu Ende sein konnte, direkt in Tamaits und Majas Arme.
Das Geschwisterpaar kam ihr bereits entgegen. Beide merkten sofort, dass etwas nicht stimmte, dass etwas geschehen war – und war heute nicht wirklich alles anders als gestern? Hatte sich nicht die ganze Welt verwandelt, zu einer neuen Welt, in der er lebte?
»Hat dir jemand etwas getan?«, rief Maja erschrocken. »Wirst du verfolgt?«
»Nein, nein. Bloß weiter, schnell.« Hastig zog sie ihre Freunde in die Richtung, aus der die beiden gekommen waren. »Ich will nur nicht … ach, vergesst es.«
»Du bist spät dran«, sagte Tamait. »Stollo hat uns losgeschickt, um nach dir zu sehen.«
»Euch beide? Das sieht ihm gar nicht ähnlich.« Stollo, der Wirt des Silbernen Kruges, verzichtete nur äußerst ungern auf eine Arbeitskraft.
»Er wollte, dass ich dableibe«, gab Maja zu, »aber ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Was ist nur passiert, Manina? Du verspätest dich doch sonst nie.«
Das kleine Haus im Wald, in dem die drei lebten – mehr eine baufällige Hütte als ein richtiges Haus –, lag nur wenige hundert Meter von der Gastwirtschaft entfernt, in der sie alle Arbeit gefunden hatten. Tamait kümmerte sich um die Pferde der Gäste, Maja unterhielt sie mit ihrem Flötenspiel, wenn nicht allzu viel zu tun war, und Manina half in der Küche. Es war anstrengend und schmutzig. Nichts für jemanden, der zimperlich und wehleidig war, und manchmal schüttete das blonde Mädchen seinen Freunden weinend das Herz aus. Aber sie gab nicht auf; obwohl sie behütet und verzärtelt aufgewachsen war, fand sie in sich eine Kraft, die sie selbst erstaunte.
»Nun sag schon«, bohrte Tamait, doch Maja schüttelte den Kopf.
»Lass sie in Ruhe«, befahl sie ihrem Bruder. Sie waren nicht blutsverwandt, doch sie hatten fast ihr ganzes Leben in dem Glauben verbracht, sie wären es. Niemand, der sie zusammen sah, wäre auf den Gedanken gekommen, dass sie nicht Bruder und Schwester waren, so hatte sich alles zwischen ihnen eingespielt, und da sie beide schwarzhaarig waren und ihre gebräunte Haut in einem satten Bronzeton schimmerte, war die Ähnlichkeit nahezu vollkommen.
Als das Gasthaus vor ihnen auftauchte – ein langgestrecktes Holzhaus mit einer bunt gestrichenen Tür –, zögerte Manina und blieb stehen. »Ich kann heute nicht arbeiten«, erklärte sie.
»Und warum nicht?«, fragte Tamait.
Stollo erschien auf der Schwelle. »Wo bleibt ihr denn? Marsch, marsch! Soll das Essen sich heute alleine kochen? Muss ich euch alle auf der Stelle fortjagen? Ich mach’s, glaubt mir, das ist genau das, was ich machen werde, wenn ihr nicht endlich herkommt und das tut, wofür ihr bezahlt werdet!«
Maja warf ihm heimlich einen bösen Blick zu. »Manchmal wünsche ich mir wirklich, ich könnte es diesem Sklavenantreiber sagen.«
»Das tust du nicht!«, rief Manina. »Und außerdem – ich bin nichts Besonderes mehr. Wen kümmert es, was ich war? Niemanden. Also lassen wir alles einfach so, wie es ist.«
»Da bin ich mir nicht sicher, dass es niemanden kümmert«, murmelte die junge Frau. Sie schob Manina, die sich immer noch ein wenig sträubte, in Richtung Hintereingang, wo lautes Scheppern verriet, dass jemand seine schlechte Laune an Töpfen und Pfannen ausließ. »Lass dich von Tamait nicht zwingen, etwas preiszugeben, was du für dich behalten willst«, riet sie der blonden Prinzessin.
Manina blieb stehen. »Da war ein Mann auf der Lichtung«, berichtete sie.
»Hat er dich erschreckt?«, fragte Maja alarmiert. »Hat er versucht … Bei Rin, wir sollten dich nicht allein lassen! Wollten wir nicht immer darauf achten, dass du in unserer Nähe bist?«
Maninas Augen glänzten, Röte überzog ihre Wangen. »Nein«, beruhigte sie ihre Freundin, »nein, er schlief … Ich bin einfach nur … ich stand da und habe ihn die ganze Zeit nur angeschaut …«
»Meine Güte«, entfuhr es Maja. Neugierig fügte sie hinzu: »Und dann? Ist er aufgewacht?«
»Ja, ist er. Und ich … ich weiß auch nicht, warum, aber ich konnte nicht dableiben. Was mache ich bloß, wenn er hierher kommt? Ich Dummkopf habe ihm auch noch gesagt, in welcher Richtung der Silberne Krug liegt! Was ist, wenn er drinnen sitzt? Wenn ich ihm das Essen bringen muss? Maja, bitte hilf mir, das kann ich einfach nicht!«
Stollos leuchtend rotes Gesicht erschien am Hinterausgang. »Mädels!«, schrie er. »Das Haus ist voll!«
»Wir kommen«, versprach Maja. »Mach mich nicht wütend, sonst spiele ich ein Lied, das deine Gäste so aufregt, dass sie dich mit Krügen und Tellern bewerfen!«
»Alles nur Gerede«, brummte der Wirt und verschwand wieder.
Die dunkelhaarige junge Frau lächelte aufmunternd. »Und was wäre, wenn er den Silbernen Krug nicht beehrt? Wenn du ihn nie wiedersiehst? Wäre das nicht noch schlimmer? – Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass Stollo merkt, wie unentbehrlich wir für ihn sind. Aber wenn dieser geheimnisvolle Fremde kommt, zeigst du ihn mir, ja? Ich muss doch wissen, wer es schafft, der unnahbaren Manina den Kopf zu verdrehen.«
Sie betraten die Küche, in der ein magerer, pickliger Junge lustlos in einem großen Topf herumrührte. Maja krempelte die Ärmel auf. »Aus dem Weg!« Sie scheuchte Stollos gänzlich zur Küchenarbeit unfähigen Sohn vom Herd fort. »Wir haben Gäste, die hungrig sind.« Sie tauchte einen Löffel in die Suppe und verzog das Gesicht. »Wie oft muss ich dir noch sagen, dass es nichts bringt, zu viel Salz zu nehmen? Die Leute trinken deshalb nicht mehr, sie werden bloß ärgerlich. Hier, nimm den Eimer, du holst jetzt Wasser. Diese Brühe müssen wir verdünnen.« Sie zwinkerte Manina zu, die sich gerade die Schürze umband und ein großes Tablett mit Tellern und Krügen belud. Silbern war keiner davon.
Tausend Gedanken gingen Maja durch den Kopf. Vergiss nicht, wer du bist, Prinzessin Manina. Wähle den Richtigen und wir könnten versuchen, Zukata vom Thron zu stürzen.
Ohne Sorayn.
Sie zwang sich, nicht an Sorayn zu denken. An den Mann, dem sie auf einer lichtüberfluteten Wiese begegnet war, den sie vor einem Bären retten wollte, und dabei hatte sie sich selbst rettungslos verloren, an eine Liebe zu einem Betrüger. Sie hatte sich ihm verbunden, hatte den Bund der Ehe mit ihm geschlossen, glücklich bis zum Zerspringen, bis sie herausgefunden hatte, dass sie ihm nur als Mittel zum Zweck diente, denn ihm war es nur um den Thron von Deret-Aif gegangen. Für Sorayn hatte Manina den Kaiserthron geräumt, hatte sich wie sie alle von seinem Charme bezaubern und von seiner unglaublichen Autorität überwältigen lassen – nur um zu merken, dass die Rücksichtslosigkeit, mit der er seine Pläne durchsetzte, mindestens ebenso groß war. Und doch war Zukata nun Kaiser, obwohl Sorayn versprochen hatte, dass es niemals dazu kommen würde. Was wirklich geschehen war, wusste niemand. Maja hatte Sorayn nicht mehr gesehen, seit sie erschrocken, weinend und wütend von einem blutigen Schlachtfeld geflohen war, auf dem Sorayn und seine Riesen sich ausgetobt hatten. Seit knapp einem Jahr lebte sie nun mit Tamait und Manina in diesem Dorf im Königreich Laring und versuchte, das alles zu vergessen. Vielleicht war ihr Ehemann tot. Vielleicht war es nicht seine Schuld, dass Zukata gewonnen hatte, vielleicht hatte er sich überschätzt und war von seinem Großvater umgebracht worden, bevor er sein ehrgeiziges Ziel erreichen konnte. Sorayn war tot oder er hatte sich, nachdem alles fehlgeschlagen war, einfach aus dem Staub gemacht. Wer konnte es wissen? Besser, sie vergaß ihn. Besser, nicht mehr an die blauen Augen zu denken, die unter den langen, schwarzen Wimpern hervorstrahlten. An sein dichtes schwarzes Haar, seine Haut, an das Glück jener ersten herrlichen Tage, als sie noch geglaubt hatte, es würde nie, niemals enden …
Sie durfte nicht träumen, nichts bedauern, sondern musste sich auf das konzentrieren, was jetzt anstand. Die Suppe. Nein, verdirb sie nicht. Wenn Stollo uns hinauswirft, müssen wir dieses Dorf verlassen und uns etwas anderes suchen. Und Manina will hier nicht weg.
Am Anfang waren sie gemeinsam mit den Zintas in einem bunten Wagen gefahren, doch der ehemaligen Kaiserin gefiel diese Art von Leben überhaupt nicht. Manina sehnte sich nach einem Ort, an dem sie bleiben konnte; ihr gab das Leben der Ziehenden das Gefühl, auf der Flucht zu sein. Deshalb waren sie schließlich hergekommen, im vorigen Jahr, damals noch mit Mino, ihrer Mutter, und deren unzertrennlichen Freunden Jamai und Kroa. Diese drei hielten es nicht aus in dem winzigen Dorf. Die Straße lockte sie, der Wald rief sie, und irgendwann hatte Mino gefragt, ob es sehr schlimm sei, wenn sie gingen.
»Geht ruhig«, hatte Maja geantwortet. »Ich bin schon groß, nicht?«
»Wegen dir mache ich mir keine Sorgen«, hatte Mino gemeint. »Du kannst auf dich aufpassen. Aber Manina. Sie hier allein zu lassen …«
Es gab der jungen Zinta einen leichten Stich, dass ihre abenteuerlustige Mutter so leicht dazu bereit war, ohne sie weiterzuziehen. Dass sie sich bloß um die Prinzessin sorgte.
»Sie ist keine Kaiserin mehr«, hatte sie eingewandt.
»Jemand wie sie kann nicht einfach Schankmädchen spielen und glauben, sie wäre ein Mensch wie alle. Zukata könnte sie immer noch als Bedrohung empfinden. Vergiss nicht, er war schon einmal bereit, sie zu töten. Falls er sie je in der Reihe seiner Gegner vermutet … und bei Zukata reicht schon, dass er sich vorstellt, sie könnte ihm im Weg stehen … Du weißt, was ich damit sagen will. Niemand darf wissen, wer sie ist. Sie braucht einen neuen Namen. Keiner darf auch nur etwas ahnen. Die richtige Verbindung – vielleicht mit dem König von Wenz – könnte aus ihr eine ernst zu nehmende Gegenspielerin für Zukata machen. Viele Leute wären auf ihrer Seite. Alle, die genug von den Riesen haben.«
An dieses Gespräch dachte Maja jetzt, während sie versuchte, das versalzene Gebräu, das Stollos mürrischer Sprössling in dem Kessel angerührt hatte, in eine halbwegs genießbare Speise zu verwandeln.
König Oka von Wenz hatte Zukata öffentlich die Gefolgschaft aufgekündigt und seinen Austritt aus dem Kaiserreich erklärt. Ein wahnsinniges Unterfangen, das natürlich keinen Erfolg haben konnte, sondern nur zu weiterem Blutvergießen führen würde. Wenn jedoch Manina sich dazu gesellte und den verwitweten König ehelichte, würde diese Rebellion auf einen Schlag ein ganz anderes Gewicht erhalten. Andere Königreiche würden sich ihnen anschließen. Das Reich würde zerfallen, und irgendwann würde selbst Zukata die Lawine, die auf ihn zurollte, nicht mehr aufhalten können.
Was für eine unglaubliche Verschwendung, wenn Manina ihr Herz einem dahergelaufenen Reisenden schenkte, nur weil sie beobachtet hatte, wie die Sonne auf sein Gesicht fiel! Andererseits war das vielleicht das Leben, das sich die junge Frau wirklich wünschte. Ein Leben ohne Kriege, ohne Verhandlungen, Streitereien, die Verantwortung für Tausende … Ein Leben an der Seite des Geliebten, fernab von allem. Dem Krieg konnte man aus dem Weg gehen, wenn man nur wollte. Manina brauchte ihren wirklichen Namen nie wieder auszusprechen, sie konnte einfach tun, was sie wollte, leben, wie es ihr gefiel, sich ihr eigenes Schicksal gestalten. Sicherheit und Glück.
»Er ist da!« Aufgelöst stürmte das verliebte Mädchen in die Küche. »Du musst jetzt rausgehen, ich kann nicht! Er darf mich nicht sehen, nicht so!«
Maja wollte etwas sagen wie: Seit wann schämst du dich, im Gasthaus zu arbeiten? Sonst bist du doch immer so stolz darauf, dass du arbeiten kannst wie jeder andere auch. Aber sie blickte in das verzweifelte Gesicht ihrer Freundin und sah, dass es für kluge Sprüche nicht an der Zeit war. Sie musste aufpassen; am Ende führte diese Geschichte noch dazu, dass Manina ihre Identität preisgab, nur damit ein abgekämpfter Reisender sie nicht bloß für ein einfaches Schankmädchen hielt. Ehemals Kaiserin von Deret-Aif, Königin von Aifa, Erbin des Throns von Kirifas … und immer noch Prinzessin. Immer noch die Tochter des unvergessenen Kanuna El Schattik und Halbschwester von Zukata.
»Dann füll du die Suppe in die Teller. Sie müsste jetzt schmecken, hoffe ich. Wo ist das Brot?« Mit raschen Handbewegungen ordnete sie alles auf dem Servierbrett an. »Und wie erkenne ich deinen Schläfer?«
»Er ist der schönste Mann, den ich je gesehen habe«, stammelte Manina.
»Ja, sicher. Wenn es dich schon erwischen muss, dann auch richtig, wie? Wie sieht er aus, für Leute, die nicht völlig von Sinnen sind? Dunkel, groß, oder …?« Musste sie denn immer gleich an Sorayn denken, wenn es um den schönsten Mann der Welt ging? Schäm dich, Maja, rügte sie sich selbst. Das Herz taugt nicht, um jemanden zu beschreiben. Das Herz kann nur sagen: Dies ist er, den ich gewählt habe. Dies ist der, der mich verraten hat.
»Blond«, flüsterte die Kaisertochter. »Er ist blond. Er sitzt da hinten in der Ecke, unter dem schwarzen Balken. Du kannst ihn gar nicht verfehlen.«
Sie lächelte verzagt und ängstlich und doch von einem Glück beseelt, das sich nicht leugnen und verbergen ließ.
»Na, dann wollen wir uns den Auserwählten einmal ansehen«, sagte Maja, hob das schwere Tablett hoch und ging hinaus in die Stube.
Mit überlaufenden Krügen kam Stollo ihr entgegen. »Dort«, er bewegte den Kopf und wies damit in die hintere Ecke des Raumes, »der Mann wartet schon länger. Wo bleibt denn endlich das Essen?«
Maja drängte sich an ihm vorbei, ohne einen Tropfen Suppe zu verschütten. Sie balancierte ihre Last vor sich her durch eine mit gut aufgelegten Holzfällern besetzte Bankreihe. Den blonden Mann unter dem geschwärzten Balken sah sie erst, als sie fast vor ihm stand.
Die heiße Suppe spritzte über ihre Schuhe. Das Servierbrett fiel krachend gegen die Bank, der Teller rollte unter den Tisch. Aber sie stand da und konnte sich einen schrecklichen Moment lang nicht rühren. Als sie endlich an Flucht dachte – zwei, drei Atemzüge zu spät –, als sie sich umwandte und rennen wollte, war er schon bei ihr und packte ihr Handgelenk.
»Nun, Maja«, sagte er, und in der plötzlich entstandenen Stille, in der alle verwundert zu ihnen hinsahen, klang seine Stimme laut und deutlich, »wohin so eilig?«
»Lasst mich los«, zischte sie.
»Ganz recht, Finger weg von meinem Mädchen!«, blaffte Stollo.
Manina erschien an der Verbindungstür zur Küche.
Lass sie begreifen und verschwinden, betete Maja im Stillen, oh Rin, er darf sie nicht sehen …
»Rette sich, wer kann!«, schrie sie, so laut sie konnte. »Das ist Erion! Erion von Neiara!« Sie wollte Manina zurufen, dass sie fliehen sollte, dass sie so schnell wie möglich Tamait holen und mit ihm fortlaufen musste, aber sie wollte nicht Erions Aufmerksamkeit auf die Prinzessin lenken. Mit Sicherheit war er wegen Manina hier, irgendwie musste er erfahren haben, dass sie hier wohnte. Aber er hatte sie noch nicht erkannt, noch nicht bemerkt …
Mit schreckgeweiteten Augen starrte Manina zu ihnen herüber.
»Auf der Stelle, hab ich gesagt, Finger weg!« Stollo versuchte Maja von dem Angreifer wegzureißen. Sie flog in die Arme des Wirts, als Erion sie plötzlich losließ.
»Sie gehört mir«, erklärte er mit ruhiger, selbstbewusster Stimme, die verriet, dass er es nicht nötig hatte, um seine Beute zu kämpfen. Vielleicht sah er die Mordlust in den Augen des kräftigen Gastwirtes, in den Blicken der Holzfäller, die regelmäßig hier einkehrten, von denen mehrere drohend aufstanden, jedenfalls zögerte er nicht lange, schob seinen Ärmel hoch und zeigte ihnen das Zeichen, das er an seinem Oberarm trug: ein eingebranntes Z, darüber eine Krone. Mit Befriedigung nahm er zur Kenntnis, wie die Männer zurückwichen.
»Kaisergänger«, sagte Erion stolz. »Unterwegs im Namen des Kaisers. Ihr wisst, was das bedeutet. Ich erkläre diese Frau zu meiner Gefangenen.«
Zögernd öffnete Stollo seine Arme, und nun stand Maja da, auf einmal sehr allein, und wusste kaum noch, wen sie mehr bedauern sollte, sich oder ihn oder Manina.
»Was soll ich denn machen?«, fragte ihr Arbeitgeber leise und verzweifelt. »Ich würde für dich kämpfen, oh ja … Aber ein Kaisergänger?«
»Ist schon gut«, sagte die junge Frau. »Mach dir bloß keine Sorgen um mich.«
Obwohl ein paar Jahre vergangen waren, hätte sie Erion überall wiedererkannt. Die Schlacht um das Schloss von Neiara würde sie nie vergessen. Dort hatte sie mit ihrer Familie und der Kampftruppe ihrer Pflegemutter Alika gekämpft, gegen Erion und die Söldner, die er mitgebracht hatte. Dort an der schmalen Brücke am Abgrund. Sie hatte seinen Befehl zum Rückzug noch im Ohr, und auf immer hatte sich das Bild in sie eingeprägt, wie der schwer verletzte Hauptmann der Feinde versuchte, kriechend die Brücke zu erreichen, bevor sie hochgezogen wurde. Erion hatte keinen Augenblick lang auf ihn gewartet. Nie würde Maja vergessen, wie er als Unterhändler den Abzug seiner Männer vereinbart hatte. An seinen kalten Blick, seine Stimme, bei der ihr heute noch ein Schauder über den Rücken lief, so gefühllos, so leblos war sie ihr vorgekommen.
Manina, diese dumme, verliebte Prinzessin, stand immer noch da. Maja versuchte, nicht zu ihr hinzusehen. Sie musste doch endlich begreifen, in welcher Gefahr sie schwebte!
»Ich suche noch eine Frau«, sagte Erion. »Blond, mit auffällig blauen Augen.«
Unwillkürlich wanderten die Blicke der anderen Gäste zu der hübschen Küchenhilfe. Erion hielt einen Moment mitten in der Bewegung inne, überrascht, doch er hatte sich sofort wieder in der Gewalt.
Galant deutete er eine kleine Verbeugung an. »Ich muss auch Euch bitten, mich zu begleiten. Setzt Euch zu mir, meine Männer werden in Kürze hier eintreffen.«
»Das geht nicht!«, protestierte der Wirt unglücklich. »Meine Köchin und Flötenspielerin … mein Schankmädchen … Wer soll denn die Gäste versorgen?«
»Oh, ich bin sicher, wir werden alle zu gerne dem Flötenspiel der schönen Maid lauschen.« Erion verzog seinen Mund zu etwas, das fast wie ein Lächeln wirkte.
Manina trat vor ihn hin. Sie zwang sich, den Rücken gerade zu halten, den Kopf zu erheben, nicht an sein Gesicht im funkelnden Sonnenlicht zu denken.
»Lasst Maja frei«, sagte sie. »Ich werde mit Euch kommen, wenn Ihr sie hierlasst.«
Erion schüttelte den Kopf. »Nein«, sagte er einfach und zeigte deutlich, dass er nicht näher begründen wollte, welches Interesse er an Maja hatte, nicht hier und nicht jetzt. »Setzt Euch und wartet. Wenn meine Leute da sind, werden sie Euch begleiten, so dass Ihr noch einpacken könnt, was Ihr für die Reise braucht.«
»Die Reise?«, fragte Maja.
»Nach Kirifas«, antwortete er. »Wohin denn sonst. Dorthin, wo Ihr hingehört.«
Maja dachte darüber nach, ob sie aufstehen und rufen sollte: Seht her, das ist Prinzessin Manina, kämpft für sie! Aber niemand würde ihnen helfen, das wusste sie. Kaiser Zukata war nicht beliebt, doch niemand wagte es, sich seinen Kaisergängern zu widersetzen. Jeder, der das Zeichen des einstigen Räuberprinzen trug, durfte in diesem Reich tun, was er wollte, und hatte dabei Anspruch auf blinden Gehorsam.
Kopfschüttelnd drückte sie die Hand ihrer Freundin, als diese sich ergeben zu ihr auf die Bank setzte. Erion nahm ihnen gegenüber Platz und verlangte mit geradezu aufreizender Höflichkeit eine neue Suppe.
»Du hättest verschwinden können«, regte Maja sich auf. »Bei Rin, warum bist du nicht weggerannt?«
»Weshalb hätte ich fliehen sollen?«, gab Manina zurück. »Es gibt nichts, wessen ich mich schämen müsste.«
»Und da ist auch nichts, was Ihr zu fürchten hättet«, warf Erion ein. »Der Kaiser wird Euch in Ehren in seinem Palast empfangen.«
»Tatsächlich?«, fragte Maja.
»Wolltet Ihr nicht Flöte spielen, um die Gäste zu unterhalten?«, fragte er zurück. Das unzufriedene Gemurmel in der Gaststube hatte immer noch nicht aufgehört, zumal Stollo mit dem Bedienen kaum hinterher kam.
Wenn sie es wirklich gekonnt hätte, wäre jetzt die Zeit dafür gewesen, mit ihrem Spiel die Holzfäller so in Wut zu versetzen, dass sie sich auf den Kaisergänger stürzten. Aber die kleine Flöte, nach der ihre Finger tasteten – nirgends ging sie ohne sie hin –, vermochte keine Wunder zu bewirken. Sie ließ ihre Hände wieder sinken.
»Wie habt Ihr uns gefunden?«, wollte sie wissen. »Lässt Zukata ganz Deret-Aif nach Manina durchkämmen?«
»Zukata findet immer, was er sucht«, gab der blonde Mann zur Antwort. Mit einem freundlichen Nicken nahm er den Teller entgegen, den Stollo ihm reichte.
»Ich hoffe, er hat hineingespuckt«, zischte die junge Zinta wütend.
»Oh, ich hoffe nicht«, meinte Erion. »Wer einen Kaisergänger beleidigt, beleidigt den Kaiser selbst.«
Manina saß schweigend daneben, während die beiden miteinander redeten. Maja wurde immer wütender, bis sie schließlich glaubte, an ihren Gefühlen zu ersticken. Zu einem anderen Zeitpunkt hätte sie auf ihrer Flöte gespielt, um das, was in ihr brodelte, ins Lied hinauszulassen. Aber ihr Feind hatte sie gebeten zu spielen und sie wollte ihm keinen Gefallen tun. Zu nah war die Erinnerung an den Tag, an dem das Glück gestorben war. Dort auf den geliebten Inseln – der Weininsel, auf der ein blutiger Kampf getobt hatte, und der Apfelinsel, die zerstört zu ihren Füßen lag, als sie siegreich zurückgekehrt waren. Alles hatte das Mädchen verloren, durch Erion und seinen hinterhältigen Onkel Norha. Und nun hatte der Albtraum sie eingeholt, in der Gestalt dieses Mannes, der vor ihren Augen so gesittet speiste wie ein Fürst. Auf ihre Fragen antwortete er stets ausweichend, aber mit unerschütterlicher Gelassenheit. Er wirkte nicht wie jemand, der wütend werden und herumschreien konnte.
»Am meisten«, sagte Maja, »bedaure ich, dass ich Euch die erste Suppe nicht ins Gesicht geschüttet habe.«
»Oh, wie schade wäre das gewesen«, meinte er, »sie ist vorzüglich. Man schmeckt, dass Ihr von den Glücklichen Inseln kommt.«
»Ich habe nie vergessen, woher ich stamme«, sagte sie leise.
»Glaubt Ihr, ich?« Ein hochmütiges Lächeln bog seine Mundwinkel nach oben. »Wo ich doch der König von Neiara bin?«
Kaiser Zukata hatte die Inseln Neiara und Arima zum vierundzwanzigsten Königreich von Deret-Aif erklärt, das wusste sie seit langem, aber nicht, wer darüber regierte. Wie viele Scheußlichkeiten würde dieser Tag denn noch ans Licht bringen? Krampfhaft bemühte sie sich, Erion nicht zu zeigen, wie sehr es sie schmerzte, dass eine der Glücklichen Inseln ihm gehörte.
»Mehr hat Zukata Euch nicht anvertraut? Eine verbrannte Insel und ein schwarzes Schloss? Einen Felsen im Meer?«, höhnte sie, als hätte sie nicht alles dafür gegeben, wieder auf Arima zu sein und das Geld und die Macht zu haben, die Gärten wieder aufzubauen und neue Bäume zu pflanzen. »Mehr wart Ihr ihm nicht wert? Hat er nicht seine dreckigen Räuber zu Königen über Königreiche wie Torn oder Diret gemacht? Auch hier in Laring herrschen jetzt Verbrecher.«
Wenn sie bereit gewesen wäre, irgendetwas an ihrem Gegner bewundernswert zu finden, hätte sie ihm wohl Anerkennung dafür gezollt, wie gut er sein Gesicht in der Gewalt hatte. Nicht die kleinste Regung offenbarte, ob er sich getroffen fühlte, nur ihr Gespür verriet ihr, dass sie in gefährliches Gebiet eindrang.
Maja blieb erspart, mitzuerleben, wie ein dermaßen gefasster und beherrschter Mann wie Erion reagierte, wenn man seinen wunden Punkt gefunden hatte. Die Soldaten, die er versprochen hatte, polterten gerade in die Gaststube, aber ihr Blick wurde von Tamait abgelenkt, der gleichzeitig in der Verbindungstür erschien.
Sie schüttelte kaum merklich den Kopf, als sich ihre Blicke begegneten, als sie das Entsetzen in seinem Gesicht aufflammen sah. Nein. Keta, formten ihre Lippen, lautlos. Hol Keta.
Sie hoffte, dass er nicht so wie Manina einfach wartete oder, noch schlimmer, vorwärtsstürmte, um einen Kampf zu führen, den er nur verlieren konnte. Doch sie hatten genug miteinander durchgemacht; Tamait verstand sie und zog sich wieder zurück, und als die Soldaten ihren Herrn begrüßten und den beiden gefangenen Frauen abschätzende Blicke zuwarfen, war von ihrem Bruder nichts zu sehen.
»Hol Keta«, murmelte Tamait, während er aus einem Gebüsch heraus die Soldaten beobachtete. Sie hatten das kleine Haus, in dem er mit seiner Schwester und der Prinzessin gewohnt hatte, umstellt, während die Frauen sich drinnen aufhielten. Zwölf Soldaten. Er musste sie nicht zählen; er hatte sich um ihre Pferde gekümmert. Wenn es nur Erion gewesen wäre, hätte Tamait nicht gezögert. Er war sich sicher, dass er es mit diesem miesen Kerl aufnehmen konnte; Erion war kein begnadeter Fechter, das hatte Tamait selbst bei der Schlacht von Neiara miterlebt. Tamait dagegen war bei seiner Mutter in die Lehre gegangen, bei Alika, einer salinischen Amazone, einer der besten. Doch ein Dutzend Soldaten anzugreifen, war sinnlos. Für Keta wäre das kein Problem gewesen, aber der Riesenprinz war nicht hier; er konnte am anderen Ende des Kaiserreichs sein. Ihn zu suchen, half Maja und Manina kein bisschen. Es würde, selbst wenn der junge Mann rasch auf die bunten Wagen traf und Minos Aufenthaltsort erfuhr – und dass Mino wiederum wusste, wo Keta sich aufhielt, daran bestand kein Zweifel –, viel zu lange dauern. Kaisergänger hin oder her, Tamait glaubte nicht, dass die Ziehenden viel darauf gaben, wenn es um einen der Ihren ging. Ein paar starke Brüder aus der Sippe wären eine willkommene Unterstützung, aber bis er ein paar Helfer zusammengetrommelt hatte, waren die Gefangenen längst fort.
Hol Keta. Na wunderbar, Maja, dachte Tamait grimmig, während er beobachtete, wie seine Schwester und die Prinzessin aus dem Haus kamen, begleitet von zwei weiteren Soldaten und diesem aufgeblasenen Erion. Sie setzten die Mädchen zusammen auf ein Pferd. Manina sah aus, als würde sie überhaupt nicht begreifen, was vor sich ging, wie eine Schlafwandlerin starrte sie ins Nichts. Maja dagegen schimpfte wütend auf Erion, so laut, dass er sie mühelos verstehen konnte.
»Nach Kirifas!«, rief sie ein ums andere Mal aus. »Was um alles in der Welt soll ich da? Wenn Ihr alle Leute, die je gegen Euch gekämpft haben, einsammelt und nach Kirifas bringt, können wir ein wunderbares Wiedersehensfest dort feiern. Ist das wirklich Zukatas Wunsch, oder nehmt Ihr mich nur mit, weil es Euch gerade so passt?«
Kirifas. Was hatte sie sich gedacht – dass Tamait nun, da er wusste, wohin die Reise ging, darauf verzichten würde, ihnen zu folgen, und stattdessen irgendwie Keta herbeischaffte? Dass er hier warten sollte, bis Mino, Jamai und Kroa auftauchten, so wie sie es regelmäßig taten, und mit ihnen gemeinsam einen Befreiungsversuch unternehmen? Das klang vielleicht sogar vernünftig. Warte auf Verstärkung. Ihr werdet uns einholen, irgendwie, und bevor wir in Kirifas ankommen, schlagt ihr zu. Nur, Tamait schüttelte besorgt den Kopf, gab es keinerlei Garantie, dass Maja und Manina auf diesem langen Weg nichts geschah. Er konnte nicht so lange warten.
Sobald die Reiter verschwunden waren, schlüpfte er zwischen den Bäumen hindurch zum Haus. Sie hatten die Tür angelehnt gelassen. Seine Schritte knarrten über die Holzdielen, während er seinen Blick durch die kleine Stube wandern ließ, in der er und die beiden Mädchen miteinander gelebt, gekocht und gelacht hatten. Die Hütte besaß nur diesen einen Raum, doch daran waren die Geschwister gewöhnt, nachdem sie einige Jahre bei den Ziehenden gelebt hatten, bei denen es auch nur einen Wagen pro Familie gab. Sich ausbreiten konnte man draußen, im Wald – das war das Zimmer, das jedem gehörte, der es in Anspruch nahm, der sich wie ein König fühlen wollte in einem unermesslich großen Palast. Für ihre Zwecke hatte es gereicht, nur für Manina war es natürlich gewöhnungsbedürftig gewesen, dass ihr so wenig Platz zur Verfügung stand. Hier auf der Bank hatte er geschlafen; die Freundinnen hatten das Bett hinter dem Vorhang benutzt. Damit es kein Gerede gab, hatten sie Manina als seine Frau ausgegeben. Tamait hätte nichts dagegen gehabt, wenn es wirklich so gewesen wäre. Die Prinzessin rührte etwas in ihm an, eine Art Beschützerinstinkt. Bei Maja hatte er selten das Gefühl gehabt, sie verteidigen zu müssen. Gemeinsam hatten sie gekämpft, und wenn sie sich in die Gefahr stürzte – so hatte er es empfunden, als sie darauf bestanden hatte, mit Sorayn fortzugehen –, konnte und durfte er ihr nicht helfen.
Tamait seufzte, während er sich nach den Dingen umsah, die er mitnehmen wollte, und gleichzeitig ein Auge darauf hatte, was fehlte, was Maja dabei hatte. Vielleicht war es ihr gelungen, ein Küchenmesser einzupacken? Doch nein, die Messer staken noch alle im Holzblock. Vielleicht … Er trat auf den Vorhang zu und streckte die Hand aus, um ihn beiseite zu ziehen. Im selben Moment sprang ihm ein Angreifer entgegen und zielte mit dem Schwert nach seiner Brust.
Um ein Haar hätte es ihn erwischt. Er warf sich zurück, krachte gegen einen Holzschemel und stürzte. Der Soldat – jetzt sah er, dass es einer von Erions Leuten war – holte erneut aus. Er machte nicht viele Umstände, offensichtlich war er nur hier, um zu töten. Tamait rollte sich zur Seite, ergriff mit jeder Hand eins der abgebrochenen Beine des Hockers und sprang auf. Die Waffe traf auf das massive Holzstück; es wurde ihm aus der Hand geschlagen und fiel krachend gegen Töpfe und Pfannen. Tamait parierte den nächsten Schlag mit dem zweiten Stuhlbein, machte einen Satz rückwärts und griff sich eine schwere Eisenpfanne. Der Soldat, bisher mit schweigendem, unbeweglichem Gesicht, lachte auf. »Was soll das denn werden?«
Ein Krieger kann mit allem kämpfen, was zur Hand ist. Er erinnerte sich an diesen Satz aus dem Mund seiner Mutter, während sie einen Krieg mit Spaten und Hacken geplant hatte, bevor die Schwerter gekommen waren, die schönen, scharfen Schwerter, die Mino irgendwie organisiert hatte. Tamait würde diese Weisheit seinem Gegner schon beibringen. Der hatte sich den Falschen für seinen Mordversuch ausgesucht. Einen Krieger. Stollos Stallburschen und Rausschmeißer, doch diese Zeiten waren ab heute vorbei.
Die Bratpfanne diente ihm hervorragend als Schild, mit dem er jeden Hieb abwehrte. Tamait war sich jedoch darüber im Klaren, dass ihm noch etwas Besseres einfallen musste. Jemanden mit Küchenutensilien zu töten, war sicherlich möglich, aber der Soldat war stark; so schnell würde er sich nicht überwältigen lassen. Der junge Mann schleuderte ihm das Kochgeschirr an den Kopf, sprang noch einmal zur Feuerstelle zurück und griff sich die Eisenkette vom Haken, an der man sonst die Töpfe aufhängte. Er wickelte sie sich ums Handgelenk. Sein Gegner, nicht mehr ganz so stürmisch wie zu Beginn, beobachtete ihn misstrauisch. »Und das? Was wird das?«
Breitbeinig stand Tamait da, gut im Gleichgewicht, bereit zum Tanz. »Hat Erion dir nicht gesagt, wer ich bin?«, fragte er.
»Zukatas Feind«, antwortete der Soldat. »Das genügt.«
»Vielleicht hätte er dir etwas mehr über mich erzählen sollen«, sagte Tamait. »Hat er zum Beispiel erwähnt, dass ich Fischer bin? Und ich hatte schon ganz andere Fische an der Angel als dich.«
»Fischer?« Der Soldat blieb unbeeindruckt. »Dann werde ich jetzt dafür sorgen, dass …« Er wollte auf Tamait losstürmen, doch dieser flog mit einem Salto rückwärts durch die Tür, etwas, das er bei den Zintas gelernt hatte. Muschelsammler, Schwertkämpfer, Akrobat – der Arimer war schon immer ein sehr gelehriger Schüler gewesen.
Der Möchtegern-Mörder folgte ihm eilig nach draußen, um zu verhindern, dass sein Opfer in den Wald entkam. Genau dies hatte Tamait beabsichtigt. In der engen Hütte konnte er die Kette nicht so als Waffe benutzen, wie ihm vorschwebte, doch hier war genug Platz, um sie über sich kreisen zu lassen, und kaum war der Soldat bis auf wenige Schritte an ihn herangekommen, wickelte sich die Eisenkette pfeifend um seinen Arm. Mit einem Ruck riss der junge Mann ihn zu Boden, wich dem Schwert aus und vollführte eine weitere Drehung, schon fast tänzerisch. Es gab ein hässliches Geräusch, als der Knochen brach. Der Angreifer schrie qualvoll auf.
Tamait trat auf das Schwert.
»Woher«, fragte er, »wusste Erion, wo wir sind? Er hat uns nicht zufällig gefunden, hab ich recht?«
Es brauchte nur eine winzige Bewegung, um dem Soldaten unerträgliche Schmerzen zuzufügen. Die sonst so freundlichen Augen des Arimers funkelten hart und mitleidslos.
»Zukata ließ überall suchen, nach … nach dem Mädchen … Gasthaus am Weg … oh verdammt!«
»Was hat er mit ihr vor?«, wollte Tamait wissen.
»Kirifas«, stöhnte der Verletzte.
»Er soll sie wirklich nach Kirifas bringen? Zukatas Schwester? Das bezweifle ich irgendwie … Und Maja? Warum hat er auch das andere Mädchen mitgenommen, das schwarzhaarige?«
Er hatte einmal zu fest an der Kette gezogen. Der Schmerz stürzte den Mann in eine Ohnmacht, in der er keine Fragen mehr beantworten konnte.
Leise fluchend untersuchte Tamait seine Taschen, aber nichts gab darüber Aufschluss, was Erion tatsächlich plante. Er nahm das Schwert an sich, fand das Pferd des Soldaten etwas weiter vom Haus entfernt angebunden und ritt zum Silbernen Krug, wo Stollo und sein Sohn dabei waren, die Gaststube aufzuräumen und das Chaos zu beseitigen, das die unverschämten Besucher hinterlassen hatten.
»Da bist du ja endlich!«, rief Stollo aus, als er ihn sah. »Komm, pack mit an!«
»Tut mir leid«, entgegnete Tamait, »aber ich kann nicht, ich muss ihnen nach.«
Der Wirt nickte, runzelte jedoch besorgt die Stirn. »Er ist Kaisergänger, mein Junge, da kann man nichts machen. Und selbst wenn er sämtliche Frauen und Mädchen des Dorfes mitgenommen hätte, was will man tun? Wenn wir ihm nicht gehorcht hätten, du kannst dir vorstellen, was dann passieren würde. Zukata würde noch mehr Männer schicken, sie könnten das ganze Dorf …«
»Ich weiß doch. Niemand macht dir Vorwürfe. Und trotzdem muss ich ihnen nach.«
Geh, sagten Stollos Augen. Verschwinde lieber, bevor jemand merkt, dass ich mit einem rede, der sich gegen Zukata stellt, der sich traut, einen Kaisergänger und seine Männer zu verfolgen, einen, der nicht klein beigibt. Geh bloß, bevor ich dran bin.
»Zwei Dinge noch. Vor unserer Hütte liegt ein Soldat mit einem gebrochenen Arm, der vielleicht in Kürze aufwacht. Vielleicht solltet ihr mal nach ihm sehen. Und dann werden demnächst drei Reisende hierherkommen und nach uns fragen. Bitte erzähl ihnen alles, was hier vorgefallen ist. Wir sind auf dem Weg nach Kirifas.«
»Drei Reisende«, wiederholte Stollo. »Tamait, das hier ist ein Gasthaus. Wie soll ich denn da bloß die Richtigen erkennen?«
»Das ist nicht schwer«, sagte der Arimer. »Einer ist ein Zinta mit brauner Haut. Dann ist eine Frau mit weißem Haar dabei. Und der Dritte ist ein Zwerg.«