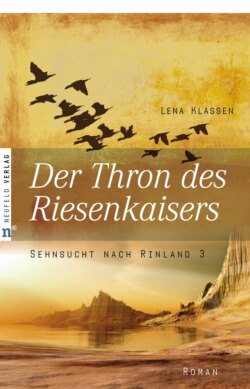Читать книгу Der Thron des Riesenkaisers - Lena Klassen - Страница 18
7. Die Last auf den Schultern
ОглавлениеD I ES O L D A T E NH A T T E NSorayn einen Strick um die Handgelenke geschlungen und führten ihn daran hinter sich her. Mit Leichtigkeit hätte er ihn zerreißen können, doch natürlich tat er es nicht. Dafür war es noch zu früh. Erst musste er sehen, wohin sie ihre Gefangenen verschleppten, was mit denen geschah, die aus ihren Sippen herausgerissen wurden, um einem fremden Fürsten zu dienen.
Zunächst brachten sie ihn zu einem unerwartet großen Haus am Waldrand. Ein Kampf der Sippenbrüder hätte, so sah Sorayn nun, keine Chance gehabt. Hier waren mindestens dreißig oder vierzig Männer untergebracht. Im angrenzenden Stall hörte er ihre Pferde stampfen. Vor dem Gebäude lungerten ein paar gelangweilte Kerle herum.
»Wen bringt ihr denn da mit?«, rief einer, der ihnen mit aufgerissenen Augen entgegensah. »Da habt ihr euch einen Burschen gekrallt, wie?«
»Zinta«, sagte der Soldat, der die Leine hielt, verächtlich.
»Ach, werden die so groß?«
»Die gibt es in allen Größen, glaub mir.« Sie redeten über ihn, als hätten sie im Garten ein besonders beachtliches Exemplar einer Gemüsesorte gefunden. Keine außergewöhnliche Spezialität, die man auf den Tafeln der Reichen finden würde, sondern etwas Schlichtes, nahrhaft und kräftig, für das einfache Volk.
Der Mann trat näher und befühlte Sorayns Oberarm. »Dafür wird Pidor uns ein Fass öffnen lassen.«
»Fürst Pidor?« fragte Sorayn. »Nie gehört. Ist er schon lange im Amt?«
»Du, ich glaube, der dreckige Zinta redet mit uns.«
»Das scheint mir auch fast so.« Sie musterten ihn aus zusammengekniffenen Augen. Wahrscheinlich ließ seine Größe sie davor zurückschrecken, ihn zu misshandeln. Obwohl sie ihn für sicher gefesselt hielten, ließ der Soldat, der schon den Arm zum Schlag hob, die Hand wieder sinken.
»Fürst Pidor hat es nicht gern, wenn sie beschädigt sind.«
»Wo bringen wir ihn diese Nacht unter? Heute schaffen wir es nicht mehr bis zum Fluss.«
Der andere zeigte auf den Stall. »Da, wo sonst? Glaubst du, ich schlafe mit einem Ziehenden unter einem Dach?«
Bei jeder abfälligen Bemerkung, bei jeder Beschimpfung war Sorayn froh, dass er hier war und nicht einer aus der Sippe. Toris hätte sich wahrscheinlich schon längst brüllend auf sie gestürzt, und einen der jüngeren Brüder hätten sie bestimmt schon zusammengeschlagen, wenn er sich empört gewehrt hätte. Der Riesenprinz ließ sich dagegen ohne Gegenwehr zu den Pferden schubsen, die ihn neugierig beäugten. Zwischen ihnen an einen Pfahl gebunden, verbrachte er die Nacht. Der warme Geruch der Tiere lullte ihn ein, ihr Schnauben und Stampfen, war sein Schlaflied. Lang ausgestreckt lag er im Stroh und fühlte die trägen Gedanken der freundlichen Stallbewohner durch seinen Geist treiben. Grüne Wiesen erstreckten sich vor ihm, Apfelbäume lockten mit duftenden roten Früchten. Süßer Hafer füllte seinen Mund, duftendes Heu, würzig, mit vielen Kräutern durchmischt, war sein Kissen.
»He!« Ein derber Fußtritt weckte ihn. »Aufstehen, es geht los!«
Sorayn gähnte, setzte sich auf und merkte, dass er gar nicht mehr gefesselt war. Im Schlaf musste er den Strick aus Versehen zerrissen haben. »Oh, Verzeihung. Der schöne Strick.« Er fuhr sich mit den Fingern durchs Haar und zupfte sich Strohhalme von der Kleidung.
»Komm, wird’s bald?«
»Ohne Frühstück?«, hakte er nach.
»Aufstehen!«, bellte der Soldat. »Gegessen wird erst nach der Arbeit!«
Trotz seiner intensiven Träume davon, was Pferde glücklich machte, hatte der junge Prinz keinerlei Appetit auf Heu und Gras. »Nicht einmal eine Tasse Tee? Schön heiß?«
Seine gute Laune schien den Mann glauben zu machen, dass er es mit einem Schwachsinnigen zu tun hatte. »Noch mal schön langsam: Du – jetzt – aufstehen! Gehen. Arbeiten. Dann essen. Kapiert?«
»Wird man so, wenn man in Fürst Pidors Diensten steht? Dass man nicht mehr die einfachsten Sätze zustande bringt? Welch bedauerliches Schicksal.«
Er rappelte sich auf und streckte sich. Mit Befriedigung nahm er zur Kenntnis, dass der Soldat einige Schritte zur Seite wich und unwillkürlich nach seinem Schwert griff. Auch wenn Sorayn nicht wie ein Riese aussah, war er immer noch größer als jeder andere hier. Nun, sollten sie sich ruhig von seinem freundlichen Auftreten täuschen lassen.
»Du läufst.« Sein Bewacher sattelte eins der Pferde, machte aber keinerlei Anstalten, den vermeintlichen Zinta noch einmal zu fesseln. »Und vergiss nicht: Du gehörst jetzt dem Fürsten. Weglaufen nützt gar nichts. Du bist zu Fuß, wir sind beritten. Bis jetzt haben wir noch jeden erwischt, der es versucht hat.«
Wenn man freiwillig gefangen war, konnte man dazu nicht viel sagen. Er hatte nicht vor zu fliehen. Wenn er genug gesehen hatte, würde er einfach wieder gehen. Sollten sie ruhig versuchen, ihn aufzuhalten!
Der Weg führte durch einen lichten Wald, in dem der Herbst bereits Einzug gehalten hatte. Ihre Schritte raschelten durch Unmengen von Blättern, und es roch nach Moder und Pilzen. Sehnsüchtig dachte Toris’ Schwiegersohn an die Gemeinschaft der Ziehenden, die nun ohne ihn das Land durchquerten und vielleicht gerade jetzt um ein Feuer saßen und miteinander schwatzten. Vielleicht brieten sie Eier und Pilze zum Frühstück, garniert mit Kräutern.
»Dort ist der Rianang«, sagte der Soldat stolz.
Und Sorayns gelöste Stimmung fiel von ihm ab wie ein goldenes Herbstblatt.
Am Ufer schufteten Menschen. Etwa zwei Dutzend Arbeiter wankten dort mit gebeugtem Rücken unter der Last riesiger Säcke. Eine niedrige Mauer hatten sie daraus bereits errichtet.
»Was tun sie da? Bauen sie einen Deich? Wozu?«
Der Zinta-Verächter ließ sich ausnahmsweise dazu herab, ihm Auskunft zu geben. »Weil der Fürst es angeordnet hat. – Heda! Schau, was ich hier habe!«
Der Aufseher, der sie bemerkt hatte und ihnen entgegentrat, unterzog den Neuen einer kurzen Musterung und nickte zufrieden. »Mit wie viel Nachschub können wir noch rechnen?«
»Ein oder zwei Wagenkolonnen müssten noch bei uns durchkommen, bevor der Winter beginnt.«
»Das ist zu wenig. Ich brauche mehr Leute. Ein Mann von jeder Sippe ist nicht genug. Bringt mir jeden, der mit anpacken kann, ist das klar?«
Der Soldat verzog das Gesicht, aber er nickte. »Du wirst doch dem Fürsten mitteilen, wie gut wir die neuen Arbeiter auswählen?«
»Natürlich«, versprach der Aufseher kühl. Er war ein kleiner, hagerer Mann mit wenig Haaren. »Und jetzt muss ich weitermachen.« Er winkte Sorayn mit einer kaum sichtbaren Kopfbewegung, mitzukommen.
»Da liegen die Säcke. Die Weiber befüllen sie, du wirst sie mit den anderen Männern ans Ufer bringen.«
Obwohl sie jetzt am frühen Morgen gerade erst mit der Arbeit angefangen haben konnten, wirkten die Frauen an der Sandbank erschöpft. Eine von ihnen hätte vom Alter her seine Großmutter sein können, sie erinnerte den Prinzen an Liravah. Mit langsamen, gleichmäßigen Bewegungen schaufelte sie den Sand in einen Sack, den ein kleines Mädchen offen hielt.
»Dich hat uns Rin geschickt«, sagte einer der zerlumpten Männer, der sich gerade einen frisch gefüllten Sack auf den Rücken lud. »Jetzt geht es hoffentlich etwas schneller.«
Nicht alle waren Zintas. Einige von ihnen gehörten unzweifelhaft zum Ziehenden Volk; ihre braune Haut, ihre dunklen Augen und ihr schwarzes Haar wiesen sehr stark darauf hin. Falls diese Ähnlichkeit zufällig war, mussten sie jedenfalls trotzdem damit rechnen, als der letzte Abschaum behandelt zu werden. Andere Gefangene jedoch, wie die grauhaarige Frau und ihre blonde Enkelin, kamen wahrscheinlich aus dieser Gegend.
»Warum seid ihr hier?«, fragte Sorayn, während er sich gleich zwei Säcke griff. »Was ist das für ein Fürst, dieser Pidor?«
»Sehr hohe Steuern verlangt er«, antwortete die alte Frau und seufzte laut. »Nicht jeder kann sie zahlen.«
»Sag ihm nichts«, rief die Arbeiterin neben ihr. »Vielleicht ist er geschickt worden, um uns auszuhorchen.«
Sorayn trug die Säcke zu der langsam wachsenden Mauer und wuchtete sie obenauf. Er sah am Flussufer entlang. Der Rianang grub sich hier in einer langen Krümmung ins Land hinein. Man konnte sich gut vorstellen, dass es hier Überschwemmungen gab, sobald die Herbststürme begannen.
»Ist das Dorf sehr nah?«, fragte er.
Einer der Männer schnaubte durch die Nase. »Das Dorf? Welcher Idiot würde so nah am Fluss ein Dorf anlegen? Der Fürst hat dort hinter der Biegung sein Domizil. Die Dörfer liegen höher.«
»Still«, warnte ein braunhäutiger, glutäugiger Bursche. »Nichts über den Fürsten, zu niemandem! Haben wir nicht schon genug Ärger?«
»Von welcher Sippe bist du?«, erkundigte sich Sorayn.
»Warum fragst du? Was kümmert dich das Ziehende Volk? Sie haben uns gesagt, sie würden einen Zinta bringen, aber du bist keiner von uns.«
»Ich habe gesagt, sie würden uns aushorchen lassen«, warnte ein dritter Mann. »Lasst euch bloß zu nichts hinreißen.«
Sorayn schüttelte besorgt den Kopf. Zintas waren normalerweise nicht ängstlich. Sie gaben nichts auf Könige und andere Würdenträger, hatten nur Spott übrig für ihre Gesetze und ihre Macht; normalerweise fürchteten sie sich nicht davor, alles auszusprechen, was ihnen in den Sinn kam. Auf den Märkten verhöhnten Puppenspieler und Liedermacher die Mächtigen, ohne sich darüber Sorgen zu machen, dass sie dafür im Kerker landen könnten. Welcher Landesherr hätte sich eine Blöße gegeben, indem er sie ernstnahm? »Wer dem Sänger auf den Mund schlägt, wird schon wissen, warum«, hieß es. Und wenn jemand doch seine Soldaten schickte, waren sie schon wieder weitergezogen.
»Wie lange seid ihr schon hier?«, fragte der Riesenprinz. Er versuchte zu erkennen, wie weit die aus Sandsäcken aufgestapelte Mauer reichte.
»Seit dem Frühling.«
»Sag ihm nichts!«, fuhr der andere dazwischen, doch der Erste starrte Sorayn herausfordernd an.
»Seit dem Frühling«, wiederholte er. »Aber für mich ist es, als wären meine Fußknöchel gebrochen und als würde die ganze Welt ohne mich weiterwandern. Wird es für dich auch so sein, wer auch immer du bist? Mein Rücken schmerzt und ich kann mich kaum aufrichten, aber es sind meine Füße, die wehtun, weil ich nicht fortgehen kann.«
»Warum nicht?«, fragte Sorayn. »Warum bist du nicht geflohen? Deine Sippe ist längst weit fort und in Sicherheit. Keiner der Soldaten wird dich von dort zurückholen. Da ist der Fluss. Es wäre ein Leichtes, sich hineinzuwerfen und wegzuschwimmen. Warum bist du noch hier?«
Die beiden Männer sahen sich an.
»Er wüsste es, wenn Pidor ihn geschickt hätte«, sagte der Zinta.
»Was wüsste ich?«
»Wir können nicht fliehen. Für jeden, der es versucht, muss einer der anderen dran glauben.«
»Was?« Er starrte seinen Mitgefangenen an, der Sandsack glitt ihm vom Rücken. »Da fehlen mir die Worte.«
»So ist es«, sagte der junge Ziehende. »Was meinst du, weshalb wir keine Fesseln tragen? Dort hinten sind die Soldaten. Einer könnte möglicherweise an ihnen vorbei, vielleicht, wenn er viel Glück hat, sich sogar ein Pferd schnappen … Aber wer wird für ihn sterben? Die Frauen an der Sandbank tragen Fußfesseln.« Er schüttelte den Kopf. »Glaubst du immer noch, es wäre so einfach?«
Der Aufseher stolzierte auf sie zu, in der Hand etwas, das wie eine Reitgerte aussah. »Weitermachen! Was starrst du in die Luft?«
Sorayn hörte ihn gar nicht. Er sah zu den Frauen hinüber, von denen keine es wagte, aufzublicken und die Aufmerksamkeit des Hageren auf sich zu ziehen.
»Nimm den Sack, schnell!«, zischte der Zinta hinter ihm. »Wenn du dir Ärger einhandelst, bekommen wir alle nichts zu essen.«
Der junge Riese bückte sich und schleppte den schweren Sandsack zum Deich, und auch er vermied es, das dürre Männlein mit einem Blick aus seinen zornigen Augen herauszufordern. Die Wut begann bereits in ihm zu kochen, aber immer noch hatte er sich in der Gewalt.
Gegen Mittag gab es einen dünnen Getreidebrei, dem weder Salz noch Honig beigefügt worden waren. Danach arbeiteten sie bis zum Abend. Bei Anbruch der Dunkelheit wurden sie in einem Schuppen eingeschlossen, in dem sie sich aus Haufen von Stroh ihre Nachtlager bereiten konnten.
»Sag mir deinen Namen, Bruder«, forderte Sorayn den Zinta auf, neben dem er sich einen Platz im Stroh wählte.
»Ich bin nicht dein Bruder. Schweig still. Wenn der Wachsoldat draußen hört, dass wir reden, bekommt jeder einen Schlag auf den Rücken.«
»Jeder?«
»Jeder. Hast du es noch nicht begriffen? Wir werden immer alle bestraft.«
»Welches dunkle Herz hat sich dies alles ausgedacht«, flüsterte Sorayn. »Und doch bin ich dein Bruder. Ich suche Maja, meine Frau, eine Zinta.«
Der andere sog scharf die Luft ein.
»Der Name sagt dir etwas? Ich kann kaum glauben, dass ihr die Namen von allen aus den vielen Sippen kennt.«
»Manche Namen«, flüsterte der Ziehende, »kennt jeder von uns. Jetzt weiß ich, wer du bist. Aber das ändert überhaupt nichts. Du gehörst nicht zu meinem Volk. Du hast gegen Remanaine gekämpft, und der ist einer von uns.«
»Ich bin nicht sein Feind. Wenn du so vieles weißt, solltest du auch das wissen.«
»Schweig endlich still! Wenn du nur ein Quäntchen Mitgefühl hast, sprich nicht so viel mit mir. Denn falls du doch daran denkst zu fliehen, möchte ich ungern derjenige sein, den sie umbringen.« Der Zinta drehte ihm demonstrativ den Rücken zu, doch vielleicht spürte er Sorayns bohrenden Blick, denn er seufzte leise und erzählte so leise, dass er kaum zu verstehen war, von der letzten Flucht.
»Das war einer, der den Fürsten irgendwie beleidigt hatte. Hatte ihn einen Banditen genannt und wurde dafür hier zu uns geschickt. Der Mann hielt sich für besonders mutig, so wie du, und hat sich gewundert, warum wir gehorchen, warum keiner sich traut, wegzulaufen. Ihm waren die anderen gleichgültig, er hat mit kaum jemand geredet. Mit mir ein paar Mal, mit einem anderen Kerl zuweilen. Als er geflohen ist, haben die Soldaten den anderen Gefangenen ausgewählt. Sie hätten auch mich nehmen können, weißt du? Aber ich hatte Glück.«
»Wie ist er gestorben?« Nur noch das eine wollte er wissen.
»Zu Tode geprügelt haben sie ihn. Hier vor uns allen. Sogar das Kind musste zusehen.«
Sorayn starrte in die Dunkelheit.
»Frag mich nicht nach meinem Namen. Sonst rufst du mich damit und sie denken, ich wäre dein Freund. Fragen kannst du mich, wenn du dich damit abgefunden hast, dass du hier bist. Für immer.«
»Ich bin nicht hergekommen, um zu bleiben.«
Der Zinta antwortete ihm nicht. Und der Riesenprinz lag lange Zeit da und spürte die schwere Müdigkeit in seinen Knochen, das ungeduldige Knurren seines Magens, und die Wut, die in seinem Herzen aufbrannte und seinen ganzen Körper in Flammen stehen ließ.
Mehrere Tage, während er Sandsäcke schleppte, sich mit dem schlechten Essen zufriedengeben musste und sein Hunger immer größer wurde, grübelte er darüber nach, wie er der ganzen Gruppe zur Freiheit verhelfen konnte. Der junge Zinta versuchte eine Weile, den Neuen mit ausdauerndem Schweigen dazu zu bewegen, seine Gedanken für sich zu behalten, aber schließlich zermürbten ihn die hartnäckigen Fragen und er wandte sich seinem unbelehrbaren Mitgefangenen ärgerlich zu.
»Was glaubst du, wie es für den Aufseher aussieht, wenn du pausenlos auf mich einredest? Als würdest du versuchen, mich zu etwas zu bringen, was ich nicht will. Was das wohl sein könnte?«
»Und er hätte recht«, sagte Sorayn. »Natürlich möchte ich, dass du fliehst. Ich will, dass wir alle gemeinsam die Flucht wagen.«
»Vergiss es.«
»Warum? Nur so können wir verhindern, dass jemand stirbt.«
»Sie werden nicht mitkommen. Wohin auch? Wohin würdest du sie führen?«
»Wo es besser ist.«
»Ach, und wo soll das sein?«
»Ich weiß nicht. Auf meinem Weg mit der Sippe sind wir durch viele schöne Gegenden gekommen.«
Sie waren beide lauter geworden. Hastig senkte der erfahrenere Arbeiter die Stimme. »Und dort willst du diese Leute hinbringen? Von denen einige so alt sind, dass sie kaum gehen können? Während uns vierzig Soldaten auf den Fersen sind, beritten und bewaffnet?«
»Wir nehmen die Pferde.«
»Ach, dass ich darauf nicht gekommen bin! Natürlich, wir nehmen die Pferde. Abgesehen davon, dass manche von diesen armen Leuten noch nie geritten sind, ist das ja kein Problem. Wir reiten einfach fort. Falls wir an der Landesgrenze aufgehalten werden, lässt man uns bestimmt einfach durch, wenn wir erklären, was wir wollen. Und irgendwann kommen wir in einem Land an, in dem alle freundlich sind und wo es nichts ausmacht, dass wir nichts besitzen und manche alt und krank sind. Wo man uns Häuser zur Verfügung stellt und wir Brot satt zu essen haben. Vielleicht auch noch Braten und Wein?« Er stieß die Silben hervor, kaum fähig zu sprechen, den schweren Sack auf dem Rücken, aber er war jetzt in Fahrt und hörte nicht auf.
»Willst du nicht zu deiner Sippe?«
»Fragt der Kerl mich doch glatt, ob ich zu meiner Familie will! Du bist ein wahrer Familienmensch, wie?« Der Zinta funkelte ihn an. Er warf seine Last mühsam ab und bohrte dem großen, starken Neuen den Zeigefinger in die Brust. »Ich werde dir sagen, was du bist. Du bist ein Idiot. Du bist der dümmste Mensch, der mir je begegnet ist. Und jetzt tu deine Arbeit und lass mich in Ruhe.«
Sorayn hatte gedacht, dass der Schmerz ihn verlassen hatte, doch er war da, ein Schmerz, der immer zu ihm gehören würde. Du Idiot … Seht her, den Idioten, was für ein Schauspiel!
Warum hatte er nicht jemand anders in die Gefangenschaft gehen lassen? Einen dieser heißblütigen Burschen, die für Stolz und Ehre lebten? Sie hätten, sobald sie durchschaut hatten, wie es hier zuging, die gleiche Wahl getroffen wie sein Mitgefangener. Man ließ andere nicht für sich sterben. Selbst wenn man in den Staub gedrückt wurde, konnte man den Kopf hoch erhoben tragen, solange man sich nur als Beschützer der Schwachen verstand. Aber er konnte nicht bleiben. Und es stimmte, er konnte alle diese Menschen nicht mitnehmen. Trotzdem musste er es wenigstens versuchen. Er konnte doch nicht zulassen, dass sie hier lebten und unter der Last ihrer Arbeit wankten, er konnte doch nicht …
Sorayn schuftete wie ein Tier. Er schleppte die Säcke so eilig, dass die Frauen kaum hinterherkamen damit, sie zu füllen. Der Deich wuchs in die Höhe und in die Länge wie eine mächtige Schlange, die sich neben den Fluss legte. Manchmal sah er hinaus auf das Wasser und sehnte sich danach, den Schmerz zu kühlen, so wie früher. Sich den Staub abzuwaschen von der Haut, den Sand aus den Augen zu reiben, und darauf zu warten, dass alles, was ihn quälte, weggespült wurde.
Oft sah er den Frachtkähnen zu, die an ihm vorbeizogen, flussabwärts zum Meer, zur Laringer Bucht, flussaufwärts nach Torn und Aifa. Vielleicht war das eine Möglichkeit. Alle Gefangenen auf ein solches Schiff zu bringen und aus der Reichweite der Soldaten zu entkommen. Aber die meisten konnten nicht schwimmen. Sie konnten gar nichts – nicht reiten und nicht schwimmen und sich nicht wehren. Niemand gab dem lächerlichen kleinen Aufseher Widerworte, und Sorayn, der ein einziges Mal seine Zunge nicht im Zaum halten konnte, war mit einem Hungertag für sie alle bestraft worden, genau wie der Zinta gesagt hatte. Das Kind, ein Mädchen von acht oder neun Jahren, hatte sich weinend an seine Großmutter gekuschelt, und er hatte sich geschämt.
»Auf die Knie!« Ein paar Soldaten preschten auf ihren Pferden am Flussufer entlang und trieben die erschrockenen Arbeiter zusammen. »Der Fürst kommt, um den Deich zu besichtigen.«
Pidor, ein schon älterer Mann mit grauem Haar, kam sehr langsam und sehr hochnäsig angeritten, ohne die Gefangenen überhaupt zu beachten. Seine Aufmerksamkeit galt dem Rianang.
»Schon fast fertig!«, rief er erfreut aus, während er den Deich in Augenschein nahm. »Dann können die Stürme kommen, wir fürchten sie nicht.«
»Es ehrt uns, dass alles zu Eurer Zufriedenheit ist«, sagte einer seiner Begleiter.
Der Adlige musterte die Gefangenen. Sorayn hätte sich dazu zwingen müssen, demütig den Kopf zu senken, aber er konnte nicht, und so trafen sich ihre Blicke, und Fürst Pidor zuckte zurück.
»Ein Neuer?«, bemerkte er leichthin.
»Und der Grund, warum wir so schnell fertig wurden.« Der hagere Aufseher drängte sich nach vorne, um auch etwas vom Lob abzubekommen. »Der arbeitet für drei, aber es ist hartes Brot, ihn zu beaufsichtigen.«
»Dann achtet gut auf ihn, dass er nicht abhanden kommt. Den will ich für meine Mühle. Und wenn er einen Fluchtversuch macht, sterben drei. Hört ihr? Zwei von dem Lumpenpack und einer von euch Soldaten. Also bewacht ihn gut.«
»Ja, Herr.«
Der junge Riese merkte, wie die Wachen näher an ihn heranrückten.
»Drei«, wiederholte der Fürst mit leisem Lachen, und der Schmerz in Sorayns Brust schien förmlich zu explodieren.
Er stand auf. »Weiß der Kaiser eigentlich, was hier läuft?«
»Wie?« Pidor hob pikiert die Brauen und wandte sich an den Mann mit der Gerte. »Wissen deine Leute nicht, dass sie mich nicht anzusprechen haben?«
»Runter!«, bellte dieser und versetzte dem aufsässigen Neuen einen Schlag auf den Rücken, der jeden Menschen in den Staub gezwungen hätte.
»Was würde Zukata sagen, wenn er wüsste, was hier geschieht?«, fragte Sorayn, ohne auf die Prügel zu achten. »Und er wird es erfahren, dafür werde ich sorgen.«
Der Fürst beugte den Oberkörper zurück, als der unverschämte Gefangene die Zügel seines Pferdes ergriff. »Wachen!«, kreischte er.
Sorayn griff hinter sich und entriss dem Aufseher die Peitsche. Er zog sie dem Fürsten übers Gesicht, während die Soldaten schon heranstürmten.
»Die Fürsten unterstehen den Königen«, sagte er. »Und die Könige dem Kaiser. Wie kannst du dir erlauben, deine Untertanen so zu behandeln?« Doch schon richtete sich ein Dickicht von Schwertern und Speeren auf ihn und grobe Hände fassten nach ihm.
»Bringt ihn nicht um!«, rief Pidor und befühlte seine Wange, auf der ein roter Streifen aufbrannte. »Den will ich lebend. Den brauche ich für die Mühle.« Er schnaufte. »Habe ich nicht gesagt, ihr sollt auf ihn aufpassen? Bringt ihn in die Mühle. Schmiedet ihn ans Rad. – Du dachtest wohl, du könntest deinem Schicksal entgehen? Dachtest, ich würde es gleich hier und jetzt beenden, wenn du mich reizt? Das haben schon andere versucht. Du wirst nicht sterben. Du wirst so lange leben, wie ich dich leben lasse.« Er blickte über die übrigen Arbeiter hin, die sich ängstlich wimmernd vor ihm beugten. »Ihr wollt euch beim König beschweren? Vielleicht gar beim Kaiser? Ha! Versucht das doch! Ich bin der Herr dieses Landes. Und wie überall in ganz Deret-Aif werden hier die Gesetze des Kaisers aufs Sorgfältigste befolgt.«
»Das kann nicht sein.« Der Riesenprinz hatte das Gesicht des Fürsten die ganze Zeit über beobachtet. Er wollte die Zeichen von Angst und Unsicherheit nicht verpassen, wenn er den Tyrannen daran erinnerte, dass der Kaiser Rechenschaft von ihm fordern könnte. Doch entgegen seiner Erwartung bekam er weder ein Erbleichen zu sehen noch hörte er das geringste Zittern in der Stimme des grausamen Fürsten. Dieser war sich einfach zu sicher, dass weder König noch Kaiser ihn bestrafen würden. »Das darf Zukata nicht zulassen!«
Sorayn fühlte kaum die scharfen Spitzen der Schwerter, die sich ihm durch seine schäbige Kleidung hindurch in die Haut bohrten. Das Beben, das ihn durchfuhr, das ihm den Schmerz zurückbrachte, fühlte sich an, als würde es ihn auseinanderreißen. Er war kurz davor, sich auf seinen Gegner zu stürzen und die Hände um seinen Hals zu legen – und ihm zu zeigen, was es hieß, in einer Welt des Schmerzes zu leben.
Aber seine Wut galt nicht nur Pidor. Zukata war es, der den kleinen Fürsten solche Macht gegeben hatte, der Schrecken und Leid über die einfachen Menschen gebracht hatte. Zukata hatte dies zu verantworten. Zukata – und Sorayn selber. Wie hatte er einem Räuber und Entführer nur den Thron überlassen können, ihm gestatten, ungehindert nach Kirifas zu ziehen! Gerecht und weise wie Kanuna – hatte er wirklich geglaubt, der böse Riese könnte diesen Anspruch erfüllen?
Er musste nach Kirifas. Sofort. So konnte es nicht weitergehen. Er hatte vermeiden wollen, dass einer seiner Mitgefangenen getötet wurde, und war deshalb zu lange geblieben. Nun waren es schon drei, die für ihn sterben würden. Aber hatte er eine Wahl? Wenn er Zukata nicht aufhielt, würden noch viel mehr Menschen sterben.
»Sehe ich Mord in deinen Augen?«, fragte Pidor munter. »Der Kaiser darf tun, was ihm beliebt. Und wenn er der Ansicht ist, dass ihr dreckigen Zintas die Flöhe im Pelz seiner Untertanen seid, dann gebe ich ihm recht. Genau das seid ihr. Und jetzt schafft ihn fort.«
Vierzig Soldaten. Der Prinz hatte in den vergangenen Tagen darüber nachgedacht, sie alle zu töten. Vierzig Mann. Dann konnten die Arbeiter fliehen, ohne verfolgt zu werden, jedenfalls eine Zeitlang, bevor König Settan von Laring davon erfuhr und seine eigenen Truppen schickte. Aber die Flüchtlinge konnten nur sicher sein, solange Sorayn bei ihnen war. Und wie hätte er sie mitnehmen können, auf dem Weg, den er gehen würde, rasch, mit den ausgreifenden Schritten eines Riesen?
Vierzig Mann. War es nicht entsetzlich, alle umzubringen? Nicht nur vierzig Mann, sondern vierzig Männer, vierzig Menschen … Er mochte gar nicht daran denken, dass er im Krieg über seine Feinde geweint hatte, über jeden, der starb. Vielleicht war er gar nicht in der Lage dazu, mit irgendjemandem zu kämpfen. Hatte der Segen ihn in einen Schwächling verwandelt? Ein wenig fürchtete er sich davor, zu erfahren, ob er tun konnte, was getan werden musste, oder nicht.
Vierzig Mann. Er hatte gehofft, dass es einen anderen Weg gab, dass ihm eine andere Möglichkeit einfiel, nicht nur selbst zu fliehen, sondern den Tod der Zurückbleibenden zu verhindern. Er wollte gar nicht feststellen müssen, ob er zu einem solchen Gemetzel fähig war. Vierzig Mann! Gegen drei.
Sorayn senkte den Kopf.
Drei. Drei werden sterben. Nur drei, wenn du ruhig bist, wenn du dich zusammenreißt. Du kannst es. Du kannst dich beherrschen …
Sie führten ihn ab. Er ging in ihrer Mitte, gebeugt, wie einer, der besiegt war, und besiegte doch nur sich selbst. Drei. Es werden nur drei sein …
Die Blicke der anderen waren feindselig. Er hatte damit gerechnet. Auch damit, dass es kaum zu ertragen sein würde, ihren Schmerz und ihren Zorn zu fühlen und zu wissen, dass er ihn verdiente.
»Musstest du das Maul so aufreißen?«, hielt ihm eine der Frauen entgegen. »Und was hast du nun davon?«
Hunger. Ständig. In den vergangenen Tagen hatte Sorayn erlebt, was es bedeutete, nie richtig satt zu sein und dabei noch hart arbeiten zu müssen. Doch die anderen litten darunter noch weit mehr als er. Dass es jetzt zur Strafe gar nichts gab, tat ihm für seine Mitgefangenen leid. Für sich selbst hatte er längst mit allem hier abgeschlossen.
»Na, siehst du.« Der Zinta setzte sich neben ihn ins Stroh. »Genau das habe ich gemeint.«
Das Kind weinte. Diesen Laut zu hören, dieses untröstliche Jammern und Schluchzen, war schlimmer als alles andere.
»Ich werde gehen«, sagte der Riesenprinz laut.
Ein paar lachten ungläubig. Er war gefesselt; die Soldaten hatten ihm, damit er auf gar keinen Fall entkam, Arme und Beine mit einer Eisenkette gefesselt und diese um einen der dicken Balken der Scheune geschlungen.
»Du wirst nirgendwohin gehen.« Bis jetzt hatte keiner mit ihm reden wollen, doch der heutige Tag hatte sie alle so aufgewühlt, dass sie ihre Vorsicht vergaßen. Die Wut auf ihn funkelte in ihren Augen. »Morgen bringen sie dich in die Mühle.«
»Und wir dachten«, sagte die alte Frau, »wir dachten, dass Rin dich geschickt hat, um einen Teil der Last von uns zu nehmen.«
Sorayn bewegte vorsichtig die Handgelenke und horchte auf das Klirren der metallenen Fesseln.
»Ihr dachtet, Rin schickt euch jemanden, der eure Gefangenschaft teilt? Glaubt ihr wirklich, dass er so handeln würde? Würde er euch nicht vielmehr jemanden schicken, der euch befreit?«
Er zog etwas stärker an der Kette und durch das hohe Gewölbe der Scheune lief ein Seufzen.
Fingerdickes Eisen. Es ließ ihn an den goldenen Halsschmuck vornehmer Damen denken, so zart und fein. Das war nichts gegen die riesigen Schlingen der Ankerkette, an der er seine wahre Kraft erprobt hatte. Das knirschende Geräusch von Metall auf Metall klang wie Musik in seinen Ohren.
»Ich habe dir gesagt, dass wir nicht fliehen können«, sagte der Zinta.
»Und du, Großer«, höhnte ein anderer, »wirst auch nirgendwohin gehen.« Warum klangen ihre Stimmen so hasserfüllt? War es die Angst um ihr eigenes Leben oder der Neid auf einen, der es wagte, den Kopf zu heben und dem Fürsten ins Gesicht zu schlagen?
»Kommt mit mir«, forderte er sie auf. Die Balken stöhnten auf, als er die Eisenkette prüfend straffte. Trauriger und bedrängter schienen sie zu sein als die Menschen.
Sorayn fühlte die ganze Last des Mitleids mit ihnen und ihrer Schwäche und ihrer Verzweiflung. Wie viele würden sterben, wenn er floh? Und trotzdem konnte er nicht bleiben. Er konnte sich nicht selbst zum Gefangenen machen. Wie hätte er sein eigenes Leben dafür opfern können – für Menschen, die weiterhin in Knechtschaft lebten? Leiden, damit sie weiterhin leiden konnten? Er horchte in sich hinein, ob der Segen, der ihm schon einmal einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte, ihm befahl, alles aufzugeben und hier zu bleiben, aber er fühlte nur das unwiderstehliche Bedürfnis in sich, aufzustehen und in der Dunkelheit zu verschwinden. All das und alle diese Menschen hinter sich zu lassen.
Er konnte sich nicht für sie opfern.
»Ich nehme jeden von euch mit, der mich darum bittet«, zwang er sich zu sagen, obwohl er davon träumte, allein zu gehen, obwohl er mit raschen Schritten Toris und seiner Sippe nacheilen wollte. Aber wenigstens das konnte er noch für diese Arbeiter tun. Vielleicht hatte ja tatsächlich Rin ihn zu ihnen geführt, um ihnen den Weg in die Freiheit zu bahnen. »Auch wenn ich befürchte, dass die meisten von euch zu feige sind, um die Gelegenheit zu nutzen, wenn sie sich bietet.«
»Nicht alle sind so stark wie du«, flüsterte der Zinta.
»Wie stellst du dir das vor?«, rief einer, und zwei Frauen schrien erschrocken auf, als auf einmal Staub und Spinnweben von der Decke auf sie herabregneten.
»Er darf nicht fliehen! Wachen!« Sie drängten sich doch tatsächlich an den Ausgang und riefen verzweifelt. »Wachen!«
Als Sorayn aufstand und die Arme auseinanderriss, fiel die Kette rasselnd von ihm ab. Im nächsten Moment schon öffneten einige Soldaten die Tür, um zu sehen, was der Lärm sollte.
Merkwürdigerweise spürte er keinen Zorn in sich, als er auf sie zutrat, die Kette schwingend, als er sie auseinandertrieb und durch sie hindurchschritt, nach draußen. Er fühlte sich dabei nicht froh. Kummer hing an ihm wie ein weinendes Kind, das sich an seinen Rücken klammerte.
Das Mädchen! Er wandte sich noch einmal um. »Gib mir deine Enkelin«, sagte er zu der Alten, die mit den anderen an die Rückseite der Scheune gewichen war und mit schreckensgeweiteten Augen seinen Ausbruch beobachtete. »Man soll mir nicht nachsagen, ich ließe Kinder für mich sterben.«
»Geh«, flüsterte die alte Frau.
»Nein!« Ein paar hysterische Arbeiterinnen hielten die Kleine fest. »Nein! Wenn sie geht, muss noch jemand sterben! Dann bringen sie noch einen um!«
Sorayn schüttelte den Kopf. Die Traurigkeit kroch ihm in den Nacken und krümmte ihn, schwerer als jeder Sandsack, den er geschleppt hatte. Mit einigen raschen Schritten war er bei den Gefangenen, die sich an das Mädchen klammerten, die Hände in seine Arme krallten, in sein Haar, als wollten sie es nie wieder loslassen. Musste er jetzt schon gegen Frauen kämpfen, gegen hungrige, geschwächte, versklavte Frauen, um ein Kind zu retten? Seine Wut verlieh ihm sonst eine rauschhafte Sicherheit im Kampf, doch jetzt, während er nichts als diese dumpfe Bedrücktheit fühlte, kam ihm jede seiner Bewegungen ungelenk vor. »Gebt sie mir«, befahl er.
»Nein!« Ihre Augen weit aufgerissen, hasserfüllt, fast wahnsinnig vor Angst und Verzweiflung. Hatte Fria, die Riesin, ihm nicht beigebracht, eine Frau zu schlagen? Und doch fiel es ihm schwer, er zögerte, er wünschte sich, sie würden ihm einfach gehorchen, so wie sie dem Aufseher gehorchten und den Wünschen des Fürsten Folge leisteten.
Er verlor zu viel Zeit. Die Soldaten, die er in die Flucht geschlagen hatte, würden in Kürze mit Verstärkung wiederkommen. Wenn er nicht wollte, dass alle vierzig für ihn starben, musste er jetzt verschwinden.
Die Augen des Kindes. Ohne Hass. Erschrocken, ja, aber ohne jene panische Angst, welche die anderen dazu gebracht hatte, sich auf es zu stürzen.
Er wandte sich um. Hinter ihm rief die Großmutter: »Bitte, bitte, nimm sie mit!«
»Soldaten!«, schrie jemand. »Wo bleiben die Soldaten?«
Sorayn trat vor den Balken, der die Scheune trug, umarmte ihn wie einen langvermissten Freund, wie einen zweiten Riesen. Nein, Maja würde er so nicht umarmen, mit einer Kraft, die ihr die Rippen gebrochen hätte. Staub und Heu rieselten von oben herab, ein Ächzen und Wimmern tönte aus allen Winkeln, das Holz kreischte auf …
Die Frauen ließen das Mädchen endlich los und rannten um ihr Leben. Sämtliche Gefangenen strebten kreischend zum Ausgang. Nur die Alte und ihre Enkelin blieben in der hintersten Ecke, als hätte er ihnen befohlen, dort zu warten.
Die hohen Holzwände wankten und wackelten … Er gab dem Balken einen letzten Stoß, lief zu den beiden, die auf ihn warteten – hatte er dieses Vertrauen verdient, dass sie dazu brachte, nicht mit den anderen zu fliehen? –, und warf sich gegen die Bretter. Er zog seine Schützlinge durch die entstandene Öffnung, bevor die ganze Scheune mit einem tiefen Seufzer zusammenfiel.
»Geh mit ihm, Kind«, sagte die Alte. »Ich würde euch nur aufhalten. Kümmert euch nicht um mich! Flieht!«
»Großmutter! Nein!«
Er wartete nicht länger, hob das Mädchen hoch und verschwand in die Nacht hinein.
Er war es nicht gewohnt, Rücksicht zu nehmen. Sie kamen viel zu langsam vorwärts und die Kleine weinte viel. Sorayn war gezwungen, ständig darauf zu achten, dass er sie nicht irgendwo hinter sich verlor. Sie rief nicht, wenn er aus ihrem Blickfeld verschwand, und einmal musste er sie suchen, nachdem er sich länger nicht nach ihr umgedreht hatte.
»So geht das nicht«, sagte der Riesenprinz. »Du musst etwas sagen, wenn du nicht so schnell kannst. Bei Rin, kannst du nicht sprechen?«
Sie sah ihn nur an und Tränen quollen aus ihren Augen.
»Soll ich dich tragen?«
Aber als er die Hände nach ihr ausstreckte, wich sie vor Schreck wimmernd zurück. Auf keinen Fall wollte sie getragen werden.
Es dauerte mehrere Tage, bis er aus ihr herausbekam, wie sie hieß.
»Ori.«
»Was? O-ri?« Er fragte mehrmals nach, denn dieser Name kam ihm merkwürdig vor, aber er war, wie sie ihm versicherte, durchaus üblich.
»Zwei meiner Freundinnen heißen auch so«, sagte sie und dachte dabei vielleicht an die Zeit, in der sie in einem Dorf gelebt hatte, ohne irgendetwas von Fürst Pidor zu wissen, eine Zeit, bevor sie mit ihrer Großmutter in der Knechtschaft gelandet war, denn sie versank wieder in ihr Schweigen, aus dem er sie lange Zeit nicht befreien konnte.
Eine Weile gingen sie auf der Straße, denn Ori fiel es schwer, über Gestrüpp und Dornenranken zu steigen, doch immer wieder ritten Soldaten vorbei. Sorayn hoffte, einen Kampf vermeiden zu können. Er musste sich darauf konzentrieren, für die Verpflegung zu sorgen. Da ihre Verfolger immer noch in der Nähe waren, durfte er kein Feuer anzünden. Jetzt im Herbst bot der Wald Nahrung im Überfluss, Beeren, Pilze, Nüsse, Wurzeln. Sorayn brachte Ori Hände voll schwarzer, süßer Beeren, überreif und köstlich. Gemeinsam sammelten sie Bucheckern und knackten Nüsse. Obwohl die Nächte jetzt schon empfindlich kalt wurden, konnte er dem Mädchen nichts anderes anbieten als eine Kuhle im Waldboden, zugedeckt mit Blättern und Zweigen, und weiches Moos als Kopfkissen. Manchmal weinte sie stundenlang, bis sie vor Erschöpfung einschlief, und am Morgen waren ihre Augen tränennass. Der Prinz hatte nicht das Gefühl, sie gerettet zu haben. Sie schien von einer Gefangenschaft in die nächste geraten zu sein, ausgeliefert einem dunklen Schicksal, dem sie nicht entrinnen konnte, und mehr als alles andere wünschte er sich, endlich die bunten Wagen des Ziehenden Volks vor sich zu sehen, wo sie sich am Feuer aufwärmen konnten, wo Gesang und Gelächter hoffentlich selbst dieses verschlossene, traurige Kind davon überzeugen konnten, dass es in dieser Welt mehr gab als Hunger, Müdigkeit und Kälte. Mit Maja zusammen, so träumte er manchmal, wäre diese Reise herrlich gewesen. Ori dagegen war wie ein Sack Sand, wie etwas, das er Tag und Nacht schleppen musste, ohne je das Ziel zu erreichen.
Obwohl sie so langsam vorwärtskamen, zweifelte er nicht daran, dass er die Sippe einholen würde. Toris und seine Brüder und Schwestern waren spät dran; in den Süden würden sie es vor dem Winter sowieso nicht mehr schaffen. Bald würden sie für längere Zeit das Lager aufschlagen, und dann war es nicht schwer, sie zu finden.
»Halte durch«, sagte er zu Ori. »Bald sind wir da.«
Die Grenze von Pidors Herrschaftsbereich überquerten er und das Mädchen nicht auf der Straße – wo man sie zweifellos an einem Schlagbaum aufgehalten hätte –, sondern im Dickicht, wo keine Soldaten lauerten. Und erst jetzt atmete er wirklich auf. Das Fürstentum ihres Peinigers lag hinter ihnen, weiter durfte er seine Wachen nicht schicken. Sie hatten es tatsächlich geschafft, ohne aufgehalten und in weitere Kämpfe verwickelt zu werden.
Sorayn wagte es auch wieder, den befestigten Weg zu benutzen. Unverkennbare Anzeichen wiesen darauf hin, dass die Zintas hier durchgekommen waren. Wagenspuren, die Hinterlassenschaften von Pferden und Vieh, die Stellen, an denen sie angehalten hatten – all das hatte ihn auch schon beim ersten Mal, als er nach der Sippe gesucht hatte, geleitet.
»Riechst du es?«, fragte er und führte seine kleine Begleiterin von der Straße weg in einen lichten Wald. »Den Geruch von Feuer und Gebratenem? Kinder spielen dort, und hörst du die Hühner und die Ziegen?«
»Ja«, rief das Mädchen aufgeregt.
Da leuchteten schon die bunt angestrichenen Wagen zwischen den Stämmen hervor, ein paar Frauen rührten in den Töpfen über ihren Feuerstellen, lang vermisste Düfte lockten ihn aus dem Wald heraus.
War er jemals irgendwohin gekommen und zu Hause gewesen – außer damals, als er bei Liravah lebte? Doch jetzt fühlte es sich an wie eine Heimkehr, und mit einem Mal verstand er sehr viel besser, warum Keta die Gemeinschaft mit diesen Menschen dem Leben in einem Palast vorzog.
Die Kinder riefen seinen Namen, sobald sie ihn sahen, und wenig später kam ihm sein Schwiegervater entgegen. »Sorayn!« Die Erleichterung stand in sein Gesicht geschrieben. »Rin sei Dank, du bist ihnen entkommen!«
Toris drückte ihn fest. »Kommt alle her, er ist wieder da!«
Ori versteckte sich hinter seinem Rücken. »Später«, versprach der Prinz, wenn die Zintas nach ihr fragten. Viel erzählte er nicht. Wie hätte er davon sprechen können: dass nun, da er geflohen war, drei Menschen für ihn umgebracht wurden. Sogar für das Kind würde ein anderer sein Leben lassen müssen. So sehr hoffte Sorayn, dass die anderen Gefangenen die Gelegenheit genutzt und das Weite gesucht hatten, aber so mutlos, wie er sie erlebt hatte, bezweifelte er das.
»Seid ihr gut über die Grenze gekommen?« Es war ihm lieber, sich über die Erlebnisse der Sippe zu unterhalten.
Toris nickte. »Als du mit den Soldaten mitgegangen bist, gaben sie uns ein Siegel für freies Geleit. Das haben wir vorgezeigt und wurden ungehindert durchgelassen. – Danke, Sorayn.« Und dann sagte er auf einmal: »Maja ist auch in Laring. Gar nicht weit von hier.«
Sein Herz schlug hoch auf. »Tatsächlich? Sie ist hier?«
»Du bist ein guter Junge.« Im Blick des dunkelhaarigen Mannes lag sehr viel Wärme. »Du hast es verdient, dass sie dir noch eine Chance gibt. – Bei Rin, bis heute wusste ich nicht, dass ich es dir sagen würde. Aber ich will erleben, dass diese Geschichte ein gutes Ende nimmt. Geh zu ihr und bring es in Ordnung.«
Sorayn nickte. »Das werde ich tun.«
Am nächsten Morgen gackerten die Hühner besonders laut. Der Prinz, der Toris’ Angebot angenommen hatte, in seinem Wagen zu schlafen, schreckte hoch und blickte aus dem Fenster. »Das kann nicht wahr sein!«
»Was ist los?«, fragte sein Schwiegervater verschlafen.
Der junge Riese nahm sich nicht die Zeit zu antworten. Er stürmte nach draußen.
Schwer bewaffnete Soldaten hatten das Lager umstellt. Ihre Gesichter verrieten viel zu wenig, als warteten sie noch auf die Erlaubnis, sich ungeniert darüber zu freuen, dass sie die Zintas überrumpelt hatten.
»Was fordert der Herr des Landes von uns?«, fragte einer der älteren Brüder. Er trug den gleichen Ausdruck auf dem Gesicht wie Sorayns Mitgefangene, dieselbe resignierte Traurigkeit wie Ori.
»Oh nein«, murmelte Toris. »Nicht schon wieder! Wie sollen wir jemals in den Süden kommen, wenn sie ständig alle etwas von uns wollen?«
»Ich bin da«, beruhigte Sorayn ihn. Und laut sagte er: »Der Fürst kann sich gerne unsere Aufführung am nächsten Markttag ansehen. Sicher besteht kein Bedarf daran, jetzt schon ein Schauspiel zu erleben.«
»Das ist der Kerl, ohne Zweifel«, sagte einer der Soldaten. »Sehr groß, schwarze Haare, blaue Augen. Fürst Pidor wird zufrieden sein.«
»Das hier ist nicht sein Gebiet!«, rief der Riesenprinz empört. Er hatte es bis hierher geschafft – es konnte doch nicht möglich sein, dass es selbst hinter der Grenze kein Entkommen vor diesen Leuten gab!
»Das Land gehört ihm nicht, aber du schon.« Der Sprecher gestattete sich endlich ein Grinsen. »Wirel, der Fürst dieses Landes, ist ganz und gar nicht zufrieden damit, dass sich hier Diebesgesindel niedergelassen hat, das versucht, die Edlen des Königreiches Laring um seinen Tribut zu betrügen. Du wirst uns unverzüglich folgen. Des Weiteren verlangt Fürst Wirel den üblichen Wegzoll von diesem Pack.«
Er hatte sich umsonst geopfert, hatte umsonst tagelang in der Knechtschaft ausgeharrt. Es hörte nicht auf. Es hörte einfach nicht auf!
»Wie lange soll das noch so gehen?«, fragte Sorayn. »An der nächsten Grenze wieder? Und dann wieder? Wird jeder Landesherr sich einen Leibeigenen aus unserer Mitte nehmen? Wie sollen wir so je in den Süden kommen?«
»Sei ruhig«, bat Toris. »Reize sie nicht noch mehr. Siehst du nicht, wie viele es sind? Das ist eine halbe Armee. Dagegen hast selbst du keine Chance.«
»Wir können keinen von uns opfern«, sagte eine der Zinta-Frauen gequält. »Haben wir nicht beim letzten Rat beschlossen, dass wir uns nicht trennen wollen? Wir werden für den Fürsten arbeiten, wenn es nicht anders geht, aber wir bleiben zusammen.« Tränen füllten die feinen Gräben in ihrer braunen Haut.
»Eine kluge Entscheidung.« Der Soldat nickte. »Aber der Große dort wird bestimmt wieder Schwierigkeiten machen. Kreist ihn ein.«
Die Männer schienen nur auf diesen Befehl gewartet zu haben; sofort ritten sie auf ihn zu. Ihre Pferde trampelten über alles hinweg; eins der erhobenen Schwerter durchtrennte eine Wäscheleine.
»Rasch!«, riefen ein paar Zintas. »Lauf, Sorayn! Du kannst uns doch nicht mehr helfen! Lauf, bevor alles noch schlimmer wird!«
Er hatte nicht die Absicht, wegzulaufen. »Bringt die Kinder in den Wagen. Lasst sie nicht zusehen.« Die Soldaten versuchten, ihn zu umkreisen. Er blieb stehen und wartete, bis sie Stellung bezogen hatten. »Ergib dich!«, brüllte einer, der wohl ihr Anführer war.
»Es wird nur schlimmer«, rief Toris. »Immer nur noch schlimmer! Kämpf nicht für uns, das bringt nichts. Denk an Maja. Lauf! Lauf!«
Aber Sorayn konnte diese erneute Androhung von Gewalt nicht hinnehmen. »Versucht es«, sagte er. »Ihr werdet sehen, was ihr davon habt.«
»Glaubst du, du hast auch nur den Hauch einer Chance? Wenn sie dich an die Mühle geschmiedet haben«, kündigte der Hauptmann an, »werden sie dich blenden. Man braucht keine Augen, um das Rad zu drehen.«
Der Schmerz brach aus ihm heraus. Der junge Riese brüllte auf, griff nach einem der Speere, die auf ihn gerichtet waren, und wirbelte herum. Die Soldaten, die um ihn herumstanden, fegte er zusammen wie Unrat. Der Rappe des Offiziers stieg; Sorayn pflückte den Mann herunter und schleuderte ihn gegen die Angreifer, mitten hinein in die scheuenden, wiehernden Pferde. Irgendwo kreischten ein paar Frauen, während Sorayn wie ein Sturm über die Feinde kam, ein Herbststurm, wie ihn noch keiner erlebt hatte. Seine Wut entlud sich über ihnen. Er merkte nicht einmal mehr, ob sie schrien, ob sie schnell starben oder nicht und ob sie ihn um Gnade anbettelten. Blitze zuckten durch seine Adern, seine Faust krachte wie der Donner in sie hinein, ein Unwetter, das nicht enden wollte. Den Flüchtigen setzte er nach, riss sie von den Pferden, stampfte sie in den Boden.
»Oh bitte! Oh bitte, bitte, bitte!«
Aber er musste tun, was der Schmerz ihm befahl.
Irgendwann erreichte die Stimme sein Ohr.
»Oh bitte!«
Da standen die Ziehenden und schauten ihn an. Männer und Frauen und Kinder.
Nun würde man auch sie jagen wie tollwütige Füchse … Nun gab es erst recht keinen Ausweg mehr. »Es wird immer nur noch schlimmer«, flüsterte er. »Du hattest recht, Toris.« Er starrte auf seine blutigen Hände.
»Du musst damit aufhören«, sagte sein Schwiegervater leise. Der Einzige, der noch neben ihm stand, der sich traute, in seine Nähe zu kommen, ins Zentrum des Sturms. »Du musst aufhören, Sorayn.«
Er blickte in die dunklen Augen des Zintas und las das gleiche Entsetzen darin, das er selbst empfand.
»Was bin ich?«, fragte er. »Ein Ungeheuer?«
»Du kannst nicht jeden töten«, sagte Toris. »Auch wenn sie uns gefangen nehmen wollen, auch wenn sie uns quälen und umbringen … Du kannst sie nicht alle töten. Was willst du tun? Gegen ganz Deret-Aif kämpfen?«
»Nein. Nur gegen einen. Ich werde nach Kirifas gehen und Zukata vom Thron stürzen.«
Toris sah ihn an und schüttelte besorgt den Kopf.
»Grüß Maja«, sagte Sorayn. »Bitte sie in meinem Namen um Verzeihung für alles. Aber ich kann jetzt nicht zu ihr, ich kann unser Glück nicht über die furchtbaren Dinge stellen, die in diesem Land geschehen.«
Toris nickte.
»Vertrau mir. Ich bringe alles wieder in Ordnung. Das verspreche ich dir.«
»Versprich nicht zu viel«, sagte Toris und ging zurück zu den anderen, und Sorayn wandte sich ab von dem, was er getan hatte, und verschwand im Wald.