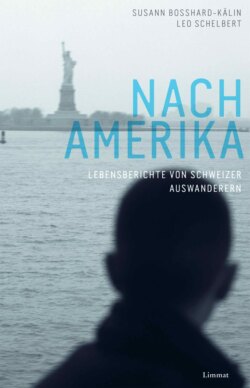Читать книгу Nach Amerika - Leo Schelbert - Страница 7
ОглавлениеPhilip Gelzer, 1927
Von Basel-Stadt nach Greensboro,
North Carolina
«ICH FÜHLTE MICH AUF EINMAL ZU HAUSE IN NEW YORK.»
‹IAG› – in Amerika gewesen! Wer das von sich sagen konnte, wurde beneidet und hatte im Berufsleben – besonders in Bankenkreisen – bessere Karten. Der Bankkaufmann Philip Gelzer schnupperte 1950 für ein Jahr USA-Luft und blieb in der Neuen Welt. Er ist Amerikaner und Heimwehbasler und kriegt heute noch feuchte Augen, wenn er in akzentfreiem Baslerdialekt von seiner Heimatstadt schwärmt. Seit ein paar Jahren bewohnt er mit seiner zweiten Frau, Joe, eine Vierzimmerwohnung in einem exklusiven Alterszentrum in Greensboro, North Carolina. Er findet, dass sich Auswanderergeschichten immer irgendwie ähneln. Ob dem so ist?
Mein Urgrossvater Johann Heinrich Gelzer zog als Theologe und Historiker von Schaffhausen nach Basel, habilitierte an der Universität und vermählte sich mit einer Sarasin-Tochter. Damit wurde er aufgenommen in den Basler «Daig», ins vornehme Bürgertum. Später, nach Jahren als Professor in Berlin und zurück in Basel als Schriftsteller, Politiker und Diplomat, erhielt er sogar das Ehrenbürgerrecht der Stadt. Mein Vater Heinrich, Sohn von Pfarrer Karl Gelzer-Vischer, ist im Pfarrhaus der «Dalbekirche» aufgewachsen und studierte auch Theologie. Er wurde Rektor des Theologischen Seminars der Basler Missionsgesellschaft. Der junge Pfarrer wagte noch vor dem Ersten Weltkrieg den mutigen Schritt, eine deutsche Pastorentochter aus Stassfurt zu heiraten. Meine Mutter, Charlotte Luedecke, Leiterin eines von ihrem Vater gegründeten Waisenhauses und preussischen Ursprungs, wurde der Liebling in unseren weitverzweigten Basler Familien. Sie war bestrebt, sich gut zu assimilieren und sprach bald Basler Dialekt. Mutter war eine energische, aber fröhliche Frau und eine grosse Verfechterin des Frauenstimmrechts. Und sie war eine Pfarrfrau im alten Stil: «2 für 1», hiess das. Den Pfarrer stellte man ein und die Frau, die ihren Mann meist engagiert unterstützte, ohne Entlöhnung mit dazu.
Die eine meiner Welten war im Basler Missionshaus, die andere bei der vornehmen Verwandtschaft in der «Dalbe». Die beiden Milieus hätten verschiedener nicht sein können. An den grossen Vischer-Familientagen waren die Nachkommen der «hinein-geheirateten» Gelzers sowie die Iselins, Staehelins, Burckhardts, Christs, Albrechts eingeladen. Wir waren die «Missionshäusler». Ich war als Bub sehr sensibel auf solche Zuschreibungen, auch auf den in der weiteren Familie oft zitierten Scherz: «Alle Jahre wieder kommt ein Gelzer-Kind!» Als zehnköpfige Familie stachen wir in der Verwandtschaft heraus. Am ersten Januar machte man nach altem Basler Brauch Neujahrsbesuche bei der «oberen Generation», den Grosseltern, Onkeln und Tanten. Das ganze «Gelzer-Zygli» – mein Vater mit Zylinder – machte sich zu Fuss auf den Weg in ihre Stadtvillen – meine Eltern sowie Michael (1916), Monika (1918), David (1919), Jakobea (1921), Lea Barbara (1924), Priscilla Rahel (1925), ich (1927) und Justus (1929). «Gutzi», warme «Baschtetli» und Wermut waren die Höhepunkte und die Belohnung bei diesen Pflichtbesuchen. Meine Grosseltern hatten überdies ein Landgut oberhalb von Eptingen. Es gehörte sich, dass man ein Sommerhaus besass, mit einem «Lärchenmann», der auf dem Gut lebte und dieses betrieb. Wir durften einen Teil der Sommerferien dort verbringen. Ich weiss heute, dass Onkel Benedikt Vischer, Associé bei der Bank Sarasin, meinen Eltern finanziell immer wieder unter die Arme griff. Ich denke, ohne seine Hilfe hätten sie die grosse Kinderschar nicht durchgebracht.
Als siebtes und zweitletztes Kind der Familie kam ich am 4. Oktober 1927 im Frauenspital in Basel zur Welt und wurde Philipp Christian Renatus getauft – nach Philipp Melanchthon, einem Kollegen Martin Luthers, und nach Christian Renatus Zinzendorf, dem Sohn des Gründers der Herrnhuter Brüdergemeine. Unsere Familie wohnte im Missionshaus beim Spalentor, dort wo auch die Administration der weltweit tätigen reformierten Mission, heute Mission 21, ist. Die Basler Mission war ein Gemeinschaftswerk deutscher, elsässischer und Schweizer Missionsleute und bot eine Ausbildung für Missionare in aller Welt. Leitende der Mission und die Lehrer am Seminar lebten mit ihren Familien im Komplex, und natürlich auch die Seminaristen. Einer meiner besten Freunde war der Sohn eines Mitarbeiters meines Vaters, und auch meine erste Sandkastenfreundin kam aus einer Missionarsfamilie. Eine Tür führte von unserer Wohnung direkt ins Seminar, und die künftigen Missionare konnten bei uns jederzeit an die Tür klopfen, sei es auch nur, um von Mutter einen Knopf angenäht zu bekommen. In unserer Wohnung gab es eine einzige primitive Toilette für die ganze Familie, kein Badezimmer, nur eine kleine Badewanne in einem Kasten drin. Es war alles sehr einfach. Aber wir kannten nichts anderes.
Wir hatten ein offenes Haus, ein von der Religion geprägtes Daheim. Die Fasnacht war tabu. Den Seminaristen war sie verboten und leider auch uns Kindern. Ich durfte nie eine Larve anziehen, «drummeln» oder pfeifen. Mutter erzog uns mit preussischer Konsequenz. Sie hatte ab und zu eine lose Hand, und wenn man sich in Vaters Studierstube stellen musste, wusste man, was es geschlagen hatte. Ausschliesslich als Familie sassen wir selten am Esstisch. Oft waren Leute aus den Missionen, deutsche Verwandte, Hilfsbedürftige oder Flüchtlinge da, und immer natürlich unsere Donna, das «Dienstmädchen». Sie war als Bedienstete Teil der Familie, was damals in den besseren Basler Kreisen nicht üblich war.
Bei Verwandten in Mürren im Winter 1934; Philip bei der Mutter sowie Justus und Priscilla.
Philip, Lea und Justus 1937 (von links nach rechts).
Vater hat uns seine Anspruchslosigkeit für alles Weltliche und Materielle vorgelebt. Das Gegenteil von dem, was heute in Amerika praktiziert wird. Er trank keinen Alkohol und brauchte wenig für sich selber. Eines seiner grossen Vorbilder war Bruder Klaus, ein Katholik. Mutter sagte jeweils, der habe es sich leicht gemacht, sei in ein «klei Hüttli» gegangen und habe seine Familie zurückgelassen! Vater dachte ökumenisch und hatte sehr viel Humor – diesen speziellen Basler Humor, den viele Schweizer nicht verstehen. Ausserdem meinen sie, Baseldeutsch sei eine Fremdsprache.
Meine Kindheit war im Schutz der grossen Familie glücklich, aber der Zweite Weltkrieg war in der Grenzstadt doch prägend: Ich wurde Meldebote im internen Luftschutz. Vater war als Luftschutzchef dafür besorgt, dass bei Alarm alle vierzig bis fünfzig Personen aus dem Missionskomplex in den Keller gingen, Studenten, Lehrer und all deren Familien. Eine Zeitlang kamen die Flieger jede Nacht. Wir mussten verdunkeln, denn die beleuchtete Schweiz wäre ein wichtiger Hinweis für die Bombardements der Amerikaner im nahen Deutschland gewesen. Deutschland hatte seine Munitionsfabriken nahe an der Schweizer Grenze gebaut; so waren sie sicher, dass sie nicht bombardiert würden. Wenn alle im Luftschutzkeller unten waren, fuhr ich mit dem Velo bei dunkler Nacht ins Spalenschulhaus zum Luftschutzposten. Ich war stolz, die Armbinde tragen zu dürfen, die mich autorisierte, während des Alarms allein durch die Stadt zu fahren. Angst verspürte ich nie.
Was ich beruflich machen würde, war für mich schon als fünfjähriger Bub klar: Ich wollte Pfarrer werden wie mein Vater und meine beiden Grossväter. Aber der Schuldruck im Humanistischen Gymnasium wurde unerträglich. Ich strengte mich an, aber nach kurzer Zeit fingen die Probleme an. Im zweiten Jahr hatte ich Mühe und im sechsten Jahr am «Gymmeli» wurde es dramatisch. Für mich war der Schulstoff schwierig, Latein, Griechisch, Französisch, Mathematik, einfach alles. Hebräisch wäre in der siebten Klasse noch dazugekommen. Vater sprach mit mir über die schulischen Schwierigkeiten: «Man muss aufpassen, dass man nicht etwas durchzwängt, was vielleicht nicht Gottes Wille ist.» Ich rang innerlich mit mir und entschied: Pfarrer zu werden war nicht mein Weg! Ich erlebte mein Versagen als grosse persönliche Niederlage. Was nun?
Freunde halfen mir und meinen Eltern im Entscheid, meine weitere Schulbildung an der Ecole Supérieure de Commerce in Neuenburg fortzusetzen. Ich wohnte bei einer liebenswürdigen welschen Familie in Saint-Blaise. Plötzlich ging mir der Knopf auf – das Lernen fiel mir leichter. Ich erlebte die Neuenburger Jahre als befreiende Zeit und kehrte mit dem Handelsdiplom nach Basel zurück. Um nicht verwandtschaftlich verbandelt zu sein, riet mir mein Onkel von der Bank Sarasin, die weitere Ausbildung bei der Schweizerischen Volksbank zu absolvieren. Das dreijährige Praktikum und der Unterricht beim kaufmännischen Verein wurden mehrmals unterbrochen durch die Rekrutenschule, dann die Unteroffiziers- und anschliessend die Offiziersschule in Bern, die letzte übrigens, in der die Infanterieaspiranten den Umgang mit Pferden und das Reiten lernten. 1948 wurde ich im Berner Münster zum Leutnant brevetiert. Meine Eltern konnten sich das Zugbillett nicht leisten. «Wir sind im Geist bei dir», liessen sie mich wissen und waren sehr stolz auf ihren Zweitjüngsten.
Die Direktion der Schweizerischen Volksbank ermutigte mich, nach Amerika zu gehen. Wenn man weiterkommen wollte, gehörte ein US-Jahr dazu. Amerika galt als grosses Vorbild. Die Leute fragten nicht, was man dort machte. «IAG» im Zeugnis war einfach wichtig für eine erfolgreiche berufliche Laufbahn!
Walter Schiess, ein Vetter meines Vaters, war Anwalt für die damals führende Schreibmaschinenfirma Remington. Er half, einen Kontakt zu seinem amerikanischen Anwaltskollegen zu knüpfen, der mir versprach, bei seiner Firma in New York ein gutes Wort für mich einzulegen.
1949 gab ich auf der US-Botschaft in Bern für ein Visum ein. Untätig zu warten, bis ich nach Amerika ausreisen konnte, kam für meine Eltern nicht in Frage. Mutter hatte eine Bekannte in Paris, die mich als Tellerwäscher in die Mensa der Pariser Universität vermittelte. Paris – immer noch gezeichnet von den harten Kriegsjahren – war bedrückend. Viele Menschen bettelten auf den Strassen. Am Desk des YMCA, wo ich wohnte, stand in grossen Lettern: «Nous attendons une aire nouvelle où la justice reignera».
Ich war ein guter Arbeiter in der Uni-Mensa, und es gab für mich gratis Essen und ein paar Francs Lohn. Wenn ich im Café die Studenten beim Hinausgehen kontrollieren musste, ob sie Besteck klauten, war das sehr unangenehm. An den Nachmittagen streifte ich durch die Stadt, besuchte den Louvre. Mit anderen Menschen hatte ich wenig Kontakt; allein zu sein, machte mir wenig aus.
Ich hatte noch einen zweiten Job, für den ich morgens um sechs Uhr aufstand. An den Schaltern der Folies Bergère im Quartier Latin musste ich Tickets kaufen und sie einer Agentur zum Wiederverkauf bringen. Nach sieben Monaten endlich kam das versprochene Visum für Amerika.
In dritter Klasse auf der S. S. De Grasse reiste ich Ende Dezember 1949 in sieben Tagen über den Atlantik nach New York. Ich war trotz stürmischem Meer nie seekrank. Ein Amerikaner, der mit mir die Schiffskoje teilte, fand es naiv, dass ich aufgrund eines äusserst vagen Job-Versprechens nach Amerika reiste. «I hope you succeed!», liess er mich wissen. Für mich war klar, die Einladung des Anwalts «come and see us» war quasi ein Arbeitsvertrag.
Niemand holte mich am Hafen ab. Mit einem Taxi fuhr ich ins YMCA, und eine Woche später fand ich in Manhattan an der 87th West Street bei zwei älteren Damen für sieben Dollar die Woche ein Zimmer. Ich genoss das Dolcefarniente in der Grossstadt. Als der Remington-Anwalt mich am Telefon abfertigte: «I am away for the next two weeks, come and see me later … – ich bin die nächsten zwei Wochen weg, kommen Sie später!», wurde ich nicht hellhörig, keinerlei Warnlampen blinkten. Wie naiv und unerfahren war ich! Nach seiner Rückkehr lud er mich zum Lunch in ein teures Restaurant ein. Ich sprach miserabel Englisch, wir diskutierten über alles Mögliche, nur nicht über eine Anstellung. Am Schluss fragte ich schüchtern, wie es denn mit der versprochenen Arbeit sei. «Let me think about it – I am leaving for Washington.» Er war auf dem Sprung nach Washington, und mir ging endlich ein Licht auf: Der will mich loswerden!
Mir wurde mulmig zu Mute, ich geriet in Panik, denn ich hatte nur noch knappe achtzig Dollar in der Tasche. Auf dem Schweizer Konsulat wurde mir geholfen, einen Brief aufzusetzen. Ich sei nach Amerika gekommen, um zu arbeiten. Die Antwort aus dem Anwaltsbüro war knapp und eindeutig: «If you can’t wait until things work out, you better take the next boat back! – Wenn Sie nicht warten können, bis sich die Dinge klären, nehmen Sie besser das nächste Schiff zurück!» Zurück? Nie und nimmer. Das hätte mir mein Stolz nicht zugegeben.
Ausgerechnet in jenen Tagen schrieb Mutter, die Union Trading Company in Basel habe sich nach meiner Adresse wegen eines Stellenangebots erkundigt. Aber ich wollte mich nicht unterkriegen lassen: Zwölf Monate Amerika, dann komm ich heim, war mein Entschluss. Ich musste es einfach schaffen. Mit meinem Résumé in der Hand ging ich an der Wall Street von Tür zu Tür. Ich meldete mich jeweils unten beim Pförtner an: «I am looking for a job.» Bei den Schweizer Banken hiess es «complete an application form», ohne feste Zusage. Bei der American Express liess man mich umgehend wissen: «Sie können morgen anfangen!»
Wie dankbar war ich für die 24 Dollar, die ich ab Ende Januar 1950 pro Woche verdiente. Als Ausläufer ging ich mit Amexco-Checks unter dem Arm zu den anderen Banken. Paketweise verschob ich Checks und lief die Wall Street rauf und runter. Ich arbeitete sehr speditiv und war meist am frühen Nachmittag mit meiner Runde fertig. Das bot mir Gelegenheit, eine bessere Stelle zu finden. Nach vier Wochen bei American Express trat ich eine Stelle an im Commerical Credit Department der privaten, englischen J. Henry Schroder Banking Corporation. Hier lernte ich sehr viel, auch im Umgang mit hilfreichen, unkomplizierten amerikanischen Kollegen. Noch heute gehen viele meiner freundschaftlichen Beziehungen auf diese Zeit zurück.
Und ich fühlte mich auf einmal zu Hause in New York – die Stadt war ein grosses Wunder. Ich stieg auf alle Wolkenkratzer, lief stundenlang durch die Hochhäuserschluchten. Am Mittag ass ich jeweils im «Automaten-Restaurant», einer neuen Erfindung. Man schob die Nickel rein, und aus dem Türchen kamen Kaffee oder Sandwiches.
Nach dem ersten US-Jahr zog es mich nicht heimwärts. Ich hatte noch zu wenig erlebt und gesehen. Aber, so fragte ich mich, gibt es neben den Jobs in der amerikanischen Bankenwelt etwas in der Industrie für mich? Eine Kollegin auf der Bank half mir, ein Bewerbungsschreiben aufzusetzen, das ich verschiedenen Firmen in Manhattan vorlegte. Zur gleichen Zeit wurde ich von einem Vetter zweiten Grades meines Vaters, Karl Suter, damals Executive Vice President von Geigy in New York, zu ihm nach Hause eingeladen, zusammen mit einer Gruppe anderer junger Schweizer. «Nur die Banken, das ist nicht Amerika», meinte er. Ob ich im Personalbüro von Geigy vorsprechen wolle?
Mein Enthusiasmus war nicht eben riesig. Die Arbeit in einer Schweizer Firma lockte mich nicht, aber Geigy bot mir 65 Dollar die Woche und eine Stelle im DDT-Department. Dort verkauften sie unter anderem das Insektizid Dichlordiphenyltrichlorethan in den USA und in Südamerika. DDT war seit Anfang der 1940er-Jahre als Kontaktund Frassgift sehr gefragt und wegen seiner guten Wirksamkeit gegen Insekten, der geringen Toxizität für Säugetiere und dank des einfachen Herstellungsverfahrens das weltweit meistverwendete Insektizid. Ich wurde Assistent des Exportmanagers, eines gemütlichen Amerikaners, der mir sofort sympathisch war. Unser gemeinsames Büro war in einem alten Gebäude an der Barclay Street in der Nähe der Wall Street im vierten Stock. Ohne Lift. Mit einem Korb zog man die Post an einem Seil nach oben. Das Geschäft von Geigy bestand 1951 hauptsächlich aus Farbstoffen und Chemikalien. Daneben gab es eine kleine pharmazeutische Abteilung und «unser» Insecticide Department.
Am Ende des Korea-Krieges, 1953, wurde ich in die US-Army eingezogen. Geigy wollte mich künftig auf Geschäftsreisen ins Ausland schicken, und wenn ich ausgereist wäre, hätte ich als Dienstverweigerer und «undesirable alien» nie mehr nach Amerika einreisen können. Dem Aufgebot auszuweichen, indem ich nach Basel zurückkehrte, kam für mich nicht mehr in Frage. Im Kontakt mit dem Hauptsitz in Basel kamen mir die Arbeitsmethoden dort bürokratisch vor und der Weg nach oben zu langsam. In Amerika hingegen stand mir die Welt offen. Alles war unkomplizierter, und Geigy bot mir eine berufliche Zukunft. Die wollte ich nicht aufs Spiel setzen. Meine Mutter war total Amerika-begeistert und meinte, das sei der Preis, den ich für das freie Amerika zu zahlen hätte.
Ich kam auf einem Lastwagen nach Montgomery, Alabama, in das No-Man’s-Land eines Rekrutencamps, zusammen mit einer Menge Immigranten aus aller Welt. Viele wollten mit dem Einsatz für die Armee die Chance nutzen, zu einer neuen Identität zu kommen. Denn mit dem Abschluss der Rekrutenschule wurde man automatisch amerikanischer Staatsbürger. Es gab undurchsichtige Leute darunter, die «gottenfroh» waren, dass sie ihre Staatsbürgerschaft abgeben konnten und ihr Leben nicht mehr als Tschechen, Polen oder Deutsche leben mussten. Ich durfte mein Schweizer Bürgerrecht behalten und wurde zu Philip R. Gelzer. Meinen Vornamen Renatus konnte in den USA ohnehin niemand aussprechen. Im Rückblick finde ich es schade, dass ich das Doppel-P bei Philipp weggegeben habe.
Dank meiner deutschen Sprachkenntnisse hiess es nach der Ausbildung: «Gelzer, Korea does not make sense – you go to Germany». Aus meiner Kompanie war ich der einzige, der von 1954 bis 1955 als GI zur Security Police nach Schweinfurt kam. Es ging in erster Linie darum, das Renommee der Amerikaner in Deutschland zu verbessern. Nachts fuhren wir mit unseren Camions zu den Beizen und luden die GIS auf, die sich zu lärmig aufführten. Ich war oft als Übersetzer tätig. Junge deutsche Frauen in der Region hatten ein Baby mit einem GI – die Mütter meldeten sich mit ihren Babys bei uns auf dem Posten und erklärten: «Der Soundso ist der Vater meines Kindes». Die amerikanischen Streitkräfte gingen fürsorglich mit diesen jungen Deutschen um, und meist entschied die Militärjustiz, dass der Soldat die Mutter finanziell unterstützen müsse. In Franken, wo wir in den Manövern waren, kamen auch Mütter mit schwarzen Babys. Ich war beeindruckt, wie Amerika sich in den Fünfzigerjahren bemühte, das eigene Image zu verbessern.
Als Administrative Clerk der Regimental Headquarters Company der 16. Infanteriedivision 1954/55.
Die Zeit bei der US-Army war für mich sehr wichtig, und ich wurde bald Wachtmeister, Sergeant, Bürochef in der Regimental Headquarter Company der 16th Infantry Regiment in der First Infantry Division of the United States. Von Deutschland aus durfte ich heimreisen. In der US-Uniform war dies allerdings ein heikles Unterfangen. Prompt stand eines Morgens die Schweizer Militärpolizei vor der Tür. Jemand hatte mich gesehen und verpfiffen. Bis heute weiss ich nicht, wer es war. Die Anklage auf dem Posten lautete: «Schwächung der Schweizerischen Landesverteidigung». Die Situation wurde brenzlig, zumal ich so schnell wie möglich zu meiner Einheit nach Deutschland zurückkehren musste. Advokat und Oberst Emanuel Iselin, engagiert von der Firma Geigy, half mir. Die Sache wurde noch dadurch verschärft, dass ich seinerzeit den Feldstecher aus dem Schweizer Armeebestand mit nach Amerika genommen hatte. Der Vorfall belastete den Prozess gegen mich zusätzlich, und der Feldstecher musste umgehend ins Zeughaus zurück. Ich konnte ausreisen, und der Prozess ging in absentia des Angeklagten über die Bühne. Das Verfahren wurde dann schliesslich dank Iselins geschickter Intervention eingestellt.
Geigy war per Gesetz verpflichtet, meine Stelle freizuhalten; ich reiste nach New York zurück. Beruflich fing ich wieder unten an, diesmal in der Abteilung Farben und Chemikalien. Die Geschäftsleitung überzeugte mich, in der Abteilung Farben und Chemikalien wären meine Chancen, vorwärts zu kommen, am besten.
Einer meiner ehemaligen Dienstkameraden bei der US Army forderte mich zu einem «Blind Date» mit zwei seiner Arbeitskolleginnen im Sozialdienst auf. Die eine der beiden jungen Damen imponierte mir auf den ersten Blick. Lorayne Helfer war im Begriff, ihre Stelle aufzugeben und an der Harvard University einen Master Degree in Education zu erwerben. Sie war lebensfroh und ambitioniert, und ich blieb mit ihr in Kontakt. Ihr Vater, ein österreichischer Emigrant, ursprünglich Modezeichner mit eigenem Atelier in New York, flüchtete zu Beginn der grossen Depression in den Zwanzigerjahren «upstate New York» und erwarb eine Hühnerfarm. Hier wuchs Lorayne auf und half als Kind bei der Hühnerpflege mit.
Ihre Eltern waren gegen unsere Heirat; mein Schwiegervater fand es eine Dummheit, dass seine Tochter einen Ausländer heiratete. In der historischen Kapelle der Herrnhuter Brüdergemeine (Moravian Church) in Bethlehem Pennsylvania heirateten wir im Jahr 1958. Wir hatten eine ganz wundervolle Ehe, und ich liebte meine Frau sehr, die mir drei Töchter schenkte – Naomi, Gabrielle und Claudia. Leider starb sie 1982 an Leukämie. Wir hatten alles versucht, aber sie war unheilbar krank. Nach dem Tod meiner Frau habe ich mich komplett in die Arbeit gestürzt. Sicher habe ich die Kinder in jener Zeit vernachlässigt, was mir heute noch leid tut. Dieser Tod war für mich ein schwerer Schock. Ich brauchte lange, um wieder aufzustehen. Es ist ein Glück, dass mich eine gute Freundin von Lorayne später mit Joe bekannt machte. Wir heirateten 1984. Sie ist auch Amerikanerin und eine liebenswerte Partnerin.
Wenn ich auf mein Leben zurückschaue, waren die schwersten Zeiten die Jahre auf dem Gymnasium und das Sterben meiner ersten Frau. Aber immer wieder ging es irgendwie weiter. Ich glaube, meine Glaubensüberzeugung hat mich durch die Jahre gebracht – durch Leid und Freud. Ohne den Schutz, die Liebe und die Führung durch eine höhere Macht, für mich ist es ein identifizierbarer Gott, wäre ich nie so weit gekommen. Ich glaube an einen gütigen, nicht strafenden Gott, der uns immer wieder neu anfangen lässt. Versöhnung ist mir so wichtig. Und das zweite ist die Fürbitte. Ich bin in so vielen Situationen beschützt worden, im Privatleben, im Militärdienst, in der Karriere, in der Ehe – ich bin immer tief unter dem Eindruck gestanden, dass andere für mich gebetet haben. Die Vergebung und die Fürbitte, das sind die zwei Anker meines Glaubens, und die haben mich nie verlassen.
Die berufliche Tätigkeit wurde ein Stück weit meine Heimat. Die fünfundzwanzig Jahre im Farben- und Chemikaliengeschäft – Geigy war diesbezüglich weltweit eine der führenden Unternehmungen – waren gekennzeichnet von zwei besonders herausfordernden Perioden, die ich als Leiter der Planung und Administration der US-Division intensiv miterlebte: 1970 die Fusion mit Ciba – Antitrust-Gesetze bedingten den Verkauf von Cibas Farbstoffgeschäft in den USA an eine Drittfirma – und 1973 die Verlegung der neu organisierten Ciba-Geigy Dyestuffs and Chemical Division von New York in den Süden nach North Carolina ins Zentrum der Textilindustrie. Anfangs hatten wichtige Spezialisten unter unseren Mitarbeitenden grosse Bedenken, mit ihren Familien nach Greensboro, dem gewählten Standort, zu ziehen. Es hiess, die Schulen seien dort schlecht. Überdies hatten sie Angst vor dem Ku-Klux-Klan, dem rassistischen Geheimbund in den Südstaaten, der sich vor allem die Unterdrückung der Schwarzen auf seine Fahne geschrieben hatte und seit der Integration in den Fünfzigerjahren wieder unerwarteten Aufschwung verzeichnete. Aber der Standort Greensboro wurde für Ciba-Geigy zum Erfolg. Ja, auch die grosse Agricultural Division von Ciba-Geigy entschloss sich zum Umzug nach Greensboro in die grosse Anlage, die wir dort erworben hatten. Schliesslich zogen vierhundert Familien hierher. Ich selber kam als Erster mit meiner Familie am 1. Januar 1973 – es war der Beginn einer spannenden und wichtigen Zeit in unserem Leben.
«It is very necessary to get a break» – ein amerikanisches Sprichwort. Es ist wichtig, im richtigen Moment an die richtigen Leute zu gelangen und dann zuzupacken. Das hat nichts mit Vetterliwirtschaft zu tun. Bis in die oberste Leitung der Firma habe ich es nicht geschafft. Und ich musste mich behaupten neben Harvard- und Princeton-Absolventen. Neben ihnen hatte ich es mit weniger Ausbildung und schlechterem Englisch nicht einfach. Ich brauchte oft mehr Zeit für meine Entscheidungen. Aber ich schaffte es ohne Universitätsstudium. Und ich wusste immer, wo mein Platz war. Als es einmal um einen höheren Posten ging, für den ich im Rennen war, sagte mir der Präsident, ein alter Kollege: «Du bist zu nahe bei den Leuten, darum kannst du sie nicht rauswerfen».
Ich verstand die Kritik. Ich musste mich wohlfühlen in meiner Haut und mir treu bleiben. In den Grossfirmen Amerikas ist es wichtig, beruflich immer höher zu steigen. Die Karriere zählt. Aber ich weiss, man kann sich auch verlieren, überschätzen und dann unweigerlich abstürzen.
1989 bin ich als Vice President und Direktor der Greensboro-Niederlassung von Ciba-Geigy zurückgetreten. Ich war 62 und fühlte: Man muss gehen, bevor der «burnout» einsetzt. Heute will man nicht mehr, dass die Leute jahrelang in derselben Firma bleiben und dann für die geleisteten Dienste eine Uhr bekommen. Sie wollen keine Sesseldrücker feiern. Der Gründer von Apple, Steve Jobs, suchte den ständigen Turnover – Leute mit neuen Gedanken und unbelastet von Vergangenem. Das ist Gedankengut des 21. Jahrhunderts. An der Abschiedsparty bei meinem Rücktritt staunten jüngere Mitarbeitende: «Wir können es nicht fassen, dass Sie so lange bei der gleichen Firma blieben.»
Von Zuhause aus erzogen, Verantwortung im öffentlichen Leben zu tragen, war ich während der nächsten zehn bis fünfzehn Jahre – bis zu meinem 77. Geburtstag – weiter in verschiedenen lokalen und regionalen Organisationen tätig, so unter anderem im Vorstand einer Gruppe von Spitälern der Region und im Aufsichtsrat für Kinderhorte und Tagesheime. Daneben hatte ich ein Mandat als Vorsitzender der Stadtund Bezirkskommission für Planung und Wirtschaftsentwicklung der Region. Ciba-Geigy unterstützte mich in dieser Tätigkeit fürs Gemeinwohl und überliess mir grosszügig ein Büro. Meine grosse Befriedigung ist, dass heute Dinge in Greensboro und Umgebung wahr geworden sind, die wir damals angedacht und geplant haben.
Jetzt ist mein Leben mit Joe ruhiger geworden. Ihre und meine Kinder besuchen uns, oder wir sind zu ihnen und unseren achtzehn Grosskindern unterwegs nach New York, Washington, Boston, Rhode Island und Arkansas. Die Reisen in die Schweiz werden seltener. Aber Heimweh nach Basel, nach dem Münsterplatz und nach den Bergen habe ich immer wieder. Und wenn ich ans Hotel Edelweiss in Mürren mit direktem Blick auf Eiger, Mönch und Jungfrau denke, wird mir warm ums Herz. Doch zurück in die Schweiz, um dort zu leben, das könnte ich nicht mehr. Ich fühle mich heute zuerst als stolzer Amerikaner, aber gleichzeitig auch als treuer Auslandschweizer und Basler. Das ist alles vereinbar.