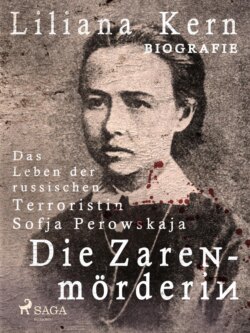Читать книгу Die Zarenmörderin - Das Leben der russischen Terroristin Sofja Perowskaja - Liliana Kern - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4. Kapitel »Gang ins Volk«
Оглавление»Verlaßt diese Welt, die zum Untergang verdammt ist, so schnell wie möglich, diese Universitäten, Akademien und Schulen, aus denen man euch jetzt hinauswirft und in denen man sich immer bemühte, euch vom Volk zu trennen. Geht ins Volk! Das ist euer Arbeitsfeld, euer Leben, eure Wissenschaft. Lernt vom Volk, wie man dem Volk dienen und seine Sache besser führen kann. Begreift, Freunde, daß die gebildete Jugend nicht Lehrer, nicht Wohltäter und nicht befehlender Diktator sein soll, sondern ausschließlich Geburtshelfer der Selbstbefreiung des Volkes, einiger seiner Kräfte und Anstrengungen«, beschwor der in der Schweiz lebende Michail Bakunin, der schillernde Theoretiker und Vater des russischen Anarchismus, die »jungen Brüder in Russland«.
Auch Petr Lawrow, Mathematikprofessor aus Sankt Petersburg, rief aus seinem westlichen Exil den Jugendlichen zu: »Nur im Volk gibt es genug Kraft, genug Energie, genügend Frische, um die Revolution durchzuführen, die die Lage Rußlands bessern kann. Das Volk aber ist sich seiner Kraft nicht bewußt, kennt nicht die Möglichkeiten seiner wirtschaftlichen und politischen Feinde. Man muß sich erheben. Im lebendigen Element der russischen Intelligenzija liegt die Verpflichtung, es aufzuwecken, aufzurichten, seine Kräfte zu einen, es in die Schlacht zu führen.« Die während der bereits erwähnten Studentendemonstrationen erschienenen Istoritscheskije pisma (Historische Briefe) Lawrows wurden »zum Evangelium der russischen Jugend«. Ebenso gehörte seine Zeitschrift Wpered (Vorwärts) zu den meistgeschmuggelten Publikationen der »Tschaikowzen«.
Die beiden Philosophen, die überwiegend unter Studierenden ihre Anhänger hatten, sahen im Gegensatz zu den westlichen Denkern nicht im Arbeiter, sondern im Bauern den Träger der künftigen sozialen Umwälzung. Unter dem Einfluss dieser Lehren verlagerten nun die »Tschaikowzen« ihre Aufklärungsaktivität vom Universitätsgelände in die russischen Dörfer.
Den flammenden Rufen ihrer ideologischen Propheten folgend, in der festen Überzeugung, es reiche aus, die Bauern lediglich aufzuklären, und schon würden diese sofort zu den Waffen greifen, zogen die ersten Kommunarden, unter ihnen auch die neunzehnjährige Sofja, voll schwärmerischen, inbrünstigen Enthusiasmus schon Mitte August 1871 in die triste Provinz Zentral- und Südrusslands. Die Bauernaufklärung war eigentlich einer der Tätigkeitsschwerpunkte der jungen Idealisten. Gleichermaßen waren sie von dem Wunsch beseelt, die Schuld ihrer Väter, der Gutsbesitzer, zu sühnen, das den Leibeigenen einst widerfahrene Unrecht wiedergutzumachen. Eigentlich waren die Bauern zu diesem Zeitpunkt keine Fronpflichtigen mehr, da Alexander II. vor einem Jahrzehnt die Leibeigenschaft abschafft hatte.
In den Dörfern eingetroffen, ließen sich die wohlbehüteten Sprösslinge der adeligen Familien, als Tagelöhner oder Schwarzarbeiter verkleidet, in diversen Handwerkerberufen vor Ort anlernen und eröffneten daraufhin Tischler- und Schusterwerkstätten, Sattlereien oder aber betätigten sich als Lehrer sowie Feldscher, um dem Volk auch auf diese Art und Weise nützlich sein zu können.
Die Idee, die körperliche Arbeit der Agitation hinzuzufügen, fanden die »Tschaikowzen« im schon angesprochenen Werk Tschto delat? (Was tun?), welches sie bereits zur Kommunengründung inspiriert hatte. Auch diesmal stand einer der Romanhelden den jungen Leuten Modell, und auch diesmal ging es da um eine Eins-zu-eins-Umsetzung der fiktiven Verhältnisse in die Realität. In der Figur des Intellektuellen Rachmetow schuf Nikolaj Tschernyschewski den Prototyp des sogenannten Berufsrevolutionärs, eines Asketen, der den niedrigsten Beschäftigungen nachgeht, weil er dadurch Achtung und Liebe des ganzen Volkes erwerben will, der von seinem Vermögen nur den für seinen Eigenbedarf notwendigen Teil behält und den Rest verschenkt, der letztendlich sein ganzes Leben ausschließlich der Revolution widmet.
Aber genauso wie im Falle der Kommuneneinrichtung zeigte es sich auch hier allzu schnell, dass zwischen den leidenschaftlichen Worten ihrer Theoretiker und der Wirklichkeit ein unüberbrückbarer Abgrund klaffte. Von Lawrow’scher Kraft und Frische fanden die »Narodniki« (»Volkstümler«) – wie die »Tschaikowzen« in der Fachliteratur bezeichnet werden – nicht die geringste Spur. Im Gegenteil wurden sie mit einer dermaßen desolaten Situation konfrontiert, die die schlimmsten Vorstellungen der jungen Leute weit übertraf.
So war es auch bei Sofja. Der »Gang ins Volk« verschlug sie ins Wolgagebiet, in die Nähe des Städtchens Stawropol, wo sie als Grundschullehrerin die Propagandaarbeit starten sollte: »Seit zwei Wochen befinde ich mich im Gouvernement Samara. Es sind schon drei Tage her, dass ich aus der Stadt ins Dorf gezogen bin«, schrieb sie an ihre »Tschaikowzen«-Freundin Alexandra Obadowskaja Anfang Mai 1872. »Egal wo du hinschaust, überall, rundherum schlummert alles in einem tiefen Totenschlaf, kein Hauch von irgendeiner intellektuellen, anspruchsvollen Beschäftigung oder einem sinnvollen Dasein, weder in den Städten noch in den Dörfern. Die Bauern vegetieren vor sich hin, denken über nichts nach. Sie handeln wie leblose Maschinen, die einmal für immer eingeschaltet sind, und so laufen sie weiterhin, eben nach Programm. Diesen Zustand entnimmt man am deutlichsten zwei Lehrerinnen, die ich hier kennen gelernt habe: Sie sind so schweigsam, so traurig, und es ist schade, da die beiden so jung sind, so voller Kraft, für eine vernünftige Arbeit wie geschaffen. Aber hier findet man so was nicht, denn die Umstände haben hier schon längst den Geruch eines Aases angenommen.
In diesen Tagen überkommt mich eine solche Trauer, dass ich zu nichts fähig bin. Alles um mich herum bringt mich schier zur Verzweiflung, die Schwermut der beiden Lehrerinnen ebenso, weil ihnen auch nicht anders zumute ist. Ich will gegen diese Missstände ankämpfen und solchen Menschen wie den beiden heraushelfen, aber dazu fehlen mir sowohl Erfahrungen als auch die Fähigkeit. Jeder meiner Versuche im Kampf gegen das herrschende Elend ist schon im Vorfeld zum Scheitern verurteilt, und das Bewusstsein darüber zieht mich noch tiefer in die Depression. Es ist mir klar, dass die Änderungen nicht von heute auf morgen geschehen. Dennoch kann ich nicht dem Drang widerstehen, diesem Desaster sofort, ein für alle Mal ein Ende zu setzen, stattdessen schaue ich ihm lediglich machtlos zu.«
In der Hoffnung auf mehr Erfolg zog das Mädchen ein paar Monate später ins Gouvernement Twer, ins Dorf Jedimonowo, wo sie sich von einem Arzt zur Pockenimpferin ausbilden ließ. Parallel dazu bestand sie dank der Benutzung eines gefälschten Passes das Diplomexamen zur Grundschullehrerin, das man ihr vor einem Jahr wegen Verteilung von Flugblättern verweigert hatte. »Sofja Lwowna ging zu Fuß von Dorf zu Dorf, und in jedem blieb sie so lange, bis die Impfung fertig war«, berichtete eine Bekannte Sofjas. »Sie übernachtete und aß in der erstbesten Bauernhütte zusammen mit deren Besitzern, ernährte sich von Milch oder Brei, schlief auf dem Strohhaufen. Das Fehlen jeglichen Luxus, an den sie seit ihrer Geburt gewohnt war, machte ihr nichts aus. Sie lebte, wie sie einmal sagte, in der Phase ihrer ›Rachmetowerei‹.«
Kurz darauf kehrte Sofja nach Stawropol zurück. Dort trat sie an den bereits eröffneten Kursen für die Ausbildung von Lehrerinnen eine Stelle als Russischdozentin an. Die Lehranstalt gründete Marja Turgenewa, die Gattin des dortigen Richters. »Die Frau in einer Männerhose, mit kurz geschorenen Haaren und einem Strohhut«, die sich nach ihrem Pädagogikstudium in der Schweiz nun anschickte, das dort erworbene Wissen an die jungen Russinnen weiterzugeben, lud zwecks Unterstützung alle Freiwilligen ein. »Sofja Perowskaja blieb mir im Gedächtnis als eine blühende junge Frau. Sie hob sich ganz stark von ihren Kolleginnen ab, da sie stets Stiefel, kurze schwarze Röcke und um die Taille gegürtete Herrenhemden anhatte«, berichtet Marja Karpowa, eine der Kursteilnehmerinnen, Sofja in ihren Memoiren.
»Auch ihr Benehmen war sehr originell, sodass sie rasch die Aufmerksamkeit der Einwohner auf sich lenkte. Nach dem Unterricht ging sie mit einem Buch in den benachbarten Wald und blieb dort bis zum Abend. Pilz- und Beerensammler sahen sie sehr oft auf dem nackten Boden schlafen oder Blumen und Kräuter pflücken, weswegen die Ortsweiber das Gerücht verbreiteten, die Perowskaja sei eine Hexe. Aus diesem Grunde stellten die jungen Kerlchen sie unter Beobachtung, spionierten ihr nach und drohten, sie umzubringen. Wir haben sie davor gewarnt, aber sie winkte lachend ab und ließ sich nicht abschrecken. Ab und zu fuhr sie mit dem Boot auf das andere Wolgaufer, wo sie dann auch übernachtete. Während der Ferien nahm sie die Pockenimpfung wieder auf.«
Aber auch der neue Schwung währte nicht lange: »Ich befinde mich in einer furchtbaren Stimmung«, klagte Sofja der Alexandra Obadowskaja einige Wochen danach. »Über mein Dasein hier kann ich dir nur sagen, dass ich einfach in den Tag hinein lebe und mittlerweile sogar mit dem Impfen aufgehört habe. Die Kurse finden nicht mehr statt, weil die Ortsbehörden den Mädchen verboten haben, sie zu besuchen. Wie du siehst, habe ich keine Ahnung, wie ich weiterleben soll. Aber eines weiß ich ganz genau, ich will eine Arbeit, egal welche, sogar körperliche, egal, Hauptsache, es gibt sie. … Ich würde so gerne von hier weg, aber dafür fehlt mir das Geld. Deswegen bitte ich dich, schau dich mal um, frage, ob ich irgendwo eine Beschäftigung bekommen könnte. … Denn nur so, in vier Wänden allein, stets mit einem Buch vor der Nase, tagelang nichts Vernünftiges zu tun oder aber mal mit diesem, mal mit jenem zu quatschen, macht alle meine Sinne stumpf. Dann kann ich auch nicht mehr lesen, sondern tigere von einer Zimmerecke zur anderen, irre durch den Wald, und hinterher fühle ich mich noch elender, werde noch apathischer, sodass ich auf alles, was mich hier umgibt, mit einem Widerwillen reagiere.«
Noch schlimmere Erfahrungen machte Wera Figner, die sich nach der Ehescheidung sowie der Rückkehr aus der Schweiz den Bauernpropagandisten anschloss und sich als Feldscherin in einigen Dörfern des Gouvernements Saratow betätigte: »Schmutziges, ausgemergeltes Volk, die Krankheiten alle verschleppt, bei den Erwachsenen meist Rheumatismus, Kopfschmerzen oft seit fünfzehn Jahren, fast bei allen Hautkrankheiten, nur in einzelnen Orten gab es Bäder, sonst wusch man sich in einem russischen Ofen, unheilbare Magen- und Darmkatarrhe, Bruströcheln, mehrere Schritte weit vernehmbar, Syphilis bei Leuten jeglichen Alters, Geschwüre und Eiterbeutel ohne Ende. Und all das in unsäglichem Schmutz von Wohnung und Kleidern, bei schlechter und unzureichender Nahrung. … Oft vermischten sich meine Tränen mit den Mixturen und Tropfen, die ich für die Unglücklichen bereitete.«
In den Feldscherambulanzen waren die Arbeitsbedingungen ebenfalls katastrophal: »Von dem Dorfschulzen zusammengeklingelt, füllten im Nu dreißig bis vierzig Patienten das enge Zimmer, unter ihnen sowohl alte als auch junge Leute, viele Frauen, noch mehr Kinder, deren Wimmern und Schreie einen nicht gleichgültig ließen. Ich gebe zu, ich wußte zwar über die Nöte und das Elend der Bauern, aber nur theoretisch, durch das Lesen von Büchern, Zeitschriften oder wissenschaftlichen Abhandlungen«, so die Figner weiter. »Bis spät in die Nacht verteilte ich ihnen geduldig Pulver und Salben, die ich in Scherben von Küchengeschirr geben mußte, allerlei Medizin und Tinkturen, die ich in Krüglein und Gläschen goß. Dabei erklärte ich ihnen drei- oder viermal, wie sie die Medikamente zu benutzen haben. Wenn ich endlich fertig war, warf ich mich auf mein Nachtlager, einen Strohhaufen, den man für mich auf dem Boden ausgestreut hatte, und fragte mich in meiner Verzweiflung, ob man in einer solchen Situation überhaupt noch an die Revolution denken dürfe. Wäre das nicht eine Ironie, dem durch alle möglichen Krankheiten geplagten Volk über Widerstand und Kampf zu predigen. … Drei Monate Tag für Tag begegnete mir ein und dasselbe Bild. … In diesem Zeitraum gelang es mir nicht, in die Seele des Volkes hineinzuschauen. Was die Propaganda anbelangt, traute ich mich nicht einmal, den Mund aufzumachen.«
Trotz ihrer katastrophalen Lage verehrten die Bauern Alexander II., den »Befreier«, weil er die Leibeigenschaft abgeschafft hatte.
Zu alledem bemühten sich die jungen Idealisten umsonst. Ihrer bitteren Not und katastrophalen Lage zum Trotz waren die Bauern nicht nur von der autokratischen Ordnung felsenfest überzeugt, viel mehr noch: Sie verehrten Alexander II. Der Sohn des Zaren Nikolaj I. und Marja Fedorownas, wie die Prinzessin Charlotte von Preußen, die älteste Tochter von König Friedrich Wilhelm III. von Preußen, nach dem Übertritt zur russisch-orthodoxen Kirche nun hieß, hob 1861 – wie bereits erwähnt – im Rahmen seiner Reformen die Leibeigenschaft auf, weswegen er auch als Zar der Befreier in die Geschichte eingegangen ist.
Ebenfalls im Zuge von Reformen vollzog der Imperator die Umstrukturierung der Streitkräfte, was den Bauern ebenso wesentliche Vorteile brachte. Der Militärdienst machte keinen Unterschied mehr nach sozialem Status oder Vermögen der Wehrpflichtigen, sondern erfasste ausnahmslos alle jungen Männer, welche das Alter von achtzehn Jahren erreichten. »Nun musste der Sohn eines Fürsten ebenso wie der eines Hafenarbeiters von der Pike auf dienen. … Körperliche Züchtigung wurde beim Militär abgeschafft und die Dienstzeit von fünfundzwanzig auf sieben Jahre herabgesetzt.«
Abgesehen von dem Reformwerk erfreute sich Alexander II. auch deswegen einer so großen Beliebtheit bei seinen Untertanen, weil er der erste Romanow war, der jemals seinen Fuß auf den Boden Sibiriens setzte. Dies geschah während der sechsmonatigen Reise des damals neunzehnjährigen Thronfolgers durch Russland. »Zum ersten Mal lernte Alexander das Volk, das er regieren sollte, kennen. Manchmal warf er das vorgeschriebene kaiserliche Programm über den Haufen und verließ kurzerhand die Hauptstraße, um zu Fuß irgendein obskures Dorf aufzusuchen, dessen verfallene Dächer er aus der Ferne erblickt hatte. … Auf diese Weise verbrachte Alexander einen Teil der Zeit, die er einem Empfang bei einem Generalgouverneur hätte widmen sollen, damit, das harte Los der Bauern wenigstens ein bißchen kennen zu lernen.« Ohne Zweifel waren die Russen von ihrem zukünftigen Herrscher, dem großen, schlanken Jüngling mit dunklen Haaren und ebenmäßigen, maskulinen Gesichtszügen und von seiner Paradeuniform fasziniert.
Nach der Rückkehr kommentierte sein Erzieher, der Dichter und Philosoph Wassili Schukowski, ein leidenschaftlicher Humanist ohne jegliche politischen Ambitionen, von dem die Reiseinitiative letztendlich ausgegangen war, es sei »in Anwesenheit des ganzen Volkes zu einer Verlobung des zukünftigen Imperators mit dem Mütterchen Russland« gekommen.
Das Volk vergaß dem Monarchen ebenso nicht, dass er die Gesamtausgaben für seine am 19. Februar 1855 in Moskau abgehaltene Krönungszeremonie, »alles bis hinunter zu den Gratismahlzeiten und dem Freibier für die Moskauer Bevölkerung«, aus seiner Privatschatulle finanziert und dadurch die Staatskasse entlastet hatte, welche durch die Kosten des Krimkrieges sowie die Zahlung der Kriegsentschädigungen arg in Mitleidenschaft gezogen war.
Die Beziehung der Bauern zu Alexander II. war also emotional begründet, daher beschuldigten die vormals Fronpflichtigen nicht den Zaren, sondern ihre ehemaligen Herren, dass ihnen das Erlangen der Freiheit auch nach zehn Jahren keine sichtbare Besserung des Lebensstandards bescherte, dass sie nach wie vor lediglich als lebendes Gutsinventar, als Objekt der Reform fungierten. Damit lagen sie nicht ganz falsch. In der Tat suchte der Herrscher nach einer Lösung für die Quadratur des Kreises. Die Bauernbefreiung entstand auf den Trümmern adeliger Privilegien, und die Grundbesitzer waren am Vorantreiben von Reformen keineswegs interessiert. Sie legten dem Zaren permanent Steine in den Weg, es knirschte gewaltig im Getriebe. So blieb Alexander II. nichts anderes übrig, als zwischen der Szylla der Gutsherren und der Charybdis der Rechte der Bauern zu lavieren.
Darüber hinaus herrschte der Monarch über ein etwa einhundert Millionen Einwohner zählendes Imperium, das beinahe ein Sechstel des Festlandes der Erde umfasste: In West-Ost-Richtung erstreckte sich Russland von Warna am Schwarzen Meer und Königsberg an der Ostsee bis zum Pazifischen Ozean, während seine Südgrenze tief in das Gebiet Zentralasiens eindrang, woraus wiederum eine enorme nationale, kulturelle und letztendlich wirtschaftliche Vielfalt entstand. Es war also keine leichte Aufgabe, einen einheitlichen Gesetzeskodex auszuarbeiten, der sowohl dem weitgehend europäisierten baltischen Adel als auch demjenigen aus den entferntesten Winkeln Sibiriens oder etwa Kasachstans oder Turkmenistans Rechnung tragen konnte.
Die schleppende Durchführung des Erneuerungsprozesses hatte ihre Ursache ebenso in einer »gewissen Halbheit in Alexanders Charakter«, in mangelndem Selbstvertrauen und dem daraus resultierenden Wankelmut, kurzum in der Unfähigkeit des Zaren, mit Konflikten fertig zu werden. Der zermürbende Kampf brauchte allmählich die Energie des Imperators auf, sein Asthmaleiden verschlechterte sich, und der Zweifel ergriff Besitz von seinem Gemüt.
Trotz des erbitterten Widerstands seitens des reaktionären Lagers sowie persönlicher Schwankungen ließ sich Alexander II. von vornherein über die Tatsache nicht hinwegtäuschen, dass die Abschaffung der Leibeigenschaft nur noch eine Frage der Zeit war, und in diesem Falle befürwortete er lieber »eine Umwälzung von oben als eine von unten«.
Im Falle ihres »Wandels von unten« begriffen die »Tschaikowzen« letzten Endes, dass er gescheitert war, aber nicht an Lethargie oder Bildungsmangel der ehemaligen Leibeigenen, sondern an deren eisernem Festhalten am »bäuerlichen Zarenmythos«. Aus diesem Grund betrachteten die Bauern die Appelle zum Aufruhr als ein Komplott ihrer ehemaligen Herren, die sich auf diesem Wege des »Väterchens Zar« entledigen wollten. In den jungen Idealisten vermuteten sie Strohmänner, hinter denen die Adeligen die Strippen zogen. Die ehemaligen Fronpflichtigen begegneten deshalb den jungen Agitatoren misstrauisch und ließen sie in ihren Häusern nicht übernachten. Wenn sie das doch taten, dann beschatteten sie die »Gäste« auf Schritt und Tritt, aus Angst, bestohlen zu werden.
Bei einer Übernachtung bekam einer der jüngsten »Volkstümler«, der siebzehnjährige Lew Dejtsch, ein schwächlicher, bebrillter Junge mit schmalem Gesicht, von seinem Gastgeber erzählt, wie dieser einen Propagandisten überführt habe. Der Bauer ließ sich mit dem jungen Mann in ein Gespräch ein, als würde er sich für die Bücher, welche der Agitator bei sich trug, interessieren, und äußerte dabei den Wunsch, einige von ihnen zu bekommen. Die beiden verabredeten daraufhin einen Termin für den nächsten Tag, wo und wann die Übergabe stattfinden sollte. Nachdem sie Abschied voneinander genommen hatten, verständigte der Bauer die Polizei. »Ich lag auf einer Bank, die sich längs der Wand hinzog, und beobachtete den Bauern«, so Dejtsch. »Ein selbstgefälliges Lächeln schwand nicht aus seinem Gesicht. … Ich fragte mich nur, was weiter kam, obwohl das Ende leicht begreiflich war. Ein Polizist kam zum vereinbarten Treffpunkt und arretierte den unglücklichen Propagandisten samt allem Beweismaterial. Für den Verrat erhielt der Bauer einige Rubel. Ich legte mich mit dem Gesicht gegen die Wand und blieb bis zum Morgen wach.«
Doch nicht nur bei den Bauern stießen die »Volkstümler« auf Unmut. Gleichermaßen waren sie den Dorfverwaltern und inbesondere den Priestern ein Dorn im Auge. Um den jungen Leuten zu zeigen, dass sie dort unerwünscht waren, scheuten sie vor keinem Mittel zurück, weder vor Intrigen noch vor Gerüchten, weil »das Leben im Dorf eine nimmersatte Habgier nach zusätzlichen Einnahmequellen prägte«, so Wera Figner. »Unsere Anwesenheit stellte eine direkte Bedrohung für sie dar. Wenn ich neben dem Popen am Bett des Kranken stand, konnte er dann um den Preis des geistlichen Beistandes feilschen? Wenn ich der Gerichtsverhandlung beiwohnte, ging gewiss der Schreiber an diesem Tag leer aus, ohne übliche Geldgeschenke oder Naturalien. … Bevor ich überhaupt begriff, was sich da abspielte, erfuhr ich von den Bauern, dass der Priester behauptete, ich lebte illegal und beherberge bei mir die Kriminellen. Damit aber nicht genug, er beteuerte auch, ich hätte keine Schule besucht, besitze keine Zeugnisse und sei so viel medizinisch ausgebildet wie er selbst. … Am Schluss schrieb er in dem Bericht an die Bezirksverwaltung, die Stimmung in seiner Gemeinde habe sich seit meiner Ankunft radikal verschlechtert: Nur noch wenige kämen in die Kirche, die Bauern würden nicht mehr so fleißig arbeiten, und überhaupt seien die Leute widerspenstig und ungehorsam geworden.«
Natürlich gab es unter den Bauern auch diejenigen – wenn auch ganz rar gesät –, die mit den jungen Idealisten sympathisierten und sogar selbst als Propagandisten agiert hatten. Einem solchen begegnete Jekaterina Breschkowskaja. Die mittelgroße, schwarzhaarige Frau mit strengen Gesichtszügen gehörte zu den ältesten Propagandisten, obwohl sie erst dreißig Jahre alt war, als sie »ins Volk« ging und dafür den Ehemann und das Kind verließ. Da sie nicht genau wusste, wo der von ihr gesuchte Mann wohnte, erkundigte sie sich mehrmals unterwegs. Die von ihr angehaltenen Passanten bemühten sich um jeden Preis, auch den Grund ihres Besuches in Erfahrung zu bringen, und so erfand die Breschkowskaja stets neue Geschichten, um sie loszuwerden. »Endlich stand ich vor der Tür, und die war geschlossen. Ich klopfte lange und heftig, bis ein korpulenter, kräftiger Bauer mit einem roten Gesicht, zerzausten Haaren und schwarzen, glänzenden Augen vor mir erschien. Offensichtlich stand er unter Alkoholeinfluss. Außerdem sah man ihm sofort an, dass er erst von mir geweckt wurde. Ohne etwas zu fragen, sagte er mir sofort, seine Frau sei nicht da, worauf ich antwortete, ich würde eine Weile auf sie warten. Wir setzten uns auf die Bank, und ich fing das Gespräch an:
›Ich habe gehört, Sie würden sich für Arbeiterrechte einsetzen und bei den Versammlungen ganz klug diskutieren. Sie seien reichlich über die Situation informiert.‹
Mein Gesprächspartner lächelte mich an:
›Ja, das tue ich, aber mich unterstützt niemand. Die Leute haben Angst. Wenn ihre Vorgesetzten sie anschreien, verkriechen sie sich sofort in die Löcher und mucken nicht auf.‹
Merklich aufgeregt erzählte er, wie er in den Fabrikhallen vor den Beschäftigten aufgetreten sei, aber plötzlich verlangsamte sich sein Redefluss, wobei er ständig ein und dasselbe wiederholte. Als ich ihm die Hand zum Abschied reichte, kam er wieder zu sich, zog rasch eine unter der Bank stehende Flasche hervor und stellte zwei Becher auf den Tisch: Ich solle bleiben und mit ihm trinken, versuchte er, mich zu überreden. … Unterwegs ließ mich das Gefühl bitterer Enttäuschung nicht los.«
Den niederschmetternden Erfahrungen zum Trotz bemühten sich die »Volkstümler« weiterhin hartnäckig, die Bauernmasse zur Revolution zu bewegen, aber im Laufe der Zeit stieg permanent die Zahl derjenigen, welche die aussichtslose Lage nicht verkrafteten und die Dörfer nach und nach verließen.
Da der »Gang ins Volk« nicht die angestrebten Resultate brachte, widmeten sich nun die »Volkstümler« der Arbeiterschaft. So äußerte Sofja im Sommer 1873, nach ihrer Rückkehr in Petersburg, den Wunsch, sich an der Propagandaarbeit in den Fabriken zu beteiligen, und wurde mit der Agitation unter den Beschäftigten in den Baumwollspinnereien beauftragt, woraufhin das Mädchen zusammen mit dem »Tschaikowzen«-Veteranen, dem Leutnant Leonid Schischko, eine Wohnung in der Saratow-Straße, in der Nähe der besagten Betriebe, anmietete. Die beiden gaben sich mithilfe der gefälschten Pässe als Ehepaar aus. Diese konspirative Taktik war unter »Tschaikowzen« sehr beliebt, da die Wohngemeinschaften von alleinstehenden jungen Leuten sofort ins Fadenkreuz der Polizei gerieten.
Ende September zog Sofja dann mit dem siebzehnjährigen Dmitri Rogatschew, dem Sohn eines reichen Landbesitzers, zusammen. Vor geraumer Zeit war der junge Artillerieoffizier der Despotie seines Vaters entronnen und hatte sich den »Tschaikowzen« angeschlossen. Die »Eheleute« ließen sich hinter dem Newa-Tor, in der Nähe der Textilfabrikkomplexe, nieder. »Der schweigsame, gutmütige Rogatschew, der schon zuvor eine fiktive Ehe geschlossen hatte, verhielt sich den anderen gegenüber immer distanziert, ja geradezu unterwürfig«, somit funktionierte die »Partnerschaft« einwandfrei. Bei diesem Umzug handelte es sich ebenfalls um einen Auftrag. Die von dem falschen Bräutigam Sergej Sinegub betriebene Propaganda in den Textilbetrieben stieß auf eine außergewöhnlich große Resonanz; so benötigte er Unterstützung und lud Sofja und Rogatschew zur Hilfe ein. Sinegub war auch der erste Nachbar des »Paares« und lebte mit seiner inzwischen nicht mehr fiktiven Frau Larissa zusammen: Die beiden hatten sich wirklich ineinander verliebt.
Die Propaganda unter der Arbeiterschaft war keine neue Wirkungsdomäne der »Tschaikowzen«. Schon seit der Gründung der Kommune stand die Aufklärung des Industrieproletariats in deren Interessenfokus, blieb aber vorerst im Schatten des »Gangs ins Volk«. Diese Aktivität bestand darin, die Arbeiter sowohl einzeln als auch gruppenweise in Geschichte, Physik, Geografie etc. zu unterrichten. Die Lehrstunden fanden entweder in den Fabriken oder in den konspirativen Wohnungen statt. Manchmal nahmen Sofja und ihr Bruder Wassili die Lernwilligen ins Zoologische Museum mit, um ihnen vor Ort die Darwin’sche Theorie zu erklären.
Während die jungen Idealisten in den Hallen Propaganda betrieben, konnten sie feststellen, wie sehr der russische Arbeiter genauso wie der russische Bauer unter Not und Armut litt. »Die stets laufenden Maschinen verursachten einen solchen Lärm, dass man nicht einmal hören könnte, wenn einer schreien würde, von normaler Unterhaltung ganz zu schweigen«, schildert Sinegub die Atmosphäre in einer Baumwollspinnerei. »Die Luft war zum Schneiden: Hitze und Schwüle, vermischt mit dem Gestank von Schweiß und Schmierfett, erfüllten die Räume. Der überall schwebende feine Staub verdichtete sich beinahe zu einem Nebel. Unter solchen Bedingungen musste ein Mensch zehn Stunden vor den Maschinen ausharren, und zwar immer mit derselben Konzentration, um den Moment nicht zu verpassen, wenn einer der Fäden abreißt, weil man in diesem Falle sofort zu reagieren hätte. Die Arbeit war im Stehen zu verrichten, denn es gab keine Sitzmöglichkeiten, lediglich auf den Fensterbänken, aber wer tut so was? Nach zwei Stunden verließ ich die Halle, beinahe betäubt und mit unerträglichen Kopfschmerzen.«
Die beschäftigten Frauen waren durch den harten Fabrikalltag gleichermaßen betroffen wie ihre männlichen Kollegen. Über die schwierigen Arbeitsbedingungen berichtet Praskowja Iwanowskaja, ein graziles Mädchen mit einem Zwicker, das stets schwarze Kleider mit weißen, abstehenden Rüschenkragen trug. Die Priestertochter und ehemalige Teilnehmerin der Alartschinski-Kurse gehörte ebenfalls der Gruppe der enttäuschten »Volkstümler« an und war eine Weile als einfache Kraft in einem Unternehmen zur Herstellung von Eisenseilen tätig. »Manchmal schickte man uns in die zweite Etage, die Seile mit Seife und Kunstharz zu schmieren. Da gab es keine Trödelei, schon die kleinste Unachtsamkeit konnte tragisch enden: Ich war selbst dabei, als eine junge Frau im Nu drei Finger verlor. In der Mittagspause setzten wir uns auf die schmutzigen Seilrollen, aßen und tranken Tee, um hinterher einfach darauf einzuschlafen. … Die Luft war mit Harzgeruch gesättigt. Der zog schnell in die Kleidung ein, sodass jede neue Arbeiterin schon innerhalb von zwei, höchstens drei Tagen danach roch. Nach einer Woche war er nicht mehr herauszukriegen. … Unser Tagesverdienst betrug fünfundzwanzig Kopeken, während die Männer dreißig oder sogar vierzig bekamen. …
Aber diese Frauen waren auf den Hungerlohn angewiesen, die äußerste Not hatte sie hierher getrieben. Die meisten von ihnen erzählten mir, ohne diese Arbeit würden sie auf der Straße landen. Es war ihre einzige Chance, sich den täglichen Misshandlungen der Ehemänner zu entziehen. … Mit ein paar Ausnahmen waren sie alle Analphabeten. … Wie konnte ich nun unter solchen Frauen, durch alles und jeden schon genug gepeinigt, irgendwelche Propaganda führen? … Wenn ich länger geblieben wäre, hätte ich vielleicht doch etwas in Bewegung gesetzt, weil sich ein paar Mädchen bereit zeigten, lesen und schreiben zu lernen. … Aber ich fand die Arbeit äußerst schwer und hielt dort nicht lange aus.«
Wenngleich der erwartete Erfolg auch bei der zweiten Aktion ausblieb, ließen sich die »Tschaikowzen«, die mittlerweile schon gewisse Agitationserfahrungen aufweisen konnten, nicht so leicht entmutigen. Sie starteten im Herbst 1873 den Umzug ihrer Druckerei aus der Schweiz nach Petersburg. Ein Vorhaben dieses Umfangs verlangte natürlich eine im Vorfeld gründlich durchdachte und später bis in das letzte Detail organisierte Durchführung, zumal der Transport mittels illegaler Kanäle erfolgen sollte. Zu diesem Zweck rief man eine Kommission ins Leben, und Sofja als ihrem Mitglied fiel eine der Spitzenrollen zu, was nicht überrascht. Sie erledigte alle ihr anvertrauten Aufgaben gewissenhaft und sorgfältig; Oberflächlichkeit, Arbeit auf die Schnelle waren ihr vollkommen fremd. Sogar dann, wenn es sich um eine ganz belanglose Sache handelte, engagierte sie sich maximal. Nach der einwandfrei verlaufenen Einfuhr wurde das Inventar vorübergehend in der orthopädischen Praxis von Dr. Orest Wejmer am Newski-Prospekt gelagert. Obwohl der Arzt nicht offiziell zu den »Tschaikowzen« gehörte, fand die Gruppe in ihm einen großen Sympathisanten und Helfer.
Schon an dieser Stelle stellt sich zwangsläufig die Geldfrage. Der Umzug der Druckerei, Mieten für die konspirativen Wohnungen, Reisekosten, Lebensunterhalt, Druck, Kauf und Versand von Publikationen, Honorare für die Schmugglerbanden, Finanzierung des »Passbüros« – im Jargon der »Tschaikowzen« die Anfertigung von gefälschten Reisedokumenten –, alles zusammengerechnet kostete natürlich Unsummen. Wie kamen etwa zwei Dutzend junge Menschen, deren Altersspanne zwischen sechzehn und dreißig Jahren lag, zu einem so großen Vermögen? Die meisten von ihnen, wie etwa Sofja, hatten alle Beziehungen zu ihren Eltern abgebrochen und bekamen daher keinerlei materielle Unterstützung. Diejenigen dagegen, die eine gewisse Summe regelmäßig erhielten, verfügten im Schnitt über etwa siebzig Rubel monatlich.
Die Einnahmequelle der »Tschaikowzen« hieß Dmitri Lisogub. Dieser schlanke Jüngling mit ovalem Gesicht und einer Knollennase erbte als einziger Hinterbliebener nach dem Tod der Eltern ein riesiges Kapital, bestehend aus Immobilien, Grundstücken und Wäldern. Sein ganzes Geld spendete der Student der Kommune, also der Revolution, und lebte selbst bescheidener als jeder Bauer. »Er trug immer ärmliche Kleider. Obwohl draußen der harte russische Winter herrschte, hatte er nur eine Jacke aus Segeltuch mit großen Holzknöpfen an, die infolge häufigen Waschens eher einem Lumpen ähnelte.« Der genaue Zeitpunkt des Eintritts Lisogubs in den Zirkel konnte nicht ermittelt werden. Vieles spricht dafür, dass er etwa 1870/71, also mit zwanzig oder eventuell einundzwanzig, in den »Tschaikowzen«-Zirkel eingetreten war. Wie auch immer, die Kommune verfügte über nicht mehr und nicht weniger als etwa 500000 Rubel. Um eine Vorstellung über den Wert zu bekommen, denke man an den Monatslohn eines Fabrikarbeiters, der zwischen sechzig und neunzig Rubel betrug. Lisogubs Fall liefert noch ein weiteres Beispiel dafür, wie sehr die Jugend von Tschernyschewskis Roman Tschto delat? (Was tun?) und seinem Helden Rachmetow in den Bann gezogen wurde.
Natürlich verfolgte die Polizei schon von Anfang an die Aktivitäten der Agitatoren, aber sie fand keinen konkreten Anlass zum Einschreiten. Doch im Jahr von Sofjas Rückkehr nach Petersburg bekam sie einen Hinweis bezüglich einer Schusterwerkstatt in Gouvernement Saratow, eigentlich das »Tschaikowzen«-Lager für das Propagandamaterial. Bei der Durchsuchung wurden neben Büchern, Broschüren, Adressenlisten auch gefälschte Pässe sowie zahlreiche kompromittierende Briefe beschlagnahmt. Dieser Fund zog dann weitere Kreise, und bald entfesselte sich eine massenhafte sowohl Razzia- als auch Festnahmeaktion, welche die Geschichte Russlands bis dahin nicht kannte. »Die Gendarmen stürzten sich auf Schuldige und Unschuldige; alle Kerker im Lande waren alsbald überfüllt.«
Im Zuge dieser Verhaftungswelle platzten die Gendarmen in der Nacht vom 4. auf den 5. Januar 1874 in die Wohnung von Alexandra Kornilowa. Bei ihr wohnte seit einer Weile auch Sofja, da ihr »Ehemann« Dmitri Rogatschew wieder »ins Volk« gegangen war. Obwohl bei den Mädchen außer einigen Heften, in denen die finanziellen Ausgaben des Zirkels aufgeführt waren, sowie ein paar verbotenen Gedichten kein belastendes Material gefunden wurde, nahm die Polizei beide in Gewahrsam und brachte sie in Untersuchungshaft, in denselben Häuserblock mit der berüchtigten Dritten Abteilung.
Hauptsitz der Dritten Abteilung der Kanzlei Seiner Majestät, der berüchtigten Geheimpolizei
Auch die weiteren Ermittlungen gegen Sofja ergaben keine schwerwiegenden Verdachtsmomente. Anhand der Aussage eines Studenten beschuldigte man die junge Frau lediglich der Bekanntschaft mit Mark Natanson, Sergej Sinegub, Dmitri Rogatschew, Leonid Schischko sowie einigen weiteren Propagandisten beziehungsweise warf ihr das Lesen von Lawrows verbotener Zeitschrift Wpered (Vorwärts) vor. Obgleich es keine ausreichenden, ihren Arrest rechtfertigenden Indizien waren, ließ man sie nicht frei. Sofja und ihre Freundin stellten aber keinen Einzelfall dar. Niemand von den arretierten »Tschaikowzen« wurde entlassen. Nach wie vor saßen sie alle im Gefängnis, ohne die leiseste Ahnung über ihr künftiges Schicksal.
Bei ihrer Festnahme hatte Sofja nur ein schadhaftes Kleid und schmutzige Stiefel an. Da der Aufenthalt der beiden Mädchen im »Haus an der Kettenbrücke« – wie die Petersburger die Dritte Abteilung nannten – schon mehrere Wochen dauerte und nichts darauf hindeutete, dass sich in absehbarer Zukunft etwas daran ändern würde, schickte ihnen Nadeschda Kornilowa, Alexandras ältere Schwester, Wäsche und Kleider zum Umziehen. Das Paket samt Büchern leitete Sofjas Bruder Wassili an die inhaftierten jungen Frauen weiter. Er selbst kam diesmal ungeschoren davon: Während der dreistündigen Durchsuchung fanden die Gendarmen bei ihm ein paar verbotene Bücher, aber keine Briefe oder Adressenlisten, und so nahmen sie ihn nicht mit.
So verging ein halbes Jahr, und Sofja wurde immer noch nicht vernommen. Im Laufe all dieser Monate bekam sie keine Unterstützung seitens der Familie und konnte sie nicht bekommen, weil diese lange vor ihrem Arrest in alle vier Winde zerstreut worden war. Wassili war der Einzige, mit dem das Mädchen noch Kontakt pflegte. Die inzwischen mit einem Arzt verheiratete Marja wohnte im Gouvernement Saratow, weit weg in der Provinz. Aber abgesehen von der räumlichen Distanz standen sich die Schwestern sowieso nie nah. Die Eltern hatten sich schon längst wieder getrennt. Während der Vater mit seiner Liebhaberin in Petersburg blieb, übersiedelte die Mutter auf die Krim, auf das letzte noch übrig gebliebene Landgut »Primorskoje«, das sie dank einer Abmachung mit dem Grafen vor dem Verkauf rettete. Aufgrund der drastischen Verschlechterung seines Gesundheitszustandes war Perowski dringend auf eine zweite Auslandskur angewiesen, dafür aber fehlten ihm die Mittel. Die Gräfin bot ihm die nötige Summe an, und im Gegenzug verlangte sie von ihrem Exmann, er solle das Landgut auf sie übertragen. Der Graf lehnte den Vorschlag zuerst ab, nach einem langen Hin und Her stimmte er dem Angebot aber doch zu. So gab ihm die Perowskaja achttausend Rubel, das nach dem Tod ihrer Mutter geerbte Geld, und zog daraufhin auf die Krim um. Nikolaj folgte ihr nach.
Der Graf war über Sofjas Verhaftung nicht informiert, da nicht allein seine Beziehung zur Tochter auf Eis lag, sondern mittlerweile auch die zu Wassili. Des ständigen Vorwurfs überdrüssig, er hätte die Schwester zur Flucht angestachelt, mied der Sohn die Gesellschaft des Vaters.
Auch wenn man die zerrütteten Familienverhältnisse vor Augen hat, ist es schwer nachzuvollziehen, dass die Mutter nicht einmal nach Petersburg kam, um zumindest in der Nähe der Tochter zu sein. Sofja selbst konnte sich nicht an sie wenden, da den Gefangenen in Untersuchungshaft jeglicher Briefwechsel untersagt war. Aber warum verschwieg Wassili der Mutter die Festnahme der Schwester? Allem Anschein nach kam die Gräfin gerade noch über die Runden, und die mit einer solchen Reise verbundenen Kosten verkrafteten ihre Finanzen offensichtlich nicht.
Kurzum, das einundzwanzig Jahre alte Mädchen stand in diesem langen Zeitraum, dazu noch zum ersten Mal im Gefängnis, mutterseelenallein da, vollkommen sich selbst überlassen.
»Ich weiß es nicht mehr, wer als Erster auf die Idee kam, den Vater zu Hilfe zu holen. Sonja zeigte sich damit einverstanden«, berichtet Wassili. »Voller Unbehagen, in tiefer Trauer ging ich zu ihm und sagte, dass sie sich schon seit Monaten im Gefängnis befinde und dass es keine Hoffnung auf ihre baldige Entlassung gebe. Ohne nach dem Grund für den Arrest zu fragen, versicherte er mir, mit dem Gendarmeriechef Petr Schuwalow unverzüglich über Sonja zu sprechen. Natürlich hatte die Zeit das Ihre getan, und von Vaters ehemaliger Wut auf die Tochter war nach drei Jahren nicht mehr viel übrig. Mir kam es vor, als hätte ich eine Ewigkeit warten müssen, bis er endlich zurückkehrte. Er sagte, sein ehemaliger Regimentskamerad habe ihn sehr freundlich empfangen und einem Offizier befohlen, alles, was in seiner Macht stehe, für Lew Nikolajewitsch zu tun. Dieser habe den Vater gebeten, am nächsten Tag nochmals in die Dritte Abteilung zu kommen.
Auch diesmal vergingen einige Stunden, bis der Vater endlich erschien. Dann klagte er über sein ausführliches Gespräch mit den Gendarmen, über viele Erklärungen, welche diese von ihm verlangten. Von ihnen habe er auch in Erfahrung gebracht, dass Sonja bei ihrer Festnahme in einem furchtbaren Zustand gewesen sei. … Danach habe er die Schwester kurz gesehen, wobei die beiden geheult hätten. Aber Sonja habe er noch nicht mit nach Hause nehmen dürfen und sei abermals um ein wenig Geduld gebeten worden.
Zwei Tage später erschien der Offizier bei dem Vater und verkündete, er könne die Tochter abholen, dennoch nur unter der Voraussetzung, dass sie unter Hausarrest gesetzt werde. Gespannt wartete ich auf die Schwester, bis ich sie endlich in die Arme schloss. Sonja erzählte mir, wie der Vater bitter geweint habe, weswegen auch sie die Tränen nicht zurückzuhalten vermochte.«
Dank der Kaution von fünftausend Rubel setzte die Polizei Sofja bis zum Beginn des Gerichtsprozesses auf freien Fuß, und von jetzt an lebte die junge Frau bei dem Vater. Dieser aber ging jeden Abend mit seiner Freundin zu verschiedenen Vergnügungsstätten aus, und so weilte das Mädchen bis tief in die Nacht in der leeren Wohnung allein, sehr oft auch tagsüber, weil der Graf bis ein Uhr mittags, manchmal sogar noch länger, schlief.
So blieb Sofja auch jenseits der Kerkermauern sich selbst überlassen. Die Einsamkeit, das Alleinsein konnte die junge Frau ganz schlecht ertragen – und in einer für sie vollkommen neuen Situation wie dieser erst recht nicht. Dringender als je zuvor brauchte sie einen festen Halt, eine Stütze. So dauerte es nicht lange, bis sie wieder Verbindung mit ihren Zirkelfreunden aufnahm, die entweder der Polizei entwischt waren oder aber wie sie selbst gegen Sicherheitsleistung mittlerweile entlassen worden waren. Zuerst trafen sich die jungen Leute bei Sofja. Doch bald bekam die Dritte Abteilung Wind von dem neuen konspirativen Zentrum, was die Gruppe veranlasste, nach sichereren Versammlungsorten zu suchen.
Einer von diesen war die Wohnung der Wera Figner. Dank der rechtzeitigen Warnung entkam die Feldscherin der Arrestwelle, verließ fluchtartig die Provinz und hielt sich nun in Petersburg versteckt. »Sofja Lwowna begegnete ich zum ersten Mal 1874, als sie sich unter Hausarrest befand. Alexandra Kornilowa brachte sie zu mir und bat mich, Sonja bei mir übernachten zu lassen«, berichtet die Figner. »Ihr Aussehen fiel mir sofort auf: Mit einem einfachen Hemd angezogen, ähnelte sie eher einem Bauernmädchen. Ihr Gesicht strahlte etwas Jugendliches, ja Kindliches aus, was wiederum im Widerspruch zu ihrer eisernen Willens- und Charakterstärke stand. Überhaupt prägte ihre ganze Erscheinung sowohl eine feminine Milde als auch eine maskuline Härte.«
Im Juni 1874, zur Zeit von Sofjas Entlassung, war der »Tschaikowzen«-Zirkel praktisch schon zerschlagen und daher zu groß angelegten Aktionen nicht mehr fähig, besonders nicht, nachdem sein Anführer Nikolaj Tschaikowski im gleichen Jahr die Träume von der Revolution aufgegeben hatte und in eine religiöse Sekte in Amerika eingetreten war. Andererseits hätte jede noch so harmlose Form von Propaganda ausgerechnet in diesem Augenblick verheerende Folgen für die in Gewahrsam genommenen Kommunarden gehabt, während diejenigen, die sich wie Sofja unter Hausarrest befanden, mit einer erneuten, sofortigen Festnahme rechnen mussten. Die jungen Idealisten vegetierten also vor sich hin, und die Tatenlosigkeit machte Sofja zu schaffen. Die einzige Aufgabe der jungen Frau bestand darin, mit den inhaftierten Freunden die Kommunikation aufrechtzuerhalten. Da diese immer noch den Status der Häftlinge in Untersuchungshaft besaßen, waren ihnen weder Besuche noch Briefwechsel gestattet, so waren sie weiterhin von der Außenwelt abgeschnitten. Aber ein paar Rubel, womit Sofja einen Gendarmen bestach, sorgten schließlich für einen einwandfreien Nachrichtenumlauf.
Die Passivität hielt Sofja auf die Dauer nicht aus, so fasste sie kurzerhand den Entschluss zum Umzug auf die Krim. »Der Vater begrüßte herzlich Sonjas Entscheidung, weil er sich durch ihre Anwesenheit sehr beengt fühlte.«
Etwa einen Monat später traf das Mädchen auf »Primorskoje« ein. Dort fand sie die Mutter vor, die nur mit großer Mühe das karge Dasein meisterte. Wegen hoher notarieller Gebühren verpachtete die Gräfin notgedrungen das Landgut und bewohnte zusammen mit Nikolaj ein bescheidenes gemietetes Häuschen in der Nähe des Anwesens.
Lange ertrug Sofja die provinzielle Stille der Krim nicht. Ihr Tatendrang meldete sich wieder. Obwohl die junge Frau unter Hausarrest stand, erlaubte ihr die Mutter, ins Gouvernement Twer zu fahren, wo sich das Mädchen dann in einer Arztpraxis als Aushilfe betätigte.
Die Nachricht über die Eröffnung von Kursen für Feldscherinnen, organisiert vom Landkrankenhaus in Simferopol, bewog die wissbegierige Sofja zur Rückkehr auf die Krim. Sie schrieb sich ein, und zusammen mit einigen Kolleginnen bezog sie eine Wohnung in der Stadt. »Sofja lebte äußerst zurückhaltend, widmete sich ausschließlich der Arbeit in der Klinik, weshalb sie den ungeteilten Respekt der Ärzte genoss und als deren Assistentin eingesetzt wurde, bevor sie überhaupt die Ausbildung absolvierte.
Unter ihren Patientinnen befand sich auch eine alte, an Brustkrebs dahinsiechende Frau, die Sofja einige Monate täglich zu Hause besuchte und ihr die Verbände wechselte. Das Mädchen kümmerte sich so hingebungsvoll um die Bettlägerige, dass diese kaum erwarten konnte, ihre Pflegerin wiederzusehen. Allein Sofjas Lächeln, so die Kranke, lindere ihr die Schmerzen.«
Es schien, als wäre es der jungen Frau zum ersten Mal gelungen, eine inhaltsvolle Beschäftigung zu finden, eine Beschäftigung, die sie vollkommen erfüllte, worin sie endlich einen Sinn entdeckte. Aber auch diese Erfüllung, wie übrigens jede zuvor und danach in ihrem kurzen Leben, sollte nicht von Dauer sein.