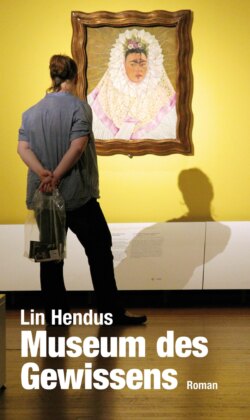Читать книгу Museum des Gewissens - Лин Хэндус - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 2 Angstkokon
ОглавлениеWer schon wünscht seinem einzigen Kind Abneigung?
Unglück?
Verfolgung oder Not?
Elend oder Misserfolg?
Gibt es denn solche Menschen auf der Welt?
In einem bin ich mir sicher – keinesfalls wären das Eltern aus einer gebildeten Familie, in der Anstand und Offenheit nicht auf aristokratischen, oft umstrittenen Stammbäumen gründen, sondern aus Fleiß, Ehrlichkeit und Fürsorglichkeit hervorgegangen sind.
Die meinen waren Eltern wie diese. Sie wünschten mir, dem zottelköpfigen Anton Glebow, geboren 1975, ihrem einzigen Sohn, nur Gutes. Von ihrem tragischen Schicksal, das sich wie ein bitteres Echo auf mein weiteres Leben auswirkte, konnten sie nichts wissen. Sie, junge und liebe Menschen, hätten nie geahnt, dass ihnen an einem warmen Herbsttag ein großes Auto entgegenkommt und dass in diesem Auto ein grölender und betrunkener junger Mann, ein Halbkrimineller, der sich nicht gut genug mit den Verkehrsregeln auskannte, am Steuer sitzen würde.
Offenbar blieb er aufgrund seines betrunkenen Zustands am Leben, als sein neuer japanischer Jeep mit unserem älteren Lada frontal zusammenstieß. Meine Eltern hatten viel weniger Glück. Genauer gesagt, sie hatten tragisches Unglück. Entweder, weil sie absolut nüchtern waren, oder weil sie die Regeln im Straßenverkehr immer beachteten und sich an die Regeln des Lebens hielten. Es ist schwer zu sagen. Aber eine große Ungerechtigkeit fand statt: Sie mussten sterben.
Beide und gleichzeitig.
Die traurige Nachricht überbrachte die Polizei per Telefon. Die Beamten bemühten sich noch nicht einmal, einen Revierpolizisten zu der betroffenen Familie zu schicken. Die sachliche Stimme des Polizisten teilte die Tatsache des Verkehrsunfalls mit und bat, zur Identifizierung zu kommen. Das Wort „Identifizierung“ bekam ich mit, wusste aber nicht, was es bedeutete. Ich stand neben meiner Großmutter und konnte nicht begreifen, warum sie weinte und plötzlich hektisch begann, sich anzuziehen, um wegzugehen. Alleine, ohne mich. Ich wollte auf keinen Fall alleine zuhause bleiben, weil mir das unbekannte Wort sowie Großmutters unerklärliche Tränen Angst einjagten. Aber eine Diskussion zwischen einem Kind und einem Erwachsenen war sinnlos – Erwachsene bleiben sowieso bei ihrer Meinung. Großmutter Alina, Papas Mutter, ließ mich bei den Nachbarn und fuhr weg. Dabei bedeckte sie ihren Kopf mit einem schwarzen Tuch.
Ab dem nächsten Tag brachte mich nur noch Großmutter in den Kindergarten. Sie holte mich auch wieder ab, weil Mama und Papa plötzlich aus meinem Leben verschwunden waren. Ohne eine Nachricht zu hinterlassen, etwas zu erklären oder ein Wort zu sagen. Sie verschwanden einfach. Als ob es sie niemals in unserer Familie gegeben hätte. Verschwanden für immer aus dem Leben des kleinen Jungen, ihres Sohnes. Und eine Woche später fuhr ich mit Großmutter Alina auf einem kleinen Lastwagen zum Friedhof. Erst an diesem Tag erkannte ich, dass ich keinen Papa und keine Mama mehr hatte. Wir waren gekommen, um sie zu beerdigen.
Zusammen.
In einem gemeinsamen Grab.
Als wir anhielten, kamen drei Männer zum Auto. Zusammen mit dem Fahrer holten sie die Särge von der Ladefläche und stellten sie auf zwei mitgebrachten Hockern ab. Die Großmutter führte mich erst zu Mama, dann zu Papa. Weil sie sah, wie sehr ich vor ihren blassen und kalten Gesichtern erschrak, erlaubte sie mir nicht, sie zu umarmen und zu küssen. Ich drehte mich von den in Holzkisten liegenden steifen Menschen, die mir auf einmal fremd geworden waren, weg, steckte meinen Kopf in Großmutters Schoß und begann zu weinen.
Die Särge wurden zugenagelt und übereinander auf den Boden gestellt. Zuerst ließen sie in die schwarze, seitlich bröckelnde und feuchte Grube den Sarg mit Papa herunter. Obendrauf wurde der Sarg mit Mama gestellt. Wir standen davor, Großmutter und ich, uns fest umarmend wie ein Baum mit zwei zusammengewachsenen Stämmen.
„Mama ist leichter, deshalb ist ihr Platz oben, und ein gemeinsames Grab ist viel billiger“, erklärte mir leise die Großmutter.
„Zusammen wird es ihnen gutgehen“, dachte ich. Damals, als kleines Kind, konnte ich noch nicht verstehen, was „billiger“ hieß.
Ich wusste auch nicht, was „Tod“ bedeutet.
So blieb ich mit Großmutter Alina, zu zweit, in unserer großen Vierzimmerwohnung in Sankt Petersburg. In dem Haus, das ganz am Anfang meines lieben Newski Prospekts stand. Vor langer Zeit hatte einmal die ganze Wohnung unserer Familie gehört. Später bewohnten wir nur zwei Zimmer, eins Mama mit Papa, das andere Großmutter Alina und ich. Die restlichen zwei Zimmer besaßen fremde Leute. Die Nachbarn wechselten sich ab, zogen zusammen und auseinander, heirateten, ließen sich scheiden, schwirrten vor meinen Augen herum, störten mich aufgrund meines Alters damals aber nicht. Meine Eltern kamen ums Leben, als ich sechs war. Damals waren sie mit einer guten Nachricht unterwegs nach Hause: Papa wurde eine neue Arbeitsstelle angeboten. Wie sich dann herausstellte, kam die Nachricht zu spät. Diese Stelle konnte er nicht mehr antreten. Angesichts des betrunkenen Fahrers kam sein Tod dem frohen Ereignis zuvor.
Zerstörte unseren Lebensrhythmus.
Verletzte das Leben meiner Großmutter und das meine.
Stürzte auf uns mit der gesamten Last eines unvermeidlichen Unglücks.
Senkte unsere Köpfe.
Beugte unsere Knie.
Soweit ich mich erinnern kann, kamen meine Großmutter und ich die folgenden Jahre nach dem tragischen Geschehen sehr gut miteinander aus. Wir liebten uns, wie sich zwei verwandte Seelen, die als einzige von der ganzen Familie übrig geblieben sind, lieben können. Wir hatten niemanden mehr, außer uns. Großmutter, ich, die Grabstätten meiner Eltern und des Großvaters Nikolaj, Alinas Ehemann, den ich nie gekannt hatte. Außer kleinen Freuden und alltäglichen Sorgen hatten wir nichts zu teilen, nur unsere Liebe und Erinnerungen an die von uns gegangenen lieben Menschen.
Die Großmutter hatte zu ihrer Zeit eine Kunstschule absolviert. Danach arbeitete sie als Kunstlehrerin in der Schule. Nach der Arbeit und an den Wochenenden gab sie Privatstunden, um etwas dazuzuverdienen. Wenn sie Glück hatte, was aber nicht oft vorkam, blieb ihr genug Zeit, um mir, dem einzigen und liebsten Enkelkind, das Malen beizubringen. Darüber hinaus konnte sie nichts. Sie konnte nur malen und Menschen lieben, meine liebste Großmutter, eine sehr gutherzige und liebevolle Frau.
Während Alina mich mit einem kleinen Stück Kreide, Stift oder Pinsel in der Hand auf einen Hocker vor die Staffelei setzte und eine weitere Aufgabe stellte, wiederholte sie oft in verschiedenen Variationen:
„Ich bin sehr froh, dass ich mich heute nirgendwohin beeilen muss und dich wenigstens eine Stunde unterrichten kann. Obwohl du mein begabtester Schüler bist, kann ich dir nur die Grundlagen des großen Kunstzaubers beibringen. Aber ohne das Alphabet zu kennen, kann man kein Schriftsteller werden. Zuerst lernt man die Buchstaben, dann bemüht man sich, sie in Worte zusammenzufügen. Danach den Aufbau der Muttersprache zu fühlen, tief im Inneren zu spüren und ihn zu lieben. Nur dann kann man beginnen, selbst zu schreiben. Nicht früher. Genauso ist es beim Malen.
Du lernst, wie man den Stift richtig in der Hand hält.
Den Pinsel.
Wie man seine Härte und Weichheit fühlt.
Lernst die Farbpalette zu verstehen und zu spüren.
Die Farben zu mischen, um den richtigen Ton zu erhalten.
Den zu malenden Gegenstand nicht nur zu sehen, sondern auch wahrzunehmen.
Irgendwann wirst du ein großer und berühmter Künstler, auf den ich stolz sein werde. Mittlerweile machst du schon die ersten Schritte zu deinem Erfolg …
Zeichne doch bitte diese alte Vase. Die haben wir von den Eltern deines Großvaters Nikolaj Aleksandrowitsch geerbt. Wenn du daran denkst, dass in ihr vor fast hundert Jahren einmal Blumen standen, hilft dir das, die Stimmung der damaligen Zeit in dein Bild zu übertragen. Verbindest du das entstandene Gefühl mit dir, dem Menschen von heute, erscheint auf deinem Papier nicht nur eine Vase, sondern ein kleines Kunstwerk. Versuche es. Es ist sehr wichtig: Lerne, die Vergangenheit und die Gegenwart des malenden Gegenstandes oder Menschen in einem Bild zu verbinden. Nur dann kannst du sein inneres Wesen, seine Seele auf das Papier oder auf die Leinwand bringen. Und dann rücken die Erhabenheit des Raffael, die Berühmtheit des Brüllow und das Beseelte des Van Gogh an dich heran. Ich glaube an dich, Antoscha, an deine Zukunft … Komm, lass uns arbeiten.“
Ich liebte die Erzählungen meiner Großmutter sehr. Sie erklärte nicht alles in diesen gewöhnlichen grauen und alltäglichen Tönen, wie die Lehrer in der Schule, die Nachbarn in der Gemeinschaftsküche, die Eltern meiner Freunde. Ihre Sprache war lebhaft, interessant, leicht und irgendwie märchenhaft. Sie wusste, was ich wollte, und ich hatte keine Geheimnisse vor ihr. Wie auch sie nicht vor mir. Großmutter schimpfte niemals, und wenn jemand sie verletzt hatte, setzte sie sich ans Fenster und dachte sehr lange nach, während sie leise dabei weinte. Sie dachte, ich sähe ihre Tränen nicht. Ich wollte sie trösten, beruhigen, denjenigen bestrafen, der ihr wehgetan hatte, weil ich jetzt der einzige Mann in der Familie war.
Das wurde mir aber nicht gestattet.
„Antoscha“, wischte die Großmutter eines Tages ihre Tränen weg, als ich sie umarmte und mich an ihre warme Seite drückte, „es ist alles gut, mein Liebling. Setze dich hin und höre mir bitte zu, ich möchte dir etwas sagen.“
Sie setzte mich behutsam auf einen alten Polsterstuhl, trocknete ihre Augenwinkel mit einem alten Spitzentuch, legte es in die Tasche ihrer selbstgestrickten Hausjacke und schaute mich aufmerksam an.
„Siehst du, mein Lieber, wir leben in einer nicht einfachen Zeit. Nun ist dort“, sie machte eine unbestimmte Geste mit der Hand in Richtung des Fensters, „das Leben unruhig und voller Sorgen. Und wenn es im Land unruhig ist, ist auch die menschliche Seele mit Unruhen, Sorgen und Ängsten überfüllt.
Die Angst sitzt in jedem von uns.
Mit diesem Gefühl kommen wir zur Welt.
Füllt jedoch das Gefühl den ganzen Innenraum des Menschen aus, wird er wohl oder übel aggressiv und versucht, sich intuitiv von dem lästigen Gefühl zu befreien. Der Mensch hüllt sich in eine Hasswolke ein. Dann traut er sich nicht mehr aus diesem Kokon heraus. Dabei denkt er, dass man sich nur so in Sicherheit bringen kann. Dass er nur auf diese Art und Weise das, was ihn stört, aus sich herauspressen kann. Das ist ein großer Irrtum, aber er ahnt es nicht. Je länger der Mensch mit seinen Ängsten und Sorgen allein lebt, desto weniger Kraft bleibt ihm für das normale Leben – die gesamte Energie und Aufmerksamkeit wird für die Erhaltung des Hasskokons aufgebraucht, für die Selbsterhaltung in dieser unsichtbaren, harten und grausamen Wolke ...“
Für mich, als Kind, war es nicht einfach, diese Worte zu verstehen. Aus dem Biologieunterricht wusste ich damals schon, was ein Kokon war und wie er entstand. Aber wie sich ein erwachsener Mensch darin einhüllen konnte, war mir absolut unklar. So wie die Offenbarung, dass dieser Kokon, den man noch nicht einmal berühren konnte, aus Hass bestand. Das klang für mich durchweg rätselhaft. Genauso hatte ich noch nie gehört, dass sich ein Mensch in einer Wolke befinden konnte. Nur Engel schwebten im Himmel und zwischen den Wolken. Wir lebten doch auf der Erde. Wie kam es dazu? Merkwürdig und geheimnisvoll. Trotz meiner vielen Fragen brachte ich Geduld auf und hörte weiterhin aufmerksam zu, ohne sie zu unterbrechen. Ich hoffte, später würde alles viel verständlicher.
„Du denkst wahrscheinlich, dass Erwachsene ein viel einfacheres Leben als Kinder haben?“ Die Großmutter streichelte mit ihrer weichen Hand zärtlich durch meine zerzausten Haarwirbel, mit denen ich selbst sehr zufrieden war. Ohne eine Antwort von mir zu bekommen, fuhr sie fort, um keine Zeit an unnötiges Warten zu verlieren.
„Jedes Alter ist interessant, da es seine eigene Beziehungs- und Verständnisebene hat, von der aus es das Leben betrachtet. Der Mensch wird mit jedem Jahr, jedem Tag immer weiser. Dabei schaut er sein Lebensgepäck durch: Was er weiterhin mittragen und was er als unnötig empfunden wegwerfen soll. Selbst dann, wenn wir erwachsen werden, versteht nicht jeder von uns: Je weniger Sorgen wir in unserem Inneren haben, je weniger Konflikte, Probleme und Unzufriedenheit mit dem alltäglichen Leben uns begleiten, desto einfacher und fröhlicher ist unsere Existenz. Je besser wir unsere innere Welt verstehen, desto ordentlicher wird unser Leben. Für dich ist es doch auch einfacher, ein Heft zu finden, wenn du Ordnung auf deinem Schreibtisch hast. Genau deswegen räumen wir regelmäßig auf. Nicht nur die äußere Umgebung, sondern unbedingt auch dein innerer Zustand muss in Ordnung sein. Die Seele bewahren und rein halten.“
Die Großmutter schaute mich an und wartete entweder auf meine Antwort oder auf meine Fragen. Ich wollte wissen, was „Lebensgepäck“ und „Verständnisebene“ bedeuteten, wo sich bei uns die Seele befand, wie man sie rein halten konnte und was sie mit meinem Schreibtisch gemeinsam hatte. Stattdessen schoss es plötzlich aus mir heraus:
„Warum hast du geweint? Wer hat dir wehgetan?“
Nach ein paar Sekunden des Schweigens holte die Großmutter ihr Spitzentuch hervor, wischte sich damit schnell über die Augen, versteckte es wieder in der Tasche und nahm meine Hände. Direkt in meine Augen schauend sagte sie:
„Mich kann man nicht verletzen, Antoscha, weil ich niemanden verletzt habe. Geweint habe ich, weil mir in der letzten Zeit die Atmosphäre in unserer großen Wohnung nicht mehr gefällt. Ich fühle mich nicht stark genug, um uns vor Veränderungen, die bevorstehen, zu beschützen. Ich bin sehr gespannt auf unsere Nachbarn. Raschid, mit dem wir uns die gemeinsame Küche teilen, hat sich heftig über uns geäußert. All das ist nicht gut und unangenehm. Mach dir aber keine Sorgen, den Konflikt mit den Nachbarn versuche ich friedlich zu regeln. Ich habe dich, und zusammen sind wir stark.“
„Ich bin derjenige, der dich als Mann verteidigen muss!“, fasste ich Mut, dort auf dem weichen, abgewetzten Stuhl sitzend. Das Licht der leuchtenden Tischlampe fiel seitlich auf meine rechte Hand und wärmte sie angenehm.
„Schon gut, mein Liebling. Wenn du groß bist und zum richtigen Mann wirst“, die Großmutter wuschelte wieder durch mein Haar, „dann kannst du uns beide beschützen. Und bis dahin schaffe ich es selbst. Dein Ziel ist es, groß zu werden und einen Beruf zu erlernen. Wenn du mit der Schule fertig bist, bringe ich dich zur Kunstschule, die ich selbst besucht habe. Vielleicht äußerst du den Wunsch, auf die Kunsthochschule oder die Kunstakademie zu gehen. Wer weiß? Die Zeit stellt alles auf seinen Platz. Bis dahin, mein Junge, hast du noch zu wachsen.“
Kurz vor meinem vierzehnten Lebensjahr bat ich die Großmutter, mir mehr über meine Eltern und Großvater Nikolaj zu erzählen. In der Schule hatten wir die Aufgabe bekommen, einen Aufsatz zum Thema „Meine Familie“ zu verfassen. Verzweifelt wusste ich überhaupt nicht, was ich schreiben sollte. Alle hatten Mütter, Väter, Brüder, Schwestern, Tanten, Onkel und andere Verwandte. Ich jedoch hatte niemanden. Mama und Papa waren umgekommen und hatten ihr einziges Kind ohne Geschwister hinterlassen. In der ganzen endlosen Welt hatte ich nur meine Großmutter. Aber für einen vollständigen Aufsatz war sie, die allerbeste und liebevollste Frau, auf keinen Fall genug. So dachte ich damals, als ich die traurigen Fakten meines freudlosen und einsamen Lebens zusammenstellte. Dabei konnte ich nicht ahnen, dass das folgende eines unser letzten, längsten und aufrichtigsten Gespräche sein würde.
„Natürlich erzähle ich dir alles über unsere Familie. Aber eines musst du mir dabei versprechen: Dass du aus meinen Erzählungen nur das Wichtigste für die Klassenarbeit auswählst. Lügen und Unwahrheiten zu schreiben, ist nicht gut, aber man sollte gegenüber anderen Leuten auch nicht zu viel von sich preisgeben. Nicht alle von ihnen sind gut und ehrlich, so wie wir. Die betrügerische Natur der Menschen ist nicht so einfach zu erkennen, wie man denkt.“ In Großmutters Stimme hörte ich eine für mich unverständliche Traurigkeit. Erst jetzt bemerkte ich ihre tiefen Fältchen um die Augen, die sich auf der Stelle von fröhlichen in traurige verwandelten.
„Ich bin keine gebürtige Petersburgerin, mein Engelchen. Meine Eltern stammen aus dem Ural, aus dem Gebiet Kurgan. Und ihr Familienname ist für diese Gegend sehr typisch – Tschernych. Die Familie meines Vaters war wohlhabend. Das halbe Dorf arbeitete damals bei ihr. Die Menschen gaben sich damit zufrieden, dass sie Arbeit und ein Stück Brot hatten. Als die Kommunisten an die Macht kamen, flüchtete unsere Familie nach Karelien, um nicht erschossen zu werden. Ich selbst kann mich an diese Zeit nicht erinnern. Ich erfuhr es später von meiner Mutter.
Von Kindheit an liebte ich das Malen. Vor dem Krieg, als ich gerade mal siebzehn wurde, kam ich nach Leningrad und ging auf die Kunstschule. Auf dieser Schule lernte ich deinen Großvater Nikolaj Aleksandrowitsch kennen. Als junger Lehrer unterrichtete er bei den Studierenden Kunst. Ich war eine von ihnen. Du wirst es wahrscheinlich nicht glauben, aber es war Liebe auf den ersten Blick. Das passiert sehr oft zwischen jungen Menschen. Gewiss erwartet dich das auch, wenn du groß bist. So war es zwischen deinem Opa und mir. Und genauso verliebten sich deine Eltern ineinander.
Zu dieser Zeit fing schon der Krieg an, und wir konnten unser Glück nicht mehr genießen. Der Krieg brachte Elend für alle. Nikolaj wurde sofort eingezogen. Vor seiner Abreise zur Front gaben wir noch unsere Verlobung bekannt, und ich zog in das Haus seiner Eltern. Nikolajs Mutter, meine Schwiegermutter, stammte aus einer verarmten Generation der Ostseebarone. Nachdem sie einen reichen Kaufmann geheiratet hatte, kam sie zu einem Vermögen und ihr Mann zu einem Adelstitel. Das geschah noch vor der Revolution. Damals war dein Großvater noch nicht auf der Welt. Das ist eine durchaus interessante Begebenheit, eine besondere Geschichte, die nicht zum Thema deines Aufsatzes passt. Irgendwann erzähle ich dir mehr davon. Immerhin ist es nicht nur die Geschichte unserer Familie, es ist auch die Geschichte unseres Landes.
Nun, höre weiter. Ich zog also zu den Eltern meines Verlobten. In deren Familie lernte ich vieles kennen. Du weißt schon, dass meine Eltern trotz ihres Wohlstandes einfache Menschen waren. Deine Urgroßeltern väterlicherseits dagegen gehörten zum Kreis der gut gebildeten und intelligenten Leute. Nach vielen Jahren waren ihre Gefühle zueinander noch immer so zärtlich, als ob sie sich erst gestern begegnet wären. Für mich war es ein großes Vergnügen, in ihrer Nähe zu sein und ihre spannenden Erzählungen zu hören. Das waren sehr gute, nette, einfach die besten Menschen auf der Welt. Solch ein Ehepaar habe ich nie wieder im Leben getroffen. Außer vielleicht deine Eltern. Dein Vater ähnelte sehr seinem Großvater und deine Mutter meiner Schwiegermutter. Sie waren sich sehr ähnlich ...
Zu meinem großen Kummer verlor ich ganz früh meine Eltern, genauso wie du. Mein Vater kam an der Front ums Leben und meine Mutter starb vor Hunger. Mir gelang es jedoch, während dieser schrecklichen Kriegszeit dank der Familie deines Urgroßvaters am Leben zu bleiben. Er arbeitete als Leiter eines Lebensmittellagers, deshalb hatten wir immer etwas mehr zu essen als andere Familien. Satt waren wir nie, hatten aber jeden Tag unsere Mahlzeiten. Und ich hatte Glück: Nikolaj kam mit geringen Verletzungen aus dem Krieg zurück, und als er wieder gesund wurde, heirateten wir. Bald wurde unser Sohn Petenka, dein Vater, geboren. Er wurde groß, beendete die Schule, begann sein Studium und begegnete dem wunderbaren Mädchen, Iruschka Ivanova, das er später heiratete. Dann kamst du zu Welt, mein Antoscha.“
Großmutter wurde still und dachte nach. Mit traurigem Blick schaute sie die Lampe hinter meinem Rücken an. In ihren Augen zeigte sich eine Träne, dann eine weitere. Beide liefen langsam die Wangen herunter. Plötzlich, als würde Großmutter wieder zu sich kommen, holte sie tief Luft, nahm meine Hand, küsste sie und drückte sie an ihre weiche, warme und feuchte Wange.
„Der Knabe Antoscha schaffte es nicht, bis dahin groß zu werden, als Petja und Ira wegen eines betrunkenen Fahrers gleichzeitig sterben mussten. Und er blieb mit dir ganz allein“, fügte ich hinzu. Alinas Traurigkeit breitete sich in mir aus. Mein kleines Kinderherz krampfte sich zusammen. Ich wollte weinen, schämte mich aber, meine Schwäche zu zeigen. Deshalb presste ich einfach stark meine Zähne zusammen, sodass ich mir schmerzhaft auf die Zunge biss.
„Ja, mein Lieber. Genauso war es ... Es ist schwer, das Geschehene zu begreifen. Aber letztendlich ist das Leben ziemlich schlicht. Und gerade deshalb ist alles in ihm erstaunlich kompliziert. Denke daran und erschwere niemals grundlos dein Leben und das Leben anderer Menschen ...“
Nach diesem Gespräch vergingen etwa zwei Monate. Eines trüben herbstlichen Tages kam ich von der Schule nach Hause und sah vor unserer Wohnungstür Menschen in Polizeiuniform. Als einer von ihnen bemerkte, dass ich an ihnen vorbeiwollte, hielt er mich am Ärmel fest und sagte:
„Bist du Anton Glebow?“ Ja, ist doch klar. „Also, Junge, keine Eile. Bleib dort, wo du bist. Deine Großmutter gibt es hier nicht mehr.“
„Wo ist sie denn?“, fragte ich herausfordernd. „Sie wartet auf mich, weil sie weiß, dass ich aus der Schule komme. Und was machen Sie in unserer Wohnung? Lassen Sie mich durch!“
„Deine Großmutter wurde er…“, der Polizeibeamte stockte mitten im Wort, während er mich in die Richtung der Küche schob, „... eigentlich ist sie heute Morgen verstorben. Wir wurden von den Nachbarn gerufen. Geh mal zur Seite und warte solange dort.“
Die neuen Nachbarn, deren Namen ich nicht kannte und an deren Gesichter ich mich noch nicht einmal erinnern konnte, schauten mich mit großen Augen an und begleiteten mich mit fragenden, mitleidigen Blicken.
Es kam mir vor, als landete ich gegen meinen Willen in einer fremden, merkwürdigen Welt. Als schliefe ich fest und alles, was um mich herum geschah, wäre nur ein Alptraum. In meinem Kopf drehte sich alles leicht, der Boden unter den Füßen schien nicht echt zu sein, die Luft blieb mir weg. Gleich, in dieser Minute, würde ich aufwachen und alles wäre wieder so wie früher. Ich würde in mein Zimmer gehen und meine Großmutter sehen, die mir entgegeneilte.
Trotz meiner Bemühungen gelang es mir aber nicht aufzuwachen. Unbekannte Menschen mit und ohne Uniform liefen um mich herum.
Redeten miteinander.
Gaben unverständliche Worte von sich.
Schüttelten die Köpfe und schauten heimlich in meine Richtung.
Senkten die Blicke und wandten sich mühsam von einem großen dunkelroten Fleck ab, der sich unregelmäßig auf dem alten Teppich im Flur ausbreitete.
Nachdem ich ungefähr zwei Stunden später meine Sachen in Papas großen Rucksack gepackt hatte, versiegelten die Polizisten unsere zwei Zimmer, setzten mich in ihr Auto und fuhren zur Kindersammelstelle. Ohne zu erklären, was in meiner Abwesenheit wirklich zu Hause passiert war. In leicht mitfühlendem Ton wurde mir gesagt: „Bis zur Aufklärung der Sachlage.“ Welche Sachlage und wer sie erklären und aufklären musste, wurde mir nicht mitgeteilt.
Mich, einen Teenager, ließen sie in Unkenntnis meines eigenen Schicksals. Ich befand mich in absoluter Ungewissheit und fühlte mich wie an einem Gummiband aufgehängt, das mich mal herunterließ, mal wieder hochzog und durch das Schwanken Übelkeit hervorrief. Erst jetzt wurde mir klar, was ein Angstkokon, von dem mir meine Alina vor kurzem erzählt hatte, bedeutete. Keine Ahnung, wie, aber ich befand mich von Kopf bis Fuß fest eingewickelt in diesen rauen und klebrigen Kokon.
Meine Großmutter sah ich nie wieder.
Weder lebend noch tot.
Ebenso wie unsere Wohnung – meine einzige und sichere Zuflucht. Schlechte Menschen warfen mich aus dem Elternhaus in die ungewisse Welt hinaus und schlossen die Türe fest hinter mir, hinter der mein früheres Leben zurückblieb. Zwangen mich mit jeder Zelle meines Körpers, die unsichtbare und enge Grenze zwischen dem Guten und Bösen zu spüren, zwischen Barmherzigkeit und Gleichgültigkeit, Liebe und Hass. Zwangen mich unfreiwillig auf das unendliche und leere Feld unter meinen Füßen zu schauen.
Bei Antoscha Glebow fanden sich weder nahe noch entfernte Verwandte, deshalb wurde ich nach dem geltenden Gesetz und den bestehenden Verhältnissen drei unendlich lange Tage später aus der Kindersammelstelle in ein Kinderheim gebracht.
Vor einem Monat war ich vierzehn geworden.
Und mit meinen vierzehn Jahren blieb ich ganz allein.
Ohne Großmutter, Freude einer Familie und Zuhause.
Ohne den letzten dünnen Faden, der den Menschen an den Wohnort und die alltäglichen gewöhnlichen Sorgen bindet. An den Gedanken, dass dich jemand braucht. An das normale Leben eines jeden von uns.