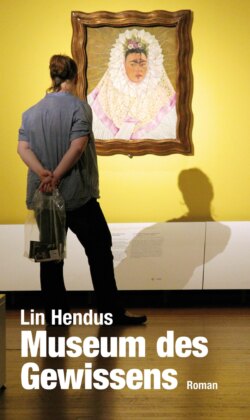Читать книгу Museum des Gewissens - Лин Хэндус - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 4 Unsichtbarer unter den Großen
ОглавлениеErst nach mehreren aufregenden Wochen fand ich endlich die richtigen Plätze zum Wohnen. Meine Schlafplätze. Zu meinem Glück fehlten in der Eremitage in den unruhigen achtziger Jahren gute Überwachungs- und Alarmsysteme. Wie übrigens auch schlechte. Angst, von Kameras entdeckt zu werden, hatte ich keine. Ehrlich gesagt dachte ich damals überhaupt nicht über Kameras nach. Ich wusste einfach nichts davon. Auf diese Idee kam ich erst viele Jahre später.
Das Museum wurde gut gelüftet und beheizt. Vielleicht auch nicht – jedenfalls blieb die Temperatur in den Museumsräumen mehr oder weniger konstant, entweder aufgrund der Vielzahl der Säle oder wegen der dicken Wände und hohen Decken. Ich weiß es nicht. Trotz der hinter den Fenstern fallenden Schneeflocken war es innen warm, wenngleich man in den kalten herbstlichen und später in den Winternächten manchmal nach mehr Wärme verlangte.
Was aber zum einzigen großen Überlebensproblem wurde, war die Nahrung. Besonders in den ersten Wochen. Der Hunger wurde zum bösartigen Begleiter des Flüchtigen. Der leere Magen stieß mich ständig in die Seite und trieb mich an: „Geh, geh weg von hier! Auf die Straße, in die Stadt! Dort gibt es genug zu essen. Wenn auch nicht sehr viel, aber dir reicht es auf jeden Fall. Im Gegensatz zu hier. Hier wirst du sterben. Geh und gib deinen Wunsch nach Freiheit auf. Besser unfrei, dafür aber satt. Was spricht gegen das Prinzip, am Leben zu bleiben, indem man auf die Freiheit verzichtet?“
Diese Art innere, sich häufig wiederholende Monologe gefielen mir nicht. Und ich blieb meinem Ziel, halbhungrig, aber frei zu sein, treu. Auch das hatte mir meine Großmutter beigebracht. Mit ihrer zärtlichen und weichen Hand hatte sie oft meinen Kopf gestreichelt und dabei wiederholt:
„Antoscha, wenn du etwas möchtest, dann wirst du es auch erreichen. Weißt du, mein Liebling, viele sind der Meinung, dass ihre Träume nur deswegen unerfüllbar sind, weil sie ihnen zu fantastisch, gar zu verrückt vorkommen. Freunde dich niemals mit solchen Leuten an – sie werden nichts im Leben erreichen. Ich lebe schon lange auf der Welt, habe vieles gesehen und erfahren, und gerade deshalb sage ich dir diese Worte: Hat der Mensch einen Traum, geht er bestimmt in Erfüllung. Dabei gibt es aber einen wichtigen Punkt, den diejenigen kennen, deren Träume erfüllt wurden. Diese Menschen brauchten viel Geduld, um zu ihrem Ziel zu gelangen. Aber sie erreichten es, dem Pessimismus der Verwandten, dem Verrat der Freunde, dem Unglauben der Kollegen zum Trotz. Der Mensch, der nach vorne strebt, darf keinen Hauch von Zweifel hegen. Nur dann kann er alles erreichen. Nur dann siegt er. Nur dann gelangt er an sein Ziel.
Und es gibt noch etwas, das viele Menschen einfach vergessen – man muss ganz genau wissen, was man haben möchte. Kennst du noch die Worte aus einem Märchen: ‚Geht dorthin – weiß nicht, wohin. Hol das – weiß nicht, was‘? So geht es vielen von uns im Leben – wir wissen nicht, wohin wir möchten, was wir werden möchten, wovon wir träumen sollen. Das aber ist der allererste und wichtigste Schritt zur Erfüllung deiner Träume. Und wenn du nicht weißt, was du anstrebst, dann gelangst du niemals in die Welt deiner Fantasien. Also, Antoscha, hab keine Angst zu träumen. Glaub an dich, dann werden deine Träume bestimmt wahr!“
Diese Worte klangen oft in meinen Ohren und halfen mir, den Hunger zu unterdrücken. Ich träumte von einer Tafel voller Speisen. Davon, dass ich in einem hellen Zimmer vor dem Kamin saß und nach einem guten Abendessen meinen Bauch streichelte. Davon, dass ich ein Bergsteiger mit einem großen Rucksack auf den Schultern war und dass ich unbedingt den nächsten Gebirgspass erreichen musste. Den Ort, an dem sich die Hütte mit viel Essen befand. In meinen Träumen landete ich in Kaiserpalästen, in denen ich als Gast an reich gedeckten Tischen saß. In meinen Fantasien flog ich als Kosmonaut in den Weltraum, wo ich ungeduldig auf die Landung wartete, weil die Tür des Raumschiffs, hinter der sich die Essensvorräte in Tuben befanden, kaputt gegangen war.
Lange stand ich vor Gemälden, auf denen sich irgendetwas Essbares befand: Eine Schale mit Äpfeln, Wild, eine hängende Weintraube. Nachdem ich mir die Bilder angeschaut hatte, ging ich weg und pfiff dabei geringschätzig vor mich hin, so, als ob es mir ganz gleich sei. Und ich gewann.
Ich verließ das Museum nicht und starb auch nicht vor Hunger.
Leitungswasser gab es in den Toilettenräumen genug. Deshalb musste ich nicht auf das Trinken verzichten. Bis ich aber eine zuverlässige Nahrungsquelle fand, verging einige Zeit. Eines Tages entdeckte ich bei einem Spaziergang durch die Palastsäle eine Tür, die nach Feierabend nicht immer abgeschlossen wurde. Dahinter befanden sich die Räume der Museumsangestellten, kleine Personalzimmer.
Essen gab es dort nicht viel. Menschen, die in einer Umgebung von Gold, Marmor und Edelsteinen arbeiten, ernähren sich nur sehr sparsam. Ich musste mir viel Mühe geben, um die letzten Krümel, die sie vergessen oder für morgen versteckt hatten, zu finden.
Keksreste.
Eine Dose Sprotten in Tomatensoße.
Trockene Butterbrote.
Einen Apfel.
Ein Glas mit selbst eingelegten Gurken.
Eine Flasche Kefir.
Eine Packung Saft.
Ein Weißbrot.
In den kleinen Kühlschränken fand ich ab und zu Schmand, Wurstreste, Salate, gekochte Eier – Reichtum für den Hungrigen. Wichtig war dabei die Zurückhaltung. Nicht die gesamte Entdeckung auf einmal zu verspeisen, damit keinesfalls Verdacht geschöpft wurde. Kein einziger Mensch sollte erfahren, dass sich im Palast außer den Museumsexponaten noch jemand befand. Ihn nicht besuchen kam, sondern dort wohnte.
Es ist bekannt, dass zum Wohnen Häuser benutzt werden.
Wohnungen.
Zimmer.
Treppenflure.
Brücken.
Sogar Straßen.
Aber keinesfalls Museen. Das Museum war nur für mich. Das war mein Geheimnis, in das kein Fremder eindringen durfte.
Und es gab noch einen lebenswichtigen Punkt: Tagsüber durfte ich auf keinen Fall den Angestellten auffallen. Sonst drohten Polizei und wieder Kinderheim.
Ein schreckliches Ende.
Ein unmögliches.
Ein tödliches.
Das war es, das mir die größte Angst einjagte. Daher nahm ich mir ein Beispiel an Mowgli, dem kleinen Jungen, der sich zwischen den Lianen im Dschungel versteckte.
Meine Aufgabe war nicht die leichteste: In den Sälen des riesigen Palastes unbemerkt zu bleiben.
In den Sälen des Reichtums.
Der Macht.
Der Pracht.
Der Verehrung der ewigen Kunst.
Jeden Tag musste ich mir neue unauffällige Spazierwege suchen. Sie wechseln, in ein anderes Gebäude der Eremitage hinübergehen. Auf eine andere Etage. Die Epoche wechseln. Die Kultur. Den Geschmack. Mich unter die Touristen, die Ausflugsteilnehmer, Schüler und älteren Menschen mischen. Wobei das eigentlich weniger schwierig war: Ich konnte mich für einen Jungen ausgeben, der seine Eltern aus den Augen verloren hatte. Für einen Enkel, der sich seinen Großeltern hinterherschleppte. Für einen ausgezeichneten Schüler oder einen ganz normalen Besucher, der sich für Kunst interessierte. Für mein Alter war ich groß, aber sehr schlank. Von hinten konnte man mich, wenn auch mit Mühe und Not, für einen hageren jungen Mann halten. Mein Gesicht aber sah bei weitem noch nicht erwachsen aus.
Mit der Zeit kam ich auf die Idee, hin und wieder mein Aussehen zu verändern, um nicht allzu bekannt zu werden und durch die häufigen Besuche keinen Verdacht aufkommen zu lassen. Die Jacke ausziehen und über den Arm werfen. Sie bis nach oben schließen. Offen tragen. Das Haar zusammenbinden. Einen Scheitel links oder rechts tragen. Diese Idee war geradezu genial. Und jeder von diesen kleinen Rettungskniffen half mir, unbemerkt in dieser großen Eremitage zu verweilen. An dem Ort, der mich aufgenommen hatte und der mit mir gemeinsam, eifersüchtig und behutsam, das Geheimnis des Flüchtigen bewahrte. Während der vielen Monate meines Aufenthaltes im Winterpalast kam ich zu wahrhaft wertvollen Dingen.
Einem vergessenen Kamm auf der Fensterbank.
Einem verlorenen Schal.
Einer Damentasche mit einem Maniküre-Etui, einem Taschentuch und Kleingeld.
Einer Kinderwindel, die mir als Handtuch diente.
Doch das alles war nichts angesichts dessen, was ich in der Garderobe entdeckte. Einen wahren Schatz.
Eines Abends, nach vielen Monaten freiwilliger Gefangenschaft im Palast, ging ich vorsichtig – zwischen den Säulen, um von außen nicht gesehen zu werden – die große Treppe hinunter in die erste Etage. Über diese Marmortreppe mit rotem Teppich war ich im späten Herbst in mein freiwilliges Gefängnis gelangt. Jetzt regierte draußen der Sommer. Das erkannte ich an den hellen Nächten, die über meine Stadt herrschten. Tage und Nächte waren gleich hell und laut. Den Unterschied zwischen Tag und Nacht konnte ich in meiner neuen Unterkunft nur durch die Stille ausmachen, die in den Sälen herrschte. Die Tage zählte ich nicht. Die Monate konnte ich nur vermuten. Manchmal fragte ich vorsichtig die Museumsbesucher danach – zumeist meine Altersgenossen, um nicht verdächtigt zu werden. An die vergehende Zeit versuchte ich nicht zu denken. Meine Neugier drückte sich mit ihrem Rücken eng an die Wand hinter die fest verschlossene Tür aus Angst und hatte nicht vor, diesen Platz zu verlassen.
Als ich unten war, durchquerte ich mit langsamen Schritten die Eingangshalle und ging hinter die Marmortheke der Garderobe. Nachdem ich die leeren Regale unter der Theke mit den Augen überflogen hatte, schaute ich mich etwas tiefer um, in der Hoffnung, etwas zu finden. Wenigstens eine kleine liegengebliebene Pirogge. Mit nachdenklichem Blick stand ich zwischen den geraden Reihen der leeren Kleiderstangen. Erhob die Augen zur bemalten Decke. Ließ sie wieder hinunterwandern und erblickte eine Seitentür.
Durch einen leichten Ruck ließ sie sich öffnen. Das Zimmer dahinter war gar nicht so klein, wie ich gedacht hatte. Der Lichtschalter befand sich im Innenraum etwa auf der Höhe eines erhobenen Ellbogens. Das Zimmer hatte keine Fenster. Das schwache Licht fiel auf einen wackligen Tisch und zwei Stühle. Ich drehte meinen Kopf nach links und entdeckte hinter der Tür einige grob zusammengezimmerte Regale mit verschiedenen Dingen. Die Regale reichten bis nach oben und befanden sich an zwei Seiten.
Meine Augen erkannten ordentlich zusammengefaltete Jacken, Regenschirme, Kinder-, Damen- und Herrenschuhe, Taschen, Kartons mit verschiedenen technischen und Küchenutensilien, Sportsachen, Rucksäcke, Bücher, ein paar Fotoapparate, Ferngläser, zwei Tischlampen, Tennisschläger und eine Menge anderer Sachen, die einer genaueren Untersuchung bedurften.
Getrennt davon lagen auf drei Regalen verschiedene Kopfbedeckungen – von einer abgenutzten Pelz- bis hin zu einer nagelneuen Matrosenmütze. Unten standen in einer Reihe Kartons mit allerlei Kleinigkeiten, wie Kämme, Lippenstifte, Lämpchen, leere Geldbörsen, Halstücher, Schals, Schlüsselbunde und Notizblöcke, Stifte, Kugelschreiber und weitere für ihren Besitzer nützliche und unnütze Sachen. Auf jedem der Kartons stand eine Jahreszahl: 1986, 1987, 1988, 1989 ... Der Karton mit der Zahl 1990 war nur bis zu einem Drittel gefüllt.
In der hinteren Ecke, hinter den Stühlen, nahmen drei Kinderwagen, einige Schlitten, ein stabiler Hocker mit weichem Polster, ein Dreirad und eine kleine Blockleiter ihren Platz ein.
„Welch Reichtum, ein Schatz, eine Goldgrube!“, schoss es mir durch den Kopf und ein süßer Schmerz durchdrang mein Herz: In dem halben Jahr meines Lebens in der Eremitage hatte sich meine Kleidung abgenutzt, war löchrig und verbreitete längst einen unangenehmen Geruch. Jeden Tag hatte ich Angst, von einem der Museumsangestellten angehalten und nach der Eintrittskarte gefragt zu werden, um dann als „blinder Passagier“ oder Obdachloser hinausgeleitet zu werden. Ein solches Ende meines halbverhungerten, aber gefahrlosen Lebens wollte ich nicht. Gerade deswegen war das entdeckte Zimmer mit den vergessenen Dingen sogar wichtiger als das Essen. Auf diesen Regalen lag meine zukünftige Sicherheit.
Aufgeregt ging ich zum nächsten Regal und begann, die Sachen eine nach der anderen durchzuschauen. Suchte mir etwas aus und probierte es sofort an. Faltete mit großem Bedauern, sie im Sommer nicht gebrauchen zu können, die eintönigen Kinder-, Damen- und Herrenjacken auseinander. Probierte sorgfältig zwei neue Hosen und drei Sporthosen an. Entschied mich endlich für eine schwarze Adidas- Sporthose, die unter anderen Hosen in einer aufgerissenen Kaufhaustüte lag. In Gedanken bedankte ich mich herzlich bei den Angestellten der Garderobe für ihre Ehrlichkeit. Die mir nicht passenden oder für die Jahreszeit nicht geeigneten Hosen, Pullis und Jacken legte ich wieder ordentlich in die Regale zurück, damit keiner meinen unfreiwilligen Einbruch in den „Laden der vergessenen Dinge“ – so nannte ich meinen plötzlichen und glücklichen Fund – entdecken würde.
Ein neues Shirt statt des abgetragenen und sehr schmutzigen Hemdes fand sich sehr schnell: Etwa zwanzig Shirts lagen in bunten Stapeln in der Mitte eines der Regale. Darüber konnte ich nur staunen: Warum kamen Menschen nach einem Einkaufsbummel mit Einkäufen ins Museum? Um sie dort zu vergessen? Vielleicht wirkte sich die Kunst so berauschend auf sie aus, dass sie danach nicht mehr durch die ganze Stadt fahren wollten, um den in der Garderobe vergessenen Karton mit dem neuen Kochtopf abzuholen? Vielleicht dachten sie überhaupt nicht mehr an die vergessenen Kleinigkeiten. Verstehen konnte ich das nicht.
Die Probleme der anderen Menschen rückten sofort in den Hintergrund, als ich selbst ein kleines Problem mit dem letzten Teil meiner Garderobe, der Unterwäsche, bekam. Meine Unterhose hatte ich wegen des unangenehmen Geruchs vor ein paar Monaten weggeworfen. Als ich aufmerksam die ordentlich zusammengelegten Sachen durchsuchte, fand ich jedoch nur eine Packung Kinderunterhosen, Shorts und Damenunterwäsche mit Spitze, die ich nie im Leben anziehen würde. Ich hielt mir eine ausgepackte Kinderunterhose an und holte schwer Luft – aus dem Alter eines kleinen Schulkindes war ich längst raus. Die Shorts aber reichten mir bis zu den Knien und taugten nicht als Unterwäsche. Und die Spitzenwäsche wollte ich gar nicht erst anschauen. Langsam und niedergeschlagen legte ich den aus der Plastikpackung herausgeholten Kinderslip wieder zusammen. Plötzlich kam mir ein Einfall und ich ging zu den Kartons.
Nach kurzer Suche fand ich eine kleine Maniküre-Schere, die jemand in einer der vielen Taschen auf den Regalen vergessen hatte. Zwei Schlitze an den Seiten zu machen, war ganz einfach. Nach diesem unkomplizierten Eingriff zog ich den Kinderslip mit den aufgeschlitzten Seiten an. Und, oh, welch ein Glück, ich trug wieder frische Unterwäsche! Vor Freude sang ich sogar leise vor mich hin. Jetzt musste ich nur noch in eine der Museumstoiletten gehen und mich waschen, um mich vollkommen neu und glücklich zu fühlen. Meine alte und stinkende Kleidung band ich fest zusammen, packte sie sorgfältig in altes Zeitungspapier ein, das ich gefunden hatte, und legte sie in den großen Mülleimer, der an der Eingangstür stand.
Warmes Wasser gab es in der Toilette nicht, deshalb musste ich mich mit kaltem Wasser und etwas Seife frisch machen. Nach dieser Prozedur fühlte ich mich sauber und schlüpfte in die glücklicherweise gefundenen Sachen. Mit zufriedenem Lächeln schaute ich mich im großen Spiegel an, dachte nach und kehrte wieder in das Zimmer, den Laden der vergessenen Dinge, zurück.
Nach wenigen Minuten sorgfältiger Suche verschwanden in meinen Taschen ein Taschenmesser, ein Kamm und zwei Stifte. Eine Sekunde später griff ich erneut in den Karton und klemmte mir einen neuen Zeichenblock unter den Arm. Für alle Fälle. Ein kleiner Spiegel über dem Tisch zog meinen Blick auf sich, und ich sah darin einen ganz anderen Jungen, der mir sehr gefiel.
Von diesem Tag an hatte ich keine Probleme mehr mit dem Umziehen. Für mich war es lebenswichtig, sauber, gepflegt und beschäftigt auszusehen. Sonst hätte Verdacht entstehen können.
Und Verdacht war Misstrauen.
Und Misstrauen war eine große Gefahr.
Ich musste starke Aufmerksamkeit meiden. Unter den gepflegten, satten und zufriedenen Besuchern des Kunsttempels durfte ich nicht wie ein Obdachloser aussehen. Das Glück war mein Begleiter, ließ mich nicht zugrunde gehen und bewahrte mich davor, gefangen zu werden.
Früher war ich nie auf die Idee gekommen, dass man ein Museum mit einem Schreibtisch vergleichen kann. Doch bei jedem von beiden muss man, wie sich herausstellte, Ordnung halten. Zweimal im Jahr wurde in meiner neuen Unterkunft eine Grundreinigung vorgenommen. Davon erfuhr ich zufällig aus dem Arbeitsplan, der in einem der Arbeitszimmer, in dem ich nach Essen suchte, ausgehängt wurde. Ich hatte der Ankündigung keine große Aufmerksamkeit geschenkt, doch erinnerte ich mich daran, als ich eines Morgens laute Stimmen, das Klirren von Eimern und das Knirschen der Klapptritte hörte. Zum Glück gelang es mir, mich rechtzeitig zu verstecken und später meinen Aufenthaltsort zu wechseln, um von den Reinigungskräften nicht entdeckt zu werden. Es waren unzählige Putzfrauen da. Mir schien es, als füllten sie die gesamten unendlichen Räume der Eremitage.
Sie putzten die Fenster.
Wischten Staub von den Bildern, Gobelins, Skulpturen.
Reinigten die Teppiche.
Die Ventilatoren.
Polierten das Parkett.
Diese Grundreinigung, von der ich vorher nichts gewusst hatte, überraschte mich sehr. Und sie wurde zu einer weiteren Warnung vor der allgegenwärtigen Gefahr. Ein halbes Jahr unbemerkt im Museum bleiben und dann plötzlich so dumm vom Reinigungspersonal gesehen werden. Nein, das durfte auf keinen Fall passieren! Innerhalb der Wände der Eremitage zu verweilen und weiterhin als Unsichtbarer zu leben – das war meine Hauptaufgabe.
Seit dieser überraschenden Prüfung in Wachsamkeit und Disziplin musste ich doppelt, nein, dreifach vorsichtiger werden. Und aufmerksamer. Tagsüber und abends spazierte ich mit großem Vergnügen durch die Museumssäle, schaute mir die Exponate an, die mir gefielen, und ging an den anderen, die mich nicht interessierten, gleichgültig vorbei. Besonders die Säle mit den Skulpturen beeindruckten meine jugendliche Fantasie.
Verzauberten mich.
Zogen mich an.
Forderten mich zum offenen Gespräch heraus.
Gerade hier umgaben die weißen und gelblichen menschlichen Figuren den einsamen Jungen, der sich abends, wenn er ganz alleine in den unendlichen Fluchten der Zimmer blieb, gerne mit ihnen unterhielt. Die nur spärlich mit Umhängen und Tuniken bedeckten oder auch nackten Zeus, Herkules und Herakles standen auf ihren mächtigen muskulösen Beinen, schauten in die Ferne und stellten ihre schönen und kräftigen Körper zur Schau. Die mythischen Göttinnen lächelten geheimnisvoll und versteckten die nur ihnen bekannten Geheimnisse, die uns, den Sterblichen, vorenthalten sind, vor fremden Augen. Ihre wunderschönen und seltsam verlockenden Figuren zogen sich in Reihen, standen im Halbkreis, versteckten sich in den Ecken der Säle und bildeten parallele unterbrochene Linien. Ich, als Betrachter, konnte die Harmonie des Steins und die sie umgebende majestätische Stille der Ewigkeit nur bewundern. Ich war begeistert von der hervorragenden präzisen und geheimnisvollen Arbeit menschlicher Hände, von der diese Skulpturen zeugten. Vorsichtig berührte ich die Steine und hoffte heimlich einen Pulsschlag zu spüren, die Wärme der Marmorhaut zu fühlen, einen Glanz in den leblosen Blicken zu erkennen.
Den Frauenfiguren schenkte ich besondere Aufmerksamkeit. Umging sie langsam von allen Seiten. Berührte sie vorsichtig mit den Fingern. Manchmal kam es mir vor, als sei die weißhäutige Marmorschönheit Aphrodite meine Mutter, die aus den warmen Meereswellen emporstieg. Oder dort die wunderschöne Venus, die es nicht geschafft hatte, sich anzuziehen. Sie blieb mit einem knappen Überwurf auf den Hüften, halbnackt, still stehen und bezauberte den Betrachter mit wahrer Schönheit und der Vollkommenheit ihres Körpers. In jeder dieser Figuren fand ich die meinem Gedächtnis entspringenden liebevollen Züge meiner Mutter, strengte meine Fantasie an und übertrug sie mit schüchterner Hoffnung auf die wunderschönen Marmorstatuen.
Ab und zu entglitt meine Aufmerksamkeit unerwartet und heftig in Richtung rein physiologischer Knabeninteressen: Hatten wirklich alle Mädchen und spätere Frauen solche Körper? Sie waren so anders gebaut als die Männer.
Warum?
Mit welchem geheimen Ziel?
Sonderbare und Anziehende.
Geheimnisvolle und Verlockende.
Ich wollte ihr Geheimnis lüften. Den kalten Marmorbusen berühren, um ihre menschliche Wärme, ihren aufregenden Charme zu spüren. Mit den Fingern über ihren glatten gleichmäßigen Bauch streicheln und den Lebenspuls unter seiner Steinhaut fühlen. Über die Innenseite der Hüfte streifen, die den fesselnden Blick des Jungen so seltsam lockte. Die merkwürdig aufregenden Gefühle, die nach dem Anblick dieser wunderschönen nackten Körper in meinem Inneren erwachten, verlangten herauszubrechen. Strapazierten den Kopf. Zwangen mich zum Nachdenken und erweckten in mir Schamgefühle.
Unter allen gesehenen und erfühlten Skulpturen gab es für mich zwei Lieblingsfiguren. Ich kann nicht sagen, dass die anderen mir weniger gefielen, aber die zwei waren unmittelbar und untrennbar mit meinem Leben verbunden. So kam es mir vor, und das wollte ich glauben.
Giuseppe Mazzolas „Tod des Adonis“ tauchte überraschend vor mir auf und zwang mich plötzlich stehen zu bleiben, als wäre der Körper auf eine unsichtbare Wand gestoßen. Das Herz sprang und raste vor Aufregung. Der Atem stockte. Vor mir erhob sich der Junge Antoscha-Adonis, der vom wilden Tier verletzt worden war, das für mich die feindliche Umwelt in sich verkörperte. Sie, diese Welt, spuckte mich als Kind aus ihrem Leib, nahm mir die Illusionen, wies mich zurück, zwang mich, allein die spitzen Felsen der Abneigung und Einsamkeit zu erklimmen.
Nahm mir die Eltern.
Die Großmutter.
Ließ mich ohne Heim und Fürsorge der Liebsten.
Warf mich in die schreckliche Welt des Hasses, der Gleichgültigkeit und Bosheit.
Adonis war ich, der tropfenweise sein junges Blut für jede vergangene Stunde, jede erlebte und verstandene Wahrheit hergab. Heute das gleiche Leiden wie gestern. Kampf um jede zusätzliche Stunde und jeden Augenblick des Lebens. Und allein. Ohne Freunde, Familie, Unterstützung.
Wer gewinnt: Ich oder der Feind?
Ich oder die Zeit?
Die Kraft oder die List?
Wer stirbt zuerst: Adonis oder das Tier?
Diese mich wie ein Magnet anziehende Skulptur verzauberte mich besonders. Gab neue Hoffnung. Brachte aus irgendeinem Grund zusätzliche Freude. Zwang mich weiterzukämpfen. In diesem marmornen Kampf setzte ich auf Adonis und seinen Sieg. Meinen Sieg.
Die andere Entdeckung, die ich nach Adonis machte, war Auguste Rodin. Seinen Namen kannte ich noch aus Erzählungen der Großmutter Alina. Aus ihren wunderschönen und bezaubernden Kunstgeschichten. Im Saal des französischen Bildhauers, in dem ich während eines Spaziergangs durch mein geheimes Reich plötzlich landete, tauchten auf einmal fast vergessene Geschichten in meinem Gedächtnis auf. Ließen mein Herz höher schlagen. Befeuchteten meine Augen.
Und angefangen hatte alles so einfach ...
An einem heißen Sommertag, als draußen hinter den Fenstern der helle Tag von der gleichermaßen hellen Nacht abgelöst wurde und sich mit schwerelosem Pappelflaum füllte, hatten mich meine Beine in den Rodin-Saal getragen. Ein paar Skulpturen lenkten meine Blicke sehr stark auf sich. Etwas Unerklärliches hielt meinen Atem an und die Beine trugen mich wie von selbst zu einer von ihnen – sie stand im matten Quadrat eines schwachen Lichts, das durch das Fenster fiel. Und dann kam die Erleuchtung: Diese Skulptur brauchte kein Licht – sie leuchtete von innen. Der Titel der Arbeit auf dem Schild erschien mir vollkommen falsch. Das war nicht „Ewiger Frühling“. Vor mir standen meine jungen Eltern! Papa Petja und Mama Ira.
So sahen sie auf einigen Familienfotos aus. So hatte ich sie in meinem Gedächtnis behalten. Verliebt ineinander. Jung. Schlank. Hübsch. Glücklich. In meinen lückenhaften Erinnerungen hielten sie sich immer an der Hand. Küssten sich beim Abschied. Umarmten sich beim Wiedersehen. So war es in unserer Familie üblich. Mama sagte, dass sie Glück gehabt habe, so einen wunderbaren Ehemann zu haben. Papa antwortete ihr, dass es so eine wunderschöne Frau wie Mama auf der ganzen Welt nicht mehr gebe ...
Der etwas abgemagerte junge Antoscha stand neben der Statue und umarmte die weißen Marmorbeine der Frau und des Mannes. Dieses Paar ähnelte so sehr meinen liebsten Menschen! Womöglich hatte Rodin sie gesehen, als er mit seinem „Ewigen Frühling“ begann? In Gedanken bat ich sie: Nehmt mich zu euch! Ich bin doch euer Sohn. Gibt es denn bei euch keinen Platz für mich? Ihr habt mich allein gelassen, seid mit mir zu hart umgegangen.
Mir fehlt eure Liebe.
Eure Zärtlichkeit.
Eure Freude.
Ich bin doch die Frucht eurer Liebe.
Eures Vertrauens zueinander.
Euer Sohn.
Dann gebt mir doch einen Platz in eurer Nähe!
Und so war ich bei meiner ersten Begegnung mit diesen Figuren neben dieser Statue eingeschlafen. Vergaß die Vorsicht. Den Hunger. Die abgetragenen Kleidungsstücke. Sogar die Großmutter, an die ich vorher immer gedacht hatte.
Ich träumte einen wunderschönen Traum, in dem ich auf den Wellen der elterlichen Liebe getragen wurde.
Badete in den Glücksstrahlen.
Flog im unendlichen Weltall und näherte mich immer schneller dem Planeten mit dem Namen Familie.
Dort warteten auf mich Mama, Papa und Großmutter.
Dort gab es keinen Kummer und keine Einsamkeit. Nur Freude und Liebe …
Zum Glück schlief ich wachsam. Der Lärm eines vor dem Museum plötzlich bremsenden Autos weckte mich sofort. Draußen war es genauso hell wie in der Nacht und am Tag zuvor. Die weißen Nächte dauerten an, und die Skulpturen standen unbeweglich auf ihren Plätzen.
Ich schüttelte meinen Kopf, um schneller wach zu werden und zu überlegen, was ich weiter tun sollte. Erstens, eine Uhr finden und die Zeit ablesen. Mich bis halb elf irgendwo verstecken. Danach wieder bis sechs Uhr abends durch die Säle schlendern und die Kilometer zählen.
Angst haben und nicht vertrauen.
Zusammenzucken und umschauen.
Mich vor Hunger und Furcht quälen.
Die große Eremitage war siebeneinhalb Stunden am Tag für Besucher geöffnet. Sechs Tage in der Woche. Und zweiundfünfzig Wochen im Jahr.
Die ewige Zeit wickelte gleichmäßig und gelassen die rasch davoneilenden Minuten, Stunden, Tage und Jahre meines jungen Lebens auf ihre unsichtbare Spindel.