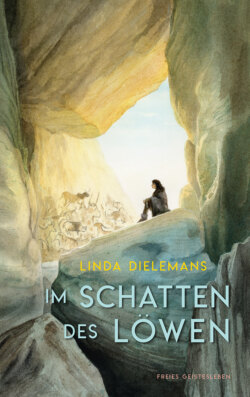Читать книгу Im Schatten des Löwen - Linda Dielemans - Страница 10
7
ОглавлениеJetzt war es Ernst, und alle wussten es. Sie würden aufbrechen. Lange hatte der Stamm vom Wegziehen geflüstert, den rasch abnehmenden Vorräten und der mageren Ausbeute der Jagd in letzter Zeit. Aber auch von der umhergeisternden Trauer und dem Wunsch, die hinter sich zu lassen.
An diesem Abend war Uma aus dem Schatten getreten. Zur Verwunderung aller hatte sie sich mit ans Feuer gesetzt, hatte sich unterhalten und gelacht, obwohl ihr schon bald dicke Schweißperlen auf die Stirn traten und ihre Wangen röter wurden, als Junhi sie je gesehen hatte. Aber es fühlte sich an, wie es sollte. Sie waren die Kinder und Uma war die Mutter des Stammes, fürsorglich und voller Geschichten und Weisheit.
So hätte es immer sein müssen, dachte Junhi. Wenn Uma öfter ans Feuer käme, wäre sie sicher auch weniger kalt und streng. Die Wärme tat ihr gut.
«Wir müssen gehen», sagte Uma, als die Klänge des letzten Liedes an diesem Abend verklungen waren. «Ich weiß, dass es schwierig ist. Und ich weiß, dass die Rentiere schon so weit weg sind, dass wir sie nicht mehr einholen werden. Aber wir können hier nicht länger bleiben. Es gibt nicht genug zu essen, und der Stamm ist zu schutzlos ohne seine Jäger, die nicht mehr da sind. Gemeinsam mit Tukh und Dahs habe ich beschlossen, dass wir nach Süden ziehen. Da ist es wärmer, und da gibt es mehr Stämme. Wir müssen sie um Hilfe bitten. Wir brauchen Männer und Jungen. Es ist Zeit für eine Verbindung.»
Ein aufgeregtes Gemurmel folgte, aber Junhi konnte nichts mehr sehen und kaum mehr atmen. Ihr Herz verlagerte sich in ihren Kopf und hämmerte von innen gegen ihren Schädel, als wäre er eine Trommel. Eine Verbindung!
Es war lange her, dass Junhi eine Verbindung miterlebt hatte. An einem solchen Tag hatte ein Mann von einem anderen Stamm ihre Mutter geraubt. Und ihr Vater hatte sich geweigert, das zuzulassen. Beide waren verloren. Beide weg. Seither hatte sie Verbindungen gemieden, war sie geflohen von den Feuern und erst am nächsten Morgen wiedergekommen, um zu sehen, wer diesmal wieder verschwunden war. Männer kamen und gingen, Frauen kamen und gingen, aber nie mehr war Blut geflossen. Niemand hatte miterleben müssen, was sie erlebt hatte.
Uma begann die Namen der Mädchen aufzuzählen, die diesmal gewählt werden durften. Junhi hörte nicht wirklich zu. Sie war jetzt eine Träumerin in Ausbildung. Das hieß, keine Verbindung für sie.
«… und Junhi.»
Junhi fuhr aus ihren Gedanken hoch und suchte Umas Blick. Die Stammesmutter nickte und lächelte ihr zu, als ob sie Junhi eine große Gunst gewährte.
«Aber …», begann sie, und sofort fasste sie jemand an der Schulter. Cramh hielt sich den Finger an die Lippen und schüttelte den Kopf.
«Lass mich los!», fuhr sie ihn an. «Cramh, ich gehöre Tukh, ich darf nicht gewählt werden! Ich gehöre Tukh!»
Sah sie Mitleid in seinen Augen? Davon hatte sie nichts! Sie wollte aufstehen, Umas Entschluss anfechten, aber Cramh hielt sie nur noch fester an der Schulter.
«Mach es nicht schlimmer als es ist. Alle jungen Frauen dürfen diesmal gewählt werden. Sogar Tira. Es ist nicht zu ändern, Uma hat entschieden», sagte er.
Einen Moment lang wich Junhis Wut ihrem Erstaunen. «Tira?»
Tira saß etwas außerhalb der Gruppe, wie immer in letzter Zeit, halb verborgen in der Dunkelheit. Aber Junhi sah deutlich, dass sie lächelte, ein seltener Anblick. Tira blickte in ihre Richtung und ihr Lächeln wurde noch breiter. Freute sie sich wirklich so, gewählt werden zu dürfen? Wahrscheinlich hatte sie nicht erwartet, dafür jemals in Betracht zu kommen. Vielleicht war es ja das, was sie immer gewollt hatte.
Junhi erwiderte ihr Lächeln, aber währenddessen spürte sie einen Knoten im Magen. Wenn ein Mann sie wählte, konnte sie keine Träumerin mehr sein. Sie würde seinem Stamm zugeschlagen im Austausch für einen Jungen von dort, oder ihr neuer Mann würde bei ihr bleiben. Wie auch immer würde Uma einen neuen Jäger im Stamm willkommen heißen. Junhi würde Kinder bekommen. Und sie konnte nicht gleichzeitig träumen und Mutter sein. Das war nicht gestattet.
Ihre Augen suchten Tukh, aber er war nicht da. Sicher war er hinaus ins Freie entwischt und wie gewöhnlich in seiner Lufthöhle. Ob er einer Meinung mit Uma war? Ob er bereit war, seine beiden Schülerinnen zu verlieren, gerade nachdem er sich so um Junhi bemüht hatte? Sie glaubte es nicht. Und sie würde ihn danach fragen.
Feuer brannten. Junhis Hand lag in der starken Hand des Menschen neben ihr. Sie schaute hoch. Es war ihre Mutter. Ihr Gesicht war verschwommen, als ob Junhi durch einen Nebel schauen müsste, aber sie sah das nervöse Lächeln, das ihre Mutter ihr schenkte. Die Leute ringsum unterhielten sich und lachten, aber ihre Mutter stand totenstill da, als ob sie etwas hörte, das sie nicht einordnen konnte. Etwas Unerwartetes trug sich zu. Ein schneller Schemen fasste den Arm ihrer Mutter und riss ihre Hand aus der von Junhi. Sie schrie, und die Unterhaltungen und das Lachen verstummten. Die Menschen verwandelten sich in Stein, die Augen aufgerissen und die Hand vor dem Mund. Junhi rannte dem Schatten und ihrer Mutter hinterher, und dann war sie ihre Mutter und spürte den gnadenlosen Griff der Hand um ihren Arm, die harten Worte, das Ringen, den Schlag ins Gesicht. Sie versuchte mit aller Macht, sich zu befreien, wollte zurück zu ihrer kleinen Tochter, zurück zu dem Mann, der so gut zu ihr war, zurück zu dem Stamm, der immer ihr Zuhause gewesen war. Sie drehte sich um, suchte nach dem Mädchen, das sie soeben noch festgehalten hatte, aber die steinernen Menschen versperrten ihr den Weg und sie sah nichts als stumme, starrende Gesichter. Warum ließen sie dies geschehen? Sie hatte schon einen Mann, sie hatte schon ein Kind, warum wählte dieser fremde Mann nicht eine Andere, warum sie? Heiße Tränen entwichen ihren Augen. «Junhi!», rief sie. «Junhi, wo bist du?»
Auf einmal war Junhi wieder sie selbst. Zwei magere Arme hielten sie kräftig, aber nicht unfreundlich fest, während sie versuchte, sich zu befreien und zu ihrer Mutter hinzurennen. Sie schaute zur Seite und sah Tukhs Gesicht, jünger als sie ihn kannte, mit traurigen Augen, und er legte seinen Finger an die Lippen. Langsam begann er zu versteinern, genau wie die anderen, seine Arme wurden hart, sein Blick leblos. Junhi kämpfte, um freizukommen, aber sein steinerner Griff ließ sie nicht los. Kälte verbreitete sich in ihren Beinen und machte sie gefühllos, kroch hinauf zu ihren Armen, ihrem Hals, ihrem Gesicht. Sie bekam keine Luft; es war, als würde sie ersticken. Alles wurde grau, und dann war da nur noch ein Schwarz.
Tukh war unauffindbar. Niemand hatte den Träumer seit dem Abend von Umas Ankündigung gesehen. Der Stamm bereitete sich auf die Abreise vor, aber Junhi machte sich Sorgen. Sie suchte überall, suchte auch alle seine Lufthöhlen ab und hatte es selbst gewagt, in die Mutterhöhle zu gehen, wo sie allerdings nicht weiter gekommen war, als es das Tageslicht und ihre Augen zugelassen hatten. Die Mutterhöhle blieb die Domäne der Träumer, und was sie sonst auch von sich dachte, sie wusste sehr gut, dass sie kein Recht hatte, sich darin aufzuhalten.
Auch Tira war fassungslos, so sehr sogar, dass sie eines Abends zu Junhi kam und sie fragte, ob sie vielleicht Tukh gesehen hätte. Dabei hatte sie gar nicht mal unfreundlich geklungen. Trotz allem waren sie miteinander verbunden. Sie hatten beide ihre Eltern und ihren Lehrer verloren, und sie beide waren wählbar bei der kommenden Verbindung. Aber das bedeutete eindeutig nicht, dass sie jetzt jeden Abend nebeneinander am Feuer sitzen würden.
Ein Glück, dachte Junhi. Ich wüsste nicht, was ich dann tun sollte.
Dann kam der Tag des Aufbruchs. Alle standen zum Abmarsch bereit, mit polierten Speeren und warmer Reisekleidung, mit Häuten und Vorräten. Alles andere ließen sie zurück. Junhi schaute sich noch ein letztes Mal in der Wohnhöhle um, in der alle so lange glücklich gewesen waren. Um die Feuerstelle lagen die Scherben der zerborstenen Kochsteine und verkohlte Knochen. Sie sah ausrangierte Häute, kaputte Körbe aus Gras, zerbrochene Beile und Knochensplitter von vor langer Zeit angefertigten Speerspitzen. Rote Tupfer zusammen mit Wellen und Linien schmückten die Wände.
Das also sind die Spuren, die wir hinterlassen, überlegte Junhi. Spuren, die nicht wie die der Herden unter Schnee und Moos verschwinden. Was werden die Menschen, die nach uns kommen, von uns denken?
Uma trat aus den Schatten, gefolgt von Dahs, der selbst einem Schatten immer ähnlicher zu sehen begann. Der Stamm wich auseinander, um ihnen den Vortritt zu gewähren, denn niemand sonst als die Stammesmutter konnte den Stamm über die Ebene führen. Langsam kam der Tross in Bewegung. Die Sonne stand tief am Himmel, und der Wind hatte sich in der Nacht gelegt. Das machte es ungewöhnlich still. Fast schien es, als ob der Wind auf etwas wartete. Manche Stammesmitglieder blickten scheu um sich, auf der Hut wie die Hasen. Dann sah Junhi ihn.
Mit verschränkten Armen stand Tukh unter dem krummen Wacholder neben der Wohnhöhle, halb im Schatten des Baumes versteckt. Er trug eine Tasche über der Schulter, zweifellos gefüllt mit seinen geliebten Pigmenten und Pinseln. Junhi rannte zu ihm, aber als sie näherkam, bremste sie ihren Schritt. Irgendetwas stimmte nicht. Etwas stimmte nicht mit seinem Gesicht.
Seine Augen waren schwarz bemalt, genau wie sein Mund: ein breiter, dunkler Strich von Ohr zu Ohr. Von seinen Mundwinkeln verliefen zwei bizarre rote Streifen nach unten. Es sah aus wie Blut. Es war Blut.
«Tukh!», rief Junhi und begann wieder zu rennen. Verschiedene Stammesgenossen folgten ihr.
«Tukh, was ist passiert?», fragte Junhi atemlos.
Der Träumer betrachtete sie mit einem Blick, den sie nicht lesen konnte. Das Schwarz um seine Augen reichte bis zu seinen Augenbrauen und verbarg die kleinen Fältchen, die sagten, ob er lächelte oder nicht, ob er traurig war oder ernst. Er schüttelte den Kopf und zeigte auf seinen Mund.
An zwei Stellen bei Tukhs Mundwinkeln war eine Lederschnur durch seine Haut gezogen, nachlässig auf seiner Unterlippe festgeknotet. Die Wunden waren rot, ausgefranst und geschwollen. Er sah schlecht aus.
«Das Schweigen», flüsterte jemand. «Tukh hat sich das Schweigen auferlegt!»
Tukh schloss für einen Moment die Augen. Durch die Schwärze schienen sich in seinem Gesicht zwei Löcher zu befinden, wie bei einem Schädel ohne Fleisch. Seine Lippen waren trocken, die Risse zeichneten sich unnatürlich rot ab.
Junhi streckte die Hand nach Tukh aus, aber Cramh, der mit ihr mitgelaufen war, fasste sie am Arm.
«Nein, nicht!», sagte er. «Das Schweigen verlangt Hingabe und Einsamkeit. Niemand darf ihn berühren. Du und Tira müsst dafür sorgen, dass er trinkt und dass sein Essen fein genug ist, aber nur, wenn er darum bittet. Bleibt in seiner Nähe, aber stört ihn nicht. Es ist etwas Wichtiges, das nach einer Lösung verlangt. Tukh opfert sich auf, um darüber nachzudenken.»
Junhi konnte ihren Blick nicht von Tukh lösen. Er schien sie anzulächeln. Was hatte er sich nur angetan?
Der Rest des Stammes war stehen geblieben, unsicher und verwirrt. Fragen wurden gerufen. Tukh ging zu ihnen, Junhi und die anderen hinter sich. Sie beschloss, in Tukhs Nähe zu bleiben.
«Das Schweigen!», rief Uma, als sie Tukh sah. Sie strahlte einen Unmut aus, von dem Junhi geglaubt hatte, er sei allein für sie reserviert. Die Stammesmutter steuerte auf ihn zu, aber trotz ihrer Wut kam sie nicht näher als eine Armlänge.
«Du traust dich was, Träumer», sagte sie. «Ich behalte dich im Auge, davon darfst du ausgehen. Du bist ebenso schuldig wie wir. Tu bloß nicht, als ob.»
Schuldig? Was meinte Uma?
Tukh starrte Uma lediglich an, und schon bald wand sie ihren Blick ab. Sie drehte sich um und sagte: «Wir gehen.»
Und der Stamm kam wieder in Bewegung, Dahs und Uma vorneweg, Tukh hinterher, in sicherer Entfernung zu der letzten Reisenden, einer älteren Frau mit grauem Haar, das ihr in steifen Strängen bis zur Hüfte reichte. Ab und zu drehte sie sich beunruhigt um.
«Ich gehe und suche Tira, in Ordnung?», sagte Junhi. Tukh ließ sich nicht anmerken, dass er sie gehört hatte. Stattdessen schaute er unverwandt voraus und verlangsamte nicht einmal seinen Schritt. Vielleicht brauchte sie seine Zustimmung auch nicht.
Junhi fand Tira zwischen den Frauen mit Kleinkindern, die sie in einem Ledertuch auf dem Rücken trugen. Sie brabbelten oder weinten.
«Tira», sagte Junhi. «Tukh braucht uns.»
«Ich weiß schon von dem Schweigen», antwortete Tira kühl. «Uma hat es mir erzählt. Kümmere du dich um ihn. Er kann jetzt ohnehin nicht reden, und ich muss für mich selbst sorgen.»
Das hatte Junhi nicht erwartet.
«Bist du dir sicher?»
Tira schaute sie giftig an. «Du hast doch gehört, was ich sage!»
«Also gut.»
Was war hier los? Warum war Uma erzürnt über Tukhs Schweigen, und warum zeigte sich Tira einverstanden, dass Junhi für ihn sorgen würde? Aber sie war allein mit ihren Fragen, so wie immer.