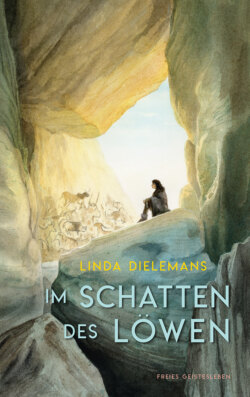Читать книгу Im Schatten des Löwen - Linda Dielemans - Страница 9
6
ОглавлениеEs gab Luft in der Wohnhöhle. Luft und Platz. Nachts konnte man sich ungestört hin und her wälzen. Tagsüber konnten die Kinder drinnen herumrennen. Es wäre schön gewesen, wenn es nicht eine so traurige Ursache gehabt hätte. Aber so wog die Luft schwer. Falls überhaupt jemand lachte, klang es hohl und eigenartig. Die Wohnhöhle, in der der Stamm so gern geblieben wäre, war voll mit den Geistern der Menschen, die da hätten sein müssen, die aber nicht mehr waren.
Sie würden bald fortziehen. Junhi spürte es, sie wusste es. Unwillkürlich rieb sie sich über die Stirn, die Stelle von Tukhs Kuss. Es kribbelte dort noch immer, obwohl die Farbe längst von ihrer Haut verschwunden sein musste.
Seit dem Kuss schien Tira ganz versessen darauf zu sein, Junhi möglichst viel zu beschäftigen. Offenbar wollte sie die Situation für sich ausnutzen, nachdem sie Junhi nicht mehr ausweichen oder davonjagen konnte. Sie ließ Junhi ihr Essen holen, ihre Kleidung flicken und ihre Farben mischen. Wenn sie zur Lufthöhle gingen, stützte sie sich so schwer auf sie, dass sie noch langsamer vorwärtskamen, als wenn Tira allein mit ihrem Stock unterwegs gewesen wäre.
Tukh sagte nie etwas dazu. Manchmal ärgerte das Junhi, aber sie wusste, dass es vorläufig das Beste war, was er für sie tun konnte, ohne dass Uma und Dahs etwas dagegen einbringen konnten. Welche Pläne Tukh weiter hatte, verriet er nicht. Vielleicht ja überhaupt keine. Aber sie hatte versprochen, stark zu sein, und sie würde dieses Versprechen einhalten.
Denn die Träume, die Träume … Junhi war nicht klar gewesen, wie sehr sie dagegen angekämpft hatte. Bis jetzt. Sobald sie nachts die Augen schloss, waren die Tiere bei ihr. In der Lufthöhle, mit dem Rücken gegen die Felswand, erstreckte sich die raue Ebene vor ihren Augen, begleitet von Tukhs melodiöser Stimme.
Manchmal schwebte sie über den Herden und sah, wie diese sich bewegten, niemals in einer geraden Linie, sondern wirbelnd und wogend, besonders die Pferde und Rentiere.
Dann wieder stand sie auf dem Boden, während die Tiere um sie herumrannten. Dann spürte sie das Donnern ihrer Hufe und die Hitze ihres Atems und ihrer Leiber.
Der Löwenmann war jetzt fast immer bei ihr. Auch wenn sie ihn nicht sah, wusste sie, dass er da war. Er schwieg nach wie vor, wie oft sie ihn auch fragte, warum er ihr die Mammuts gezeigt hatte. Warum sagte er ihr nicht, was er gemeint hatte, was sie falsch gemacht hatte? Als sie schließlich in all ihrer Verzweiflung einmal versuchte, ihn umzuwerfen, während sie ihn anschrie, wie nutzlos er sei, weil er nie etwas sage, hatte er sie an der Hand genommen und war zusammen mit ihr über die Ebene spaziert, während die Herden verschwammen. Sie wusste nicht, was es bedeutete, aber beim Aufwachen fühlte sie sich getröstet.
An diesem Tag hatte sie nicht ein Pferd in die Lufthöhle gezeichnet, sondern eine ganze Herde, mit wilden Mähnen und schwarzen Mäulern. Sowohl Tukh als auch Tira hatten atemlos zugeschaut, während sie arbeitete. Aber Junhi hatte sie erst bemerkt, als sie mit Schweiß auf der Stirn und lauter schwarzen Streifen im Gesicht dem letzten Pferd sein Auge gegeben hatte. Seit diesem Tag stellte Tira noch höhere Anforderungen an sie.
Jetzt saßen sie in Tukhs Lieblings-Lufthöhle, nicht weit von der Mutterhöhle entfernt. Dort erzählte er seine Geschichten am liebsten. Die untergehende Sonne machte ihre Schatten lang, und die Tiere an der Wand schienen zu atmen.
«… und die Wisente umzingelten das Löwenjunge und zertraten es, bevor es zu ihrem größten Feind heranwachsen konnte.»
«Aber warum stand ich inmitten dieser Herde?», fragte Tira an Tukh. Einer ihrer Träume hatte Tukh dazu inspiriert, die Geschichte des Löwenjungen zu erzählen.
«Bin ich das Löwenjunge? Und wer versucht dann, mich zu zertreten?»
Sie bedachte Junhi mit einem kurzen, giftigen Blick. Tukh schwieg eine Weile und schaute Tira an.
«Das kann ich nicht sagen», sagte er dann. «Denk nach; erinnere dich, wie du dich in dem Traum gefühlt hast. Vielleicht bist du selbst die Herde, und die Mutter wollte dich fühlen lassen, wie es ist, das Junge zu sein, das du zu zertreten versuchst. Sieh dich um, hör zu, gib acht. Versuche, deine nächsten Träume mit diesem hier zu verbinden. Nur so wirst du seine Bedeutung in Erfahrung bringen.»
«Warum spricht mein Vater nicht mehr mit mir?»
Die Frage kam so unerwartet, dass sowohl Tukh als auch Junhi den Atem anhielten. Nur der Ruf einer Eule in der Ferne zerbrach die Stille. Tiras Augen schimmerten im Schein der Steinlampen, ihre Unterlippe bebte.
«Überhaupt nicht?», fragte Tukh leise.
«Nein», antwortete Tira. «Er blickt mich zwar an, aber er sieht mich nicht. Er kommt mir niemals nahe. Er sitzt allein bei seinem Feuer, und wenn ich zu ihm gehe, läuft er weg. Ich bin nicht schnell genug, ihm zu folgen.»
Sie schwieg und senkte den Blick. Tränen tropften auf ihren Mantel.
«Er war immer stolz auf mich, er half mir und lachte mit mir, obwohl ich … bin, wie ich bin. Ich will meinen Vater wiederhaben, Tukh!»
«Du hast uns noch, Tira. Mich und Junhi. Wir werden dir helfen. Dahs ist … Er ist verletzt. Nicht äußerlich, sondern im Inneren. Er hat jetzt auch Träume, aber nicht so wie wir. Er träumt von brüllenden Löwen, in Stücke gerissenem Fleisch, von splitternden Knochen und angstvollem Todesgeschrei.»
Ich habe auch solche Träume, dachte Junhi, den Traum von dem steinernen Stamm.
«Er träumt davon, am Boden angenagelt zu sein, während seine Jäger seine Hilfe brauchen», fuhr Tukh fort. «Er träumt davon, endlos zu rennen und nicht von dem Wimmern sterbender Menschen wegzukommen.»
«Aber ich kann helfen! Ich kann zuhören.»
«Er will es dir nicht antun. Er will nicht, dass du die Schreie auch hören, dass du das Blut auch riechen wirst. Er beschützt dich.»
«Ich will nicht beschützt werden.»
«Sage das einem Vater. Dahs braucht Zeit zu gesunden. Wir müssen ihm diese Zeit geben, auch du, so schwer es für dich als seine Tochter auch ist.»
Nicht lange nach diesen Worten schickte Tukh Junhi und Tira zur Wohnhöhle zurück. Tira hatte ganz vergessen, sich von Junhi beim Gehen helfen zu lassen. Aber Junhi passte sich ihrem mühsamen Gang an, Schritt für Schritt. Tiras krummer Rücken brachte sie immer wieder aus dem Gleichgewicht, immer wieder musste sie sich korrigieren, sich gerade halten, Gegenbewegungen machen. Welchen Streit sich Junhi auch mit ihr lieferte, sie bewunderte Tira, weil diese nie aufgab, immer bereit war zu kämpfen und sich nie anmerken ließ, dass sie Schmerzen hatte oder müde war. Offensichtlich spürte Tira ihren starrenden Blick, denn sie sagte: «Glaube nur nicht, du würdest mich jetzt kennen. Oder wir wären jetzt Freundinnen. Ich vertraue dir nicht. Und das werde ich auch nie tun.»
«Warum hasst du mich so?», fragte Junhi. Es war ihr herausgerutscht, bevor sie wusste, wie.
Tira blieb stehen und starrte Junhi eisig an.
«Für das, was du meinem Vater antust, jedes Mal, wenn er dich sieht», antwortete Tira.
«Was ich ihm antue? Ich tue ihm nichts an! Er schlägt mich, er schreit mich an, er demütigt mich. Er tut mir Dinge an!»
«Du denkst immer nur an dich selbst. Und jetzt will ich einfach weitergehen. Ich habe keine Lust, dich noch zu sehen. Lass mich in Ruhe.»
«Sehr gern. Dann sieh zu, wo du bleibst.»
Und Junhi rannte los. Es tat gut, den Wind wieder einmal im Gesicht zu spüren. So gut, dass sie an der Wohnhöhle vorbeisauste, den Fluss entlang, an ihrer geheimen Lufthöhle vorbei, und die Felswand hinaufkletterte. Sie rannte weiter über den Hang bis zu dem höchsten Punkt, wo sie stehen blieb und ihren Mantel von sich warf, sodass der Schweiß auf ihrer Haut schon bald zur dünnen Eisschicht gefror. Sie zitterte.
Das Land vor ihren Füßen wölbte sich hier zu einer Ebene herab, die so endlos war wie der Himmel; ohne Bäume, ohne Büsche, nur Gras und Moos, betupft mit Blumen und Kräutern. Sie rannte hinab. Ihren Mantel ließ sie auf dem Hang zurück, trotz der Kälte, die in nicht allzu langer Zeit ihre Muskeln steif werden und ihren Kopf leicht machen würde. Sie wollte es spüren. Nicht den Schmerz von Erinnerungen und Träumen, sondern richtige Schmerzen, die alles andere übertönten.
In einem Feld mit weißen Blumen legte sie sich flach auf den Rücken. Die Blätter und Stängel kitzelten sie an Ohren und Wangen. Sie merkte erst, wie stark sie zitterte, als sie mit den Zähnen klapperte und sich aus Versehen auf die Zunge biss. Das Blut schmeckte warm und süß.
Noch etwas, dachte sie, nur noch etwas.
Sie setzte sich auf und schloss die Augen, begrüßte die Kälte wie einen guten Freund.
Ich muss stark sein, dachte sie, stark sein und alles ertragen. Ich werde lernen, was meine Träume bedeuten. Ich werde lernen, wie ich die Mammuts finden kann. Ich werde herausbekommen, wer der Löwenmann ist. Und dann wird er mich nie mehr verlassen. Dann bin ich nie mehr allein.