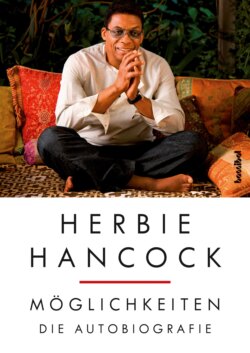Читать книгу Möglichkeiten - Lisa Dickey, Herbie Hancock - Страница 10
ОглавлениеIm Frühjahr 1963 hörte ich zum ersten Mal, dass Miles Davis nach mir Ausschau halte.
Miles hatte sein jüngstes Quintett aufgelöst, und ein Gerücht machte die Runde, dass er ein neues formieren wolle. Schon seit Mitte der Vierziger hatte er Platten gemacht und dabei mit einigen der besten Musiker gespielt oder als Leader agiert – Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, eine Liste, die sich lange fortsetzen lässt. Mitte der Fünfziger stellte er dann die Formation zusammen, die man als das „große Quintett“ kennt, das mit Musikern wie John Coltrane, dem Pianisten Red Garland, dem Bassisten Paul Chambers und Drummer Philly Joe Jones die Messlatte für den Post-Bebop sehr hoch legte. 1959 veröffentlichte er Kind Of Blue, eines der großartigsten Jazz-Alben aller Zeiten. Für seine musikalische Kunstfertigkeit und die rasiermesserscharfe Coolness, die ihn legendär gemacht hatten, kannte man ihn auch außerhalb der Welt des Jazz.
Ich hatte Miles schon einmal kurz getroffen, ungefähr ein Jahr zuvor. Donald betrachtete mich als seinen Schützling und wollte, dass Miles mich kennenlernte, woraufhin er ein Treffen in Davis’ Haus arrangierte. Als wir auf die Haustür zugingen, dachte ich nur noch: Scheiße! Ich werde Miles Davis treffen! Zweifellos war er mein Lieblingsmusiker, denn ich besaß all seine Platten. Mich verblüfften die Innovationen und die Abenteuerlust, die seine Soli kennzeichneten. Miles stand für alles, was ich im Jazz erreichen wollte, doch mit zweiundzwanzig Jahren konnte ich mir kaum vorstellen, es je so weit zu bringen.
Miles zu treffen, bedeutete für mich einen Nervenkitzel. Doch ihn interessierte anderes als der Austausch irgendwelcher Nettigkeiten. Ungefähr fünf Minuten nach meiner Ankunft schaute er mich an und sagte: „Spiel was.“ Und so setzte ich mich an das kleine im Wohnzimmer stehende Spinett-Piano und spielte den sichersten Song, der mir gerade einfiel, eine Ballade mit dem Titel „Stella By Starlight“. Ich war nervös, doch es muss ganz gut geklungen haben, denn als ich aufhörte, meinte Miles: „Netter Anschlag.“
Als ein Jahr darauf die Gerüchte die Runde machten, dass er nach mir Ausschau halte, konnte ich es trotz des Kompliments von damals nicht glauben. Jeder wollte mit Miles spielen, und so schien es mir unvorstellbar, dass er es von allen Pianisten dieser Welt gerade auf mich abgesehen hatte. Ich machte mir nicht viel aus dem Gerede, doch der Tratsch riss nicht ab.
Donald muss daran geglaubt haben, denn eines Nachtmittags Anfang Mai saßen wir zusammen im Apartment, und er meinte: „Okay, Herbie! Wenn Miles anruft, musst du ihm unbedingt sagen, dass du momentan mit niemandem arbeitest.“
„Lass mal, Donald. Ich weiß nicht, ob er mich anrufen wird, aber auch, wenn er es macht, könnte ich dir das nicht antun.“ Donald hatte mich nach New York geholt, und seit dem Zeitpunkt war ich immer ein festes Mitglied seiner Gruppe gewesen. Er war wie ein Bruder für mich, und dessen versicherte ich ihm. „Du hast mir so viel geholfen, mit dem Plattenvertrag und dem Verleger-Deal …“
„Halt die Klappe, Mann“, fuhr er mich an. „Stünde ich dem Job im Weg, könnte ich mich nicht mehr im Spiegel ansehen.“ Donald machte gerne einen Witz, doch jetzt gab er sich verdammt ernst. „Falls Miles fragt, machst du genau das, was ich gesagt habe.“
Am nächsten Nachmittag klingelte das Telefon in unserem Apartment. Ich nahm ab und hörte die unverkennbare raue Stimme von Miles Davis. „Hallo, Herbie. Du arbeitest doch im Moment mit niemandem?“ Miles war keiner, der zu viele Worte verlor.
„Nein, momentan nicht“, lautete meine Antwort.
„Gut, komm morgen um halb zwei Uhr zu mir nach Hause.“
Ich setzte gerade an zu antworten: „Okay, Miles …“, da hörte ich schon ein Klicken – sofort nach dem Satz hatte er aufgelegt. Er gab mir nicht mal die Adresse! In der Aufregung und bei meiner Nervosität kam es mir nicht in den Sinn, Donald zu fragen – ich dachte nur noch daran, dass Miles mich zum Spielen eingeladen hatte und ich mich nicht mehr erinnerte, wo er wohnte! Als das Telefon erneut läutete, riss ich den Hörer von der Gabel, darauf hoffend, dass es Miles war, doch stattdessen hatte ich Tony Williams am anderen Ende der Leitung.
Kurze Rückblende:
Tony war gerade erst siebzehn geworden, doch trotz seiner Jugend konnte man ihn als den heißesten Jazz-Drummer der Szene bezeichnen. Ich hatte ihn Ende 1962 bei einem Gig mit Eric Dolphy in Boston getroffen, wo er damals noch lebte, doch ihn nie trommeln gehört. Dann, nach seinem Umzug von Boston nach New York zu Beginn des Jahres 1963, rief er mich an und ließ mich wissen, dass er nun auch in der Stadt lebe. Was aber sollte ich mit einem Drummer im Teenageralter anfangen? Mit ihm abhängen? Ich wusste nicht, wie ich mich gegenüber Tony verhalten sollte, und wimmelte ihn erst mal ab. Ungefähr eine Woche später erhielt ich einen Anruf des Saxofonisten und Bandleaders Jackie McLean. Jackie stellte eine Gruppe für einen Gig im Blue Coronet in Brooklyn zusammen und fragte mich, ob ich auftreten wolle. „Wer ist denn noch dabei?“, fragte ich. „Eddie Kahn am Bass, Woody Shaw an der Trompete und Tony Williams hinter der Schießbude.“
„Hör mal, Jackie“, begann ich. „Kann Tony denn wirklich trommeln? Oder klingt er für einen Siebzehnjährigen einfach nur gut?“
„Ich erzähl dir mal was, Herbie“, antwortete er. „Spiel den Gig, und du wirst es herausfinden.“
Das machte ich. Wir hatte keine Probe, da wir Standards aufführten, Stoff, den alle kannten. Als Jackie die erste Nummer einzählte, begann ich mit einem Akkord – wonach Tony den beeindruckendsten Rhythmus hinlegte, den ich jemals gehört hatte. Ich hob die Hände von den Tasten und drehte mich mit weit offenem Mund zu ihm zurück. Es war unglaublich, was ich von dem kleinen, mageren Bürschchen hörte. Ich hatte keine Vorstellung, wie er auf diese Rhythmen kam, und ich brauchte mehr als einen Chorus, bis ich mich gesammelt hatte und weiterspielte.
Tony verfügte über ein irres Talent. Er konnte wie kein anderer trommeln und hatte sogar schon in seinem jugendlichen Alter ein absolutes Vertrauen in seine Fähigkeiten. Bei einigen Musikern scheint es so, als hätten sie schon bei der Geburt ihr Instrument gespielt, und Tony gehörte zu ihnen. Ihn zu beobachten und zu hören war pure Magie, da pure Energie und Kreativität von ihm ausgingen. Noch eine Woche zuvor hatte ich Tony abgewimmelt, doch nach dem Gig rief ich ihn an und fragte: „Hey, Mann, was geht ab? Hast du was vor? Kann ich mal rüberkommen?“ Und so begann meine Freundschaft mit Tony Williams.
Als Tony mich an besagtem Tag anrief – nachdem Miles mich kontaktiert hatte –, berichtete er, ebenfalls eingeladen worden zu sein. Ich spürte eine Aufregung in mir hochkochen und fühlte mich zudem erleichtert, weil er die Adresse von Miles kannte und ich damit einen konkreten Anhaltspunkt hatte.
Am nächsten Nachmittag stand ich vor Miles’ Haus an der West 77th Street. Er öffnete die Tür und führte mich die Stufen einer Treppe hinunter, an deren Ende sich sein Proberaum befand. Dort sah ich Tony, den Bassmann Ron Carter und den Saxer George Coleman. Wir quatschten ein wenig, dann nannte Miles ein Stück, zählte es ein, und wir begannen zu spielen, um uns aufeinander einzuschwingen. Miles begleitete uns einige Takte, warf danach das Flügelhorn auf die Couch und verschwand die Treppe hoch. Von da an wählte Ron die Nummern aus.
Der einige Jahre ältere Ron war schon eine Weile in der Szene und hatte auch bereits mit Eric Dolphy gespielt. Er hatte mit klassischer Musik begonnen, setzte sich als Junge in Michigan mit dem Cello auseinander, wonach er sich dem Jazz und dem Kontrabass widmete. Wie waren uns schon begegnet, kannten uns aber nicht gut, was auch auf George Coleman zutraf. Doch an dem Nachmittag lernten wir uns auf die Art kennen, wie Jazz-Musiker Bekanntschaft schließen – indem sie zusammensitzen und einige Nummern jammen.
Wir spielten den ganzen Nachmittag, der sich dann bis in den Abend erstreckte, und manchmal kam Miles runter, nahm sein Flügelhorn und spielte einige Töne, warf es wieder auf die Couch und rannte nach oben. Was ich damals noch nicht wusste, aber Jahre später erfuhr – in Miles’ Haus war tatsächlich eine Sprechanlage installiert. Saß er nun im dritten Stock, konnte er genau hören, was wir gerade spielten. Er wusste, dass ein Haufen junger Musiker wie wir möglicherweise durch seine Anwesenheit eingeschüchtert war. Aber er wollte unsere Fähigkeiten genau kennenlernen, weshalb er Ron die Führung überließ und einige Noten-Sheets auf das Piano legte. Ron spielte Bass mit einem wunderschönen Ton und makellosem Timing, war zudem noch sehr gut organisiert und nahm die ihm übertragene Verantwortung ernst. Er achtete auf den Fokus der Musiker.
Das Vorspielen erstreckte sich schließlich über drei Tage. Wir jammten, analysierten Akkord-Progressionen und lernten die gegenseitigen Stile kennen, während Miles rauf und runter ging und seinem Geist freien Lauf ließ. Am dritten Tag – endlich – gesellte er sich zu uns und spielte einige Nummer komplett mit. Dann sagte er: „Okay, das war’s. Kommt am Dienstag ins 30th Street Studio.“ Und dann wollte er schon wieder die Treppe hochgehen.
„Miles“, sprach ich ihn verwirrt an, „bin ich jetzt in der Band?“
Miles drehte sich um, den Hauch eines Lächelns auf dem Gesicht: „Du machst ’ne Platte, Muthafucka!“
Am Dienstag, dem 14. Mai, machte ich mich also mit den anderen auf den Weg ins 30th Street Studio der CBS. Wir hatten die Songs für das Album noch niemals richtig ausgespielt, doch Miles interessierten Proben nicht.
Er wollte, dass wir mit laufender Bandmaschine einfach drauflosspielten und das einfingen, was gerade passierte. Später fand ich heraus, dass Miles immer so produzierte. Er beabsichtigte die erste, ehrlichste und unverfälschteste Version eines Songs einzufangen, auch wenn sie fehlerhaft war. Miles glaubte, dass man die Kreativität durch zu häufiges Proben erstickte. Für ihn drückte Musik Spontaneität aus, den Versuch, etwas zu entdecken, und exakt das wollte er auf seinen Alben einfangen. Wenn die Bläser die komplette Melodie erstmalig durchspielten, war es für ihn der Take, den man für die Platte nutzte.
Miles verschwendete weder Worte noch Zeit. 1956 nahm er mit seinem ersten Quintett vier Alben an einem einzigen Tag auf – Cookin’, Relaxin’, Workin’ und Steamin’ –, zu denen er nur noch wenige Tracks einer früheren Session beisteuerte. Er ging einfach ins Studio und spielte. Nimmt man mit so einer Methode auf, ist es zuerst beängstigend, doch danach schärft es die Sinne. Ein Musiker wird zu Selbstvertrauen gezwungen, da er weiß, dass sich ihm kein anderer Weg bietet.
Und genau so arbeiteten wir auch an dem Tag. Die Band spielte alle Tracks für Seven Steps To Heaven ein. Es wurde eine phänomenale Session. Jeder brachte es, besonders der siebzehnjährige Tony Williams, ein richtiger Killer. Ich hatte so viel Spaß mit diesen großartigen Musikern, wollte, dass es ewig so weiterginge. Am Ende der Session fragte ich Miles erneut: „Also bin ich jetzt in der Band?“
„Du hast doch die Platte gemacht, oder?“ So lautete also die Antwort auf meine Frage.
Ich spielte das letzte Konzert vor meiner Zeit als Full-Time-Pianist für Miles als Begleitmusiker für Judy Henske in Greenwich Village. Judy war eine große Brünette mit einer rauen Stimme, die obszönen Blues sang und noch obszönere „Backroom-Balladen“. An dem Abend spielte sie vor Woody Allen, der eine Reihe von Auftritten im Village Gate absolvierte. Geplant waren einige Gigs, und nach einer Show tauchte Miles im Club auf.
„Brauchst du ’ne Mitfahrgelegenheit?“
„Nein, danke. Ich habe mir gerade ein Auto gekauft und bin heute damit gekommen.“
Miles betrachtete mich einen kurzen Augenblick. „Es ist aber kein Maserati“, meinte er.
Miles war natürlich für wunderschöne Autos, Kleidung und Frauen bekannt.
„Nein, ist es nicht. Aber er ist irgendwie ganz niedlich.“
Wir gingen die Treppe hoch und auf die Bleecker Street, wo mein Cobra direkt vor dem Club parkte. Ich zeigte mit dem Finger darauf, und Miles sagte nachsichtig: „Ah, der ist ja wirklich niedlich.“ Dann ging er die Straße hoch und verschwand. Ich setzte mich in den Wagen, fuhr aus der Parklücke, bog rechts in die Sixth Avenue ab und nahm die 93rd Street für den direkten Weg in den Norden, wo ich erst kürzlich ein eigenes Apartment bezogen hatte. An einer Ampel fuhr Miles plötzlich gemächlich neben meine Karosse. Er schaute mich an, ich schaute ihn an, und wir wussten beide, was als Nächstes geschehen würde. Als die Ampel auf Grün sprang, drückten wir beide das Gaspedal bis zum Anschlag durch.
Wir flogen regelrecht über die Sixth Avenue, wo alle Ampeln auf „grüne Welle“ geschaltet waren. Mein Cobra hängte ihn um Längen ab, der Maserati fuhr sprichwörtlich in meiner Staubwolke. Als Miles mich ungefähr zwanzig Blocks weiter bei einer roten Ampel einholte, hatte ich Zeit zum Anzünden einer Kippe. Ich schaute zu ihm rüber und versuchte dabei so lässig und cool wie möglich zu wirken. Miles kurbelte das Fenster runter und sagte: „Werd den Wagen los.“
„Was? Warum denn?“
„Viel zu gefääääährlich“, antwortete er mit krächzender Stimme. Und exakt in dem Moment – als hätte er es geplant – schaltete die Ampel auf Grün, und er schoss mit dem Maserati in die dunkle Nacht.
Am Anfang bestand das Quintett aus Miles, Tony, Ron, George und mir. Als George im folgenden Jahr ausstieg, holte Miles Sam Rivers als Ersatz, doch erst, als Wayne Shorter Sam Ende 1964 ersetzte, war das Quintett komplett. Wayne brachte nicht nur seine musikalischen Fähigkeiten als fantastischer Saxofonist ein, sondern auch als Komponist, der Stücke schrieb, die sich als ideal für unsere Zielsetzung erwiesen. Der Einstieg von Wayne verwandelte die Gruppe schließlich in das „Second Great Quintet“.
Miles ermöglichte seinen Musikern viel Freiheit, was ich wunderschön und inspirierend fand. Er schrieb uns niemals vor, was oder wie wir etwas spielen sollten – er gab uns eine Plattform, von der aus wir auf eine Entdeckungsreise gehen konnten. Wir begannen zum Beispiel mit einer Nummer und spielten uns ein. Je tiefer wir in den Song vordrangen, desto abenteuerlicher wurden die neuen improvisatorischen Verästelungen. Ein Song klang niemals gleich. Oft erkannte man die Stücke erst kurz nach Ende. Sogar die bekanntesten Jazz-Standards verwandelten sich in kreisförmige, unvorhersehbare klangliche Erkundungen. Wir nannten das „kontrollierte Freiheit“.
Jeder Musiker hatte seine Freiräume für Soli. Bei diesen Passagen „flogen“ wir förmlich in unbekannte Dimensionen. Miles legte uns keine Beschränkungen auf, sondern ermutigte uns, so abenteuerlich und mutig wie möglich zu agieren. Manchmal gingen unsere Erkundungen so weit, dass wir beinahe den ursprünglichen Song verloren. Doch in exakt solchen Momenten zeigte sich Miles’ Vermögen, einzuspringen und ein Solo zu spielen, das alles wieder zusammenbrachte.
Jede Nacht wurde zu einem Hochseilakt, aber selten nur verlor sogar Miles die Spur und wusste nicht, wo wir gerade waren. Mein Bruder Wayman erzählt die Geschichte eines unserer Gigs in Chicago folgendermaßen:
Die Band begann zu spielen, und sie klang großartig. Miles spielte eine Zeitlang mit, verließ dann die Bühne, schritt durch das Publikum und ging nach draußen, um eine Zigarette zu rauchen. Während dieser Zeit brachten die Musiker ihre jeweiligen Soli. Die Gruppe begann immer mit einem allseits bekannten Song, doch wenn alle ihre Soli beendet hatten, wusste man, dass sie jammten und Riffs einbrachten.
Einmal hatte Miles einige Kippen geraucht, schlenderte zurück, kam an meinen Tisch und meinte beiläufig: „Ich habe vergessen, welche Nummer wir spielen.“ Ich verriet es ihm, er ging zurück zur Bühne und beendete das Stück.
Wir probten nie im traditionellen Sinn, versammelten uns aber manchmal zu einer „Brainstorming-Session“. Miles sagte zum Beispiel: „Wir werden nächste Woche aufnehmen. Bringt eure Stücke mit.“ Dann flogen die Ideen durch den Raum, und wir diskutierten, wie man die Stücke von dem Punkt aus entwickeln konnte.
Miles hielt sich mit Kommentaren zu unserem Spiel zurück. Er war nicht der Leader, der uns Noten vorlegte oder Vorschläge unterbreitete. Das geschah nur, wenn wir ihn fragten. Aber sogar dann antwortete er mit eher kryptischen Kommentaren, die kleinen Rätseln ähnelten, die wir lösen mussten. Miles redete niemals über die Strukturen von Musik, über Noten, Tonarten oder Akkorde. Es war wahrscheinlicher, dass er von einer Farbe sprach oder einer Gestalt oder Form, die er kreieren wollte. Einmal sah er eine Frau, die die Straße hinunterging und stolperte. Er deutete auf sie und meinte: „Spielt das.“
Während Miles es vorzog, in Metaphern oder Bildern über Musik zu sprechen, verbrachten Tony, Ron und ich lange Nächte damit, nach jedem Gig die performte Musik theoretisch auseinanderzunehmen. Wir redeten über das „Was wäre gewesen, wenn …“ und darüber, was wir am nächsten Abend möglicherweise spielen wollten. Ich liebte Diskussionen über die Musik mit den Kollegen und lernte während der nächtlichen Gespräche unglaublich viel. Ich sog die Informationen förmlich auf, ganz versessen darauf zu lernen, denn Musiker in Miles’ Quintett zu sein, bedeutete ein Erbe zu wahren, eine Blutlinie fortzusetzen, die zurück zu den besten Jazz-Musikern der Geschichte reichte. Möglicherweise empfand ich einen tiefen, eher unbewussten Drang, sie nicht zu enttäuschen.
Zuerst spielte ich zu bemüht. Im Bestreben, Miles alles zu zeigen, was ich draufhatte, überreizte ich meinen Stil. Miles spielte zum Beispiel ein Intro, das ich praktisch konzertierte und dabei die Leerstellen mit Verzierungen und schweren Akkorden füllte. Einige Male kam er zum Klavier und deutete mit Gesten an, mir die Hände abzuhacken, damit ich endlich ruhig war. Ich empfand das als eine von Miles humorvollen Marotten, fand später aber heraus, dass eine ernsthafte Intention dahintersteckte.
Natürlich spielte ich weiterhin Fills, darüber nachdenkend, wie ich das Stück erweitern oder meine eigenen Limits überschreiten konnte. Doch es gab immer wieder Momente, in denen ich nicht wusste, was ich machen sollte oder was man von mir erwartete. So entschied ich mich nach einer Show, Miles direkt darauf anzusprechen.
„Miles, manchmal weiß ich nicht, was sich spielen soll.“
„Dann spiel nichts“, antwortete er, mich nicht mal eines Blickes würdigend. So einfach war das.
Ich hatte niemals daran gedacht, bei einem Song nichts zu spielen. Doch sobald Miles die Worte ausgesprochen hatte, ergaben sie Sinn – perfekt! Ich realisierte endlich, warum er den Witz machte, mir die Hände abzutrennen: Das Fehlen eines Instruments veränderte den Sound eines Songs wohl grundlegender als der Wechsel von Akkorden oder Einzeltönen. Das war Miles pur – er lehrte mich mit nur wenigen Worten etwas Profundes über Musik.
Der Bassist Buster Williams erzählte mir von einer ähnlichen Erfahrung, als er mit dem Quintett Ende der Sechzigerjahre einige Gigs machte.
Miles vermittelte mir in der ersten Woche ein angenehmes Gefühl. Während der Spielpausen unterhielt er sich mit mir über Autos, Kleidung und Ähnliches. Und dann – als wir auf der Bühne standen – sagte er nur: „Spiel dir den Arsch ab, Muthafucka!“ Er gab mir Selbstvertrauen.
Ich hatte aber einige Fragen und entschied mich, ihn anzusprechen. „Miles, alle agieren so frei auf der Bühne. Herbie legt mühelos seine Akkorde, und Tony ähnelt einem großen Feuerball. Und dann spielst du, und manchmal scheint etwas vom Himmel zu kommen, durch deinen Kopf zu schießen und dann in das Horn. Was willst du von mir? Alle spielen so frei – die Form ist da und auch die Wechsel –, aber nur du weißt das, da du es einfach weißt. Niemand wird in ein Muster gepresst, und so bin ich mir nicht sicher, was ich machen soll. Soll ich die Wechsel mitspielen? Oder soll ich das Fundament legen. Oder darf ich so frei spielen wie die anderen?“
Miles schaute mich mit einem großen Lächeln an. Er sagte: „Buster, wenn sie schnell spielen, dann spielst du langsam. Und wenn sie langsam spielen, dann spielst du schnell.“ Auf irgendeine Art und Weise klärte sich für mich alles, obwohl er mir immer noch nicht gesagt hatte, was ich tatsächlich machen sollte.
Dieses Zitat drückt die Quintessenz von Miles’ Verhalten aus: eine Frage mit einem Rätsel zu beantworten, und sich auf den anderen zu verlassen, dass er es löst. Er gab niemals eine schlichte Antwort, wenn er sein Gegenüber stattdessen zum Denken anregen konnte. Und das ist das Kennzeichen eines wahrhaft großen Lehrers.
Einmal befand er sich in einem Club, um sich eine Gruppe junger Musiker anzuhören. Sie wussten, dass er im Publikum saß, und wollten ihn verständlicherweise beeindrucken. Nach Ende des Auftritts ging ein junger Mann zu Miles rüber und fragte: „Mr. Davis, was halten Sie von meinem Spiel?“ Miles schaute ihn einfach an und antwortete: „Tanzt du so mit deiner Freundin? Küsst du sie so?“ Der Junge ließ jede Art von Leidenschaft vermissen, doch Miles hätte ihm das niemals direkt gesagt. Stattdessen wollte er, dass er sich Gedanken über die Leidenschaft machte und das Gefühl auf den Ausdruck des Musikmachens übertrug.
Auch Miles versuchte, sich permanent zu übertreffen. Einmal traten wir in einem Club in Detroit auf. Er drehte sich zu Tony und mir um und fragte: „Warum spielt ihr nicht ein Backing so wie bei George?“ Er hatte gemerkt, dass wir bei Soli von George Coleman die Rhythmen „aufmischten“, was in ein freieres Spiel mündete. Wir „zerbrachen das Metrum“ und spielten stark versetzte Rhythmen. Das brachte den Solisten in der Regel zu einer freieren Interpretation des Songs.
Wir taten das, weil George damals von John Coltrane beeinflusst war und „Tranes“ Band hinsichtlich der Rhythmen und des Metrums in abgefahrene Dimensionen vordrang. George liebte es, wenn Tony und ich eher unkonventionell spielten, da es auch ihn „öffnete“. Im Gegensatz dazu folgten wir bei Miles einem eher bekannten Pfad, wenn er zum Solo ansetzte, egal, um welche Nummer es sich handelte. Ich hatte schon so viele Jahre Miles’ Scheiben gehört, dass ich davon ausging, er wolle uns so spielen hören, wie die anderen Musiker auf den jeweiligen Alben es machten. Doch so lief das nicht. Miles stand darauf, wenn Tony und ich ihn spielerisch zu musikalischen Herausforderungen führten.
Als Miles uns besagte Frage stellte, schauten wir uns überrascht an und versprachen ihm, den Background gehörig „aufzumischen“. Das machten wir an dem Abend in Detroit. Ich begann damit, verschiedene Ansätze einzubringen und unterschiedliche Atmosphären, um somit Miles’ Gewohnheiten zu unterminieren. Zuerst kam er ins Straucheln. Er spielte eine Art abgehackter Phrase – begann und hörte wieder auf –, da Tony, Ron und ich das rhythmische Fundament unter ihm auseinandernahmen. Die ihm gewohnte rhythmische Palette war plötzlich verschwunden, was ihn aus der Bahn warf. Ich las das an der Art ab, wie er die Schultern bewegte, seinen Körper krümmte, um den Rhythmus zu beherrschen.
Miles beschwerte sich nicht, und so legten wir ihm die ganze Nacht einen komplexen rhythmischen Teppich aus. Seine Soli muteten erratisch an, doch am folgenden Abend wollte er noch weitergehen. Wir performten noch weniger vorhersehbar, doch Miles stellte sich besser darauf ein und zeigte sich in der Lage, längere Phrasen zu spielen. Er begann, sich einzupegeln. Und am dritten Abend „zerriss“ er alles, und nun war ich derjenige, der musikalisch sprang und zuckte, dabei versuchend, mit ihm mitzuhalten. An dem Abend spürte ich, dass ich ein ganz anderes Level erreicht hatte. Meine Aufgabe als Instrumentalist sollte sich von nun an radikal vom Bisherigen unterscheiden.
Es bedeutete einen großen Schritt vorwärts, doch erst mal in Form gekommen, wollte Miles uns noch weiterdrängen. Verschiedene Rhythmen zu vermischen, brachte mich zum Spiel offener Harmonien – aber warum konnte ich sie nicht ohne ungewohnte Metren anklingen lassen? Miles mochte es, wenn ich unkonventionelle Akkorde und Harmonien anschlug und damit die Möglichkeiten für einen Solisten erweiterte, auch ohne rhythmische Raffinessen.
Das Spiel in einem Quintett bedeutete tägliches Lernen und Forschen, doch manchmal geriet man auch auf einen ausgetretenen Pfad. Die Lösung, um dem zu entrinnen, bestand darin, einfach weiterzuspielen, doch an einem Abend – wir traten im Club Lennie’s-on-the-Turnpike in Peabody, Massachusetts, auf – musste ich regelrecht kämpfen und hatte das Gefühl, dass alles gleich klang. Meine Frustration spürend, trat Miles hinter der Bühne an mich heran und flüsterte vier Worte in mein Ohr: „Spiel nicht die Buttertöne.“
Ich hatte keine Vorstellung, was er damit ausdrücken wollte, doch ich wusste, dass es wichtig war, denn sonst hätte er geschwiegen. Ich ließ mir die Worte durch den Kopf gehen. Was ist Butter? Butter ist Fett. Fett bedeutet Exzess. Spielte ich exzessiv? Butter konnte sich aber auch auf etwas Leichtes oder Offensichtliches beziehen. Wie Butter. Gab es etwas Offensichtliches in meiner Stilistik? Und wenn ja, wie konnte ich das ändern?
Harmonisch gesehen sind Terzen und Septimen die eindeutigsten Töne eines Akkords. Sie verraten dem Hörer, ob es sich um einen Moll- oder Dur-Akkord handelt oder einen Dominantseptakkord oder Majorseptakkord. Ich überlegte. Wenn ich nun auf die Terz oder Septime verzichtete? Sie nicht spielte? Das würde sicherlich neue Möglichkeiten eröffnen. Da ich nicht an so eine Spielweise gewohnt war, konnte es mich jedoch auch auf ein vollkommen anderes Terrain bringen.
Ich entschied mich, es zu versuchen. Nicht nur bei Akkorden – was an sich schon schwierig genug ist –, sondern auch bei den improvisierten Melodielinien der rechten Hand. Das war verdammt tückisch, denn das ging mir gegen den Strich, war gegen alles bisher Gelernte und Gespielte. Ich war jedoch fest entschlossen, es umzusetzen. Da Miles uns Raum zur freien Entfaltung gab, wusste ich, dass er nichts dagegen hätte. Er würde sich meiner Meinung nach sogar freuen, wenn wir an etwas Neuem arbeiten würden.
Da das Quintett niemals probte, begann ich mein Experiment eines Abends direkt auf der Bühne. Ich musste mich so sehr konzentrieren, dass es eher einer Übung glich, ähnlich dem Spielen von Tonleitern, und nicht reiner Musik. Die Läufe klangen unregelmäßig, und ich musste ständig aufhören, da meine Finger automatisch zu den Terzen und Septimen wanderten. Ich empfand mein Spiel als unbeholfen, bekam an dem Abend aber mehr Applaus als in der ganzen Woche. Das Publikum spürte, dass ich meine Grenzen überschritt, etwas Neues versuchte, und die Leute mochten es.
Normalerweise besteht ein Akkord aus drei Grundnoten. Da ich nun die „Buttertöne“ vermied, reduzierte sich der volle Akkord auf ein oder zwei Noten. Manchmal spielte ich zwei nebeneinanderliegende Noten, also Sekunden. Doch ich schlug nie die Terzen und Septimen an, wodurch die Akkorde offen klangen. Das ermöglichte dem Solisten mehr Raum, gab ihm verschiedenste Wahlmöglichkeiten der Richtung, die er einschlagen wollte. Das klang minimalistisch und ungewöhnlich, doch am wichtigsten war mir eine neue Perspektive, um die Musik zu betrachten und das der Improvisation zugrundeliegende kompositorische Element.
Nachdem ich mich erst mal an ein Spiel ohne „Buttertöne“ gewöhnt hatte, begab ich mich auf den umgekehrten Weg und setzte sie wieder ein. Nun waren es allerdings keine „Buttertöne“ mehr: Ich spielte sie nicht, weil ich es musste, so wie früher. Ich spielte sie, weil ich es wollte. Und das änderte alles für mich – und das nur, nur weil Miles die vier Worte gesagt hatte.
Eine kleine Anekdote. Jahre später kam mir das Gerücht zu Ohren, Miles habe mir tatsächlich geraten, auf die tiefen Töne zu verzichten [„bottom notes“], was ich angeblich missverständen hätte [„butter notes“]. Wie auch immer: Diese vier Worte, die ich hörte – oder die ich zu hören glaubte – veränderten mein Leben.
Tony Williams war beim Einstieg ins Quintett erst siebzehn Jahre alt. Das stellte ein Problem dar, denn er war zu jung, um sich in den Clubs aufzuhalten, in denen wir auftraten. Miles riet ihm, sich einen Bart wachsen zu lassen, doch sogar dann sah Tony noch wie der Teenager aus, der er war.
Clubbesitzer versuchten damals, die Altersbeschränkung mit einigen Tricks zu umgehen. Sie trennten einen Teil des Clubs für jüngere Gäste mit einer Kordel ab, wo man der Klientel nur Mineralwasser ausschenkte. Manchmal verzichteten sie sogar ganz auf den Alkoholausschank, wenn Tony die Bühne betrat. Wir spielten einen Gig, bei dem Miles einen anderen Drummer für das erste Set engagierte, damit die Leute ihr System genügend „auftanken“ konnten. Als Tony die Bühne betrat, wurde der Alkoholausschank dann eingestellt. Einige Zuschauer bei den „Konzerten ohne Alkohol“ nahmen an, Miles sei auf einen möglichst stillen Club bedacht, da er die Musik so ernst nehmen würde, dass ihn das Klickern der Eiswürfel in den Drinks gestört hätte. Doch der ganze Aufwand fand nur wegen seines Schlagzeugers statt.
Miles liebte Tonys Stil, weshalb er auch auf andere Kompromisse einging. Zum ersten Mal seit Wochen spielten wir damals alle Nummern in einem hohen Tempo, flogen förmlich, sogar bei Balladen – alles lief boom-boom-booom ab, gelegentlich dreimal so schnell wie das Grundmetrum. Das war unglaublich aufregend, aber auch extrem anstrengend. Eines Tages hatten wir genug davon und inszenierten eine Revolution. Ron ging zu Miles und sagte mit Nachdruck: „Es wird uns zu viel, jedes Mal so schnell zu spielen. Wir brauchen einige langsamere Nummern und sollten einige Balladen auch wie Balladen spielen.“ Danach achtete Miles auf ein eher gemischtes Programm.
Zuerst konnte ich mir nicht erklären, warum Miles das schnellere Tempo für die Band anvisierte. Als ich darüber nachdachte, schien mir, dass er es wegen Tony machte. In den frühen Tagen des Quintetts fühlte sich Tony bei mittleren oder langsamen Tempi unwohl. Da er aber so ein wichtiger Faktor in der Band war, wollte Miles vermutlich seine Stärken betonen, während Tony musikalisch reifte. Ich habe ihn nie danach gefragt, und somit könnte ich mit dieser Vermutung auch danebenliegen. Allerdings ist es die einzige Schlussfolgerung, die mir einfällt.
Miles und Tony hatten eine intensive und aufreibende Beziehung, sowohl persönlich als auch finanziell. Tony lebte in einem Apartment, das Miles gehörte, einige Stockwerke über ihm. Manchmal krachte es bei den beiden auch, was Themen wie Miete oder die Gage anbelangte. Tony konnte ein richtiger Hitzkopf sein, und er rieb sich an Miles, ähnlich einem Bock, der sein Geweih in einen Baumstamm rammt. Gelegentlich sprachen sie nicht mehr miteinander, und jeder meckerte über das, was der andere angestellt habe. Während dieser Phasen antwortete Miles schroff und zischend, wenn wir etwas diskutieren wollten: „Fragt nicht mich, fragt ihn.“ Doch um nichts in der Welt hätte ich mich in solchen Situationen in die Schusslinie zwischen den beiden begeben.
Tony erdreistete sich sogar, Miles’ Spiel zu kritisieren. Das hörte ich allerdings erst geraume Zeit später. Tony studierte die Musik wie ein Besessener, lernte alles über verschiedene Stilistiken, was sogar so weit ging, dass er alle Parts bestimmter Stücke auswendig draufhatte. Manchmal begann er einen Vortrag über das „modale Tonleitersystem der europäischen Harmoniegeschichte, zurückreichend ins zwölfte Jahrhundert“, als sei es ein Lehrfach, von dem wir alle wüssten. Er arbeitete so obsessiv, dass ihn Miles irritierte, der sein Interesse an Proben und Studien nicht teilte.
„Mann, warum übst du nicht?“, fragte Tony frei heraus, als sei es völlig normal, wenn ein Schlagzeuger im Teenageralter den bedeutendsten Trompeter seiner Generation belehrte, einen Mann, alt genug, um sein Vater zu sein. Tonys einziges Kriterium, ob ein Musiker einen anderen kritisieren durfte, war Talent – weder Alter noch Erfahrung, sondern nur Talent zählte. Jahre später meinte Bryan Bell – der Mann, der einen Großteil der elektronischen Musiktechnologie entwickelt und praktisch umgesetzt hatte – zu Tony, er sei ein großartiger Schlagzeuger. Tony antwortete: „Bryan, du bist nicht gut genug, um so ein Urteil zu fällen.“
Bryan fühlte sich vor den Kopf gestoßen, doch er antwortete: „Mir gefiel deine Performance.“
Darauf antwortete Tony: „Das darfst du sagen.“
Hatte Tony einen Zwist mit einem der Musiker des Quintetts, dann bestrafte er denjenigen, indem er bei dessen Solo die Drum-Begleitung verweigerte. Er hörte einfach auf, ließ ihn in der Luft hängen, um ihm eine Lektion zu erteilen. Tony war gelegentlich sehr temperamentvoll und launisch, doch egal, welche Probleme den Stimmungsschwankungen zugrunde lagen – sie wurden durch seine „monströsen“ Fähigkeiten relativiert. Da er so jung war, ließen wir ihm seine Launen durchgehen. Als Teenager spielte er mit der heißesten Jazz-Band der Szene. Sich plötzlich in so einer Situation wiederzufinden, hätte auf jeden einen ungeheuren Druck ausgeübt.
Während der Jahre mit Miles wurde Tony ein enger Freund. Bevor Wayne einstieg, war er mein Kumpel in der Band, der, mit dem ich mich am intensivsten über das Leben, die Musik und andere Themen unterhielt. Er trieb sich erbarmungslos an, um ein besserer Musiker und Komponist zu werden, und ich lernte so viel von ihm wie von den damaligen Kollegen, zu denen ich aufschaute. Tony glaubte an seine Fähigkeiten, aber suchte immer einen Lehrer, auch wenn es sich um keine pädagogisch ausgebildete Kraft handelte. Ständig studierte er, lernte dazu.
Als Tony die Songs für sein erstes Album Life Time komponierte, saß er vor dem Piano und „pflückte“ sich die Melodien mit dem Zeigefinger, wie ein kleines Kind, das gerade mit dem Klavierspiel beginnt. Er wollte kein Pianist werden, sondern benötigte nur ein Vehikel zum Ausarbeiten von Melodien. Ich verbrachte Stunden damit, ihm zu helfen, transkribierte die von ihm gespielten Melodien und versuchte dann, mittels „trial and error“ die Harmonien zu finden, die ihm vorschwebten. Tonys Songs ließen sich als komplex beschreiben, waren so ganz anders als simple Popsongs und sicherlich nicht zum Mitsingen geeignet.
Aber auch Tony half mir beim Lernen, indem er bei mir eine bestimmte Offenheit gegenüber anderen Musikstilen anregte. Der Altersunterschied zwischen uns betrug lediglich sechs Jahre, doch es waren entscheidende Jahre, denn wie alle nach 1945 Geborenen wuchs Tony im Zeitalter des Rock’n’Roll auf. Als dieser Stil überaus populär wurde, beschäftigte ich mich schon längst ausschließlich mit Jazz. Jazz und die Klassik waren die einzigen Genres, die ich mir zu Gemüte führte. Man kann mich zu der Zeit als schrecklichen Musik-Snob bezeichnen. Tony und Miles – der sich alles von Janis Joplin über James Brown bis hin zu Cream anhörte – halfen mir darüber hinweg.
Darüber hinaus machte mich Tony mit den neuesten musikalischen Entwicklungen bekannt. Lange, bevor ich mich damit beschäftigte, war er in der Avantgarde-Szene aktiv und fühlte sich auch wohler mit der Entwicklung, die das Subgenre nahm. Meist stellte ich ihm viele Fragen, wollte herausfinden, was ihn beeinflusst hatte. Er verfügte über das beeindruckende Talent, immer mit etwas Neuem aufzuwarten, aus seinen Drums Klänge hervorzuzaubern, die noch niemand gehört hatte. Was die Musik anbelangte, kannte er keine Ängste, und diese Furchtlosigkeit wirkte sich auf den Rest des Quintetts aus, ging uns in Fleisch und Blut über.
Eines Abends hatten wir gerade in Chicago eine Show im Lyric Theatre beendet, als George Coleman in die Garderobe kam und sagte: „Hey, Mann – Billy Eckstine hängt mit einigen Typen in seiner Garderobe ab und säuft. Er erzählt Scheiße über Miles.“ Eckstine war ein legendärer Sänger und der Leader des Billy Eckstine Orchestra, einer bedeutenden Bigband. Einige der größte Musiker der Ära hatten in dem Orchester gespielt, darunter Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Art Blakey und Dexter Gordon, nicht zu vergessen Miles, was aber schon Jahre zurücklag. Was in aller Welt quasselte er über Miles?
„Komm schon“, forderte mich George auf. Wir gingen beide zu Eckstines Garderobe, um herauszufinden, was da abging. Eckstine war sternhagelvoll und arbeitete sich an Miles ab – ich kann mich zwar nicht mehr an die genauen Worte erinnern, doch keiner der Ausdrücke war schmeichelhaft. Ich schätze, irgendjemand steckte Miles die Info, denn wenige Minuten später kam er plötzlich durch die Tür. Eckstine schaute ihn an und lallte: „Hey, Raben-Schwarzer.“
Oh, mein Gott, dachte ich nur, Miles wird ausrasten. Eckstine war zwar ein Schwarzer, aber mit einem helleren Teint und Augen, die ihn zu einem Frauenschwarm machten. Ja, und Miles war für seinen sehr schwarzen Teint berühmt. Einen Mann mit einer dunkleren Hautfarbe so zu beschimpfen, war indiskutabel, außer, man wollte ihn provozieren. Ich wusste von Miles’ Vergangenheit als Boxer und stellte mir vor, wie er Eckstine ausknockte. Ein armer Hausmeister würde heute Nacht noch Billy Eckstines Blut aufwischen müssen!
Doch Miles unternahm nichts und schwieg – er ignorierte den Kommentar. Das war doch nicht zu glauben! Ein Mann beleidigte Miles direkt, und der verteidigte sich nicht einmal? Ich war von ihm enttäuscht.
Je länger ich aber darüber nachdachte, desto deutlicher erkannte ich die Stärke, die er in dem Moment bewies. Billy Eckstine war älter, und er hatte Miles zu Beginn seiner Karriere einen Job gegeben. Miles war in der Lage, alle nur erdenklichen Regeln zu brechen, doch wenn es um Beziehungen ging, praktizierte er eine Art ethischen Kodex. Die Tatsache, dass er nur dastand und es wegsteckte – dass Eckstine ihn in einem Raum voller Zeugen einen „Raben-Schwarzen“ genannt hatte –, war ein Beweis von Stärke, nicht ein Zeichen von Schwäche. Allerdings war es gut, dass Eckstine kein Weißer war, denn in dem Fall hätte ihn Miles k.o. geschlagen.
Was nur wenige über Miles wissen: Er machte auf andere einen wilden Eindruck und scherte sich kaum darum, was sie über ihn dachten, so dass die Menschen seine weichere Seite nicht erkannten. Zuerst fühlte ich mich – wie jeder andere auch – von Miles eingeschüchtert. Doch bei den Tourneen lud er uns regelmäßig im Hotel in sein Zimmer ein, wo wir einen üppig gedeckten Tisch vorfanden. Er bestellte alle nur erdenklichen Gerichte und nahm selbst erst einen Happen, als er sich sicher sein konnte, dass wir alle satt waren. Er bekochte uns sogar in seinem Haus. Einmal bereitete er für uns ein Dinner vor und trug dabei lediglich einen Smoking – keine Schürze oder etwas Ähnliches. Sein Haus verfügte über zwei Küchen, und er war ein phänomenaler Koch. Miles zeichnete eine bestimmte Leichtigkeit aus, besonders, wenn er Musik machte. Er liebte es zu spielen und klang dabei wie ein Stein, der über die Wasseroberfläche eines kleinen Teiches hüpfte. Ich hatte nie das Gefühl, nur für ihn zu arbeiten, was er andererseits auch nicht gewollt hätte. Es machte viel zu viel Spaß, als dass der Anschein einer Arbeitssituation aufgekommen wäre.