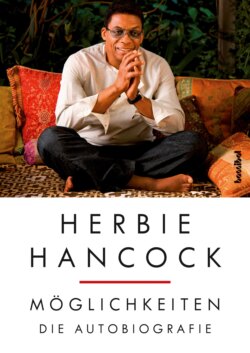Читать книгу Möglichkeiten - Lisa Dickey, Herbie Hancock - Страница 7
ОглавлениеIn der Highschool sah ich zum ersten Mal einen weißen Schüler. Während der Zeit in der Grundschule in Forestville waren alle schwarz gewesen, bis auf die Ausnahme einiger Lehrer. In meinem Viertel lebten keine weißen Familien, und da ich im Grunde genommen nirgendwo hinging, traf ich auch nie Andersfarbige. In unserem Teil von Chicago waren die einzigen Weißen, denen man begegnete, Menschen, die Geld von einem haben wollten – der Mann von der Versicherung oder der Vermieter.
Nur durch die Geschichten und Erzählungen meines Vaters erfuhr ich etwas über die weißen Kids. Er hatte die ersten Jahre seines Lebens in einem von der Rassentrennung gekennzeichneten Süden verbracht, wonach er eine gemischte Grundschule in Chicago besuchte, in der er oft in Schlägereien verwickelt wurde. Als ich das erste Jahr in der Hyde Park High School begann – drei Viertel aller Schüler waren weiß –, verhielt ich mich verständlicherweise vorsichtig und wachsam.
Ich hatte eine Klasse in der Grundschule übersprungen und war somit noch sehr jung für einen „Freshman“ – erst zwölf, als ich erstmalig einen Fuß in die Hallen der Hyde Park setzte. Eigentlich mussten wir die Highschool nicht besuchen, denn wir lebten nicht im Hyde Park District, doch die akademische Ausbildung war eindeutig besser, weshalb sich Mom fest entschlossen zeigte, uns dorthin zu schicken.
Da eine Tante und ein Onkel in dem Viertel wohnten, benutzten meine Eltern deren Adresse, als sie uns anmeldeten.
Als ich am ersten Tag meines Freshman-Jahrs zur Highschool ging, schwirrten die ganzen Geschichten in meinem Kopf herum, die mir Dad erzählt hatte. Ich erwartete, dass etwas Schlimmes passieren würde, und bereitete mich auf eine Prügelei vor, doch zu meiner großen Überraschung waren die weißen Kids – einfach ganz normale Kids. Nach dem ersten Schultag rannte ich nach Hause, riss die Tür zu unserer Wohnung auf und schrie: „Mama! Mama! Sie sind ja so wie wir!“ Aus heutiger Sicht klingt das albern und naiv, aber damals stellte das für mich eine große Überraschung dar.
Die Hyde Park war eine liberale Schule, und so empfanden wir uns als fortschrittlich, was die verschiedenen Nationalitäten und andere Themen anbelangte. Doch so fortschrittlich wir uns selbst einschätzten, es waren immer noch die Fünfziger, und viele Menschen runzelten die Stirn, wenn sie sahen, dass Schwarze ein Rendezvous mit Weißen hatten. Allerdings erlebte ich offenen Rassismus eher seitens entfernter Verwandter und nicht seitens der Highschool-Freunde. Verglichen mit der Verwandtschaft hatte ich eine dunklere Hautfarbe, und in schwarzen Familien stellt das ein leichtes Angriffsziel dar. Wenn ich manchmal aus der Rolle fiel, nannte man mich einen „bösen schwarzen Schurken“. Doch so gut ich mich erinnern kann, beschimpfte mich niemand auf der Highschool mit Worten, die im Zusammenhang mit meiner Hautfarbe standen.
Und auch wenn es so gewesen sein mag, tat ich mein Bestes, um darüber hinwegzusehen. Ich fällte in der Highschool die bewusste Entscheidung, die verschiedenen ethnischen Herkünfte nicht zu fokussieren – so es mir möglich war. Aber natürlich existierte Rassismus, und in den Fünfzigern machten gelegentliche Anfeindungen einen Teil des amerikanischen Alltags aus. Man musste nicht danach suchen, denn er war omnipräsent und reichte von Weißen, die hinsichtlich des Lohns, der Anstellung und der Wohnungssuche bevorzugt wurden, bis hin zu Weißen, die einen Schwarzen als „Boy“ beschimpften. Doch schon früh realisierte ich die Wahlmöglichkeiten: Der einfachste Weg bestand darin, sich zurückzulehnen und rassistische Anfeindungen zu erwarten – die Ungerechtigkeit und die bösen Absichten bei jeder sich bietenden Gelegenheit vorherzusehen, sich selbst zu sagen: Ich bin schwarz und werde niemals gerecht behandelt werden, und das Leben dementsprechend auszurichten. Ich hingegen fällte eine gegensätzliche Entscheidung.
Einige Schwarze suchten den Rassismus regelrecht, doch für mich war es wichtig, ihn nicht zu beachten, da die Erwartungshaltung mental auf eine Opferrolle vorbereitete, die keinem half. Diese Opfermentalität grassierte in unserem Viertel, doch es gelang mir, einen Weg dort heraus zu finden. Das ließ sich teils auf meine Eltern zurückführen, die uns drei in dem Glauben erzogen, dass wir alles erreichen könnten, wenn wir uns nur stark genug konzentrierten. Doch auch meine eigene Neugierde trieb mich zu einem anderen Verhalten an. Als ich die Highschool begann, umgaben mich erstmalig in meinem Leben unterschiedlichste Menschen. Doch statt mich wie ein Außenseiter zu fühlen oder als ein Mensch, der von den anderen beurteilt wird, wollte ich alles über sie wissen.
Nachdem ich ausschließlich unter Schwarzen aufgewachsen war, hatte ich plötzlich jüdische, italienische und asiatische Freunde – und wusste überhaupt nichts über ihre Kulturen. Ich wollte ihnen bei Gesprächen zuhören, sehen, wie sie lebten, und etwas über ihren Glauben erfahren. In der Hyde Park blieben die meisten ethnischen Gruppen unter sich, doch ich ahnte, dass ich mich nicht auf die Gruppe der Schwarzen beschränken sollte.
Eine meiner ersten Freundinnen war weiß, ein Mädchen namens Barbara Laves, die im Orchester Violine spielte. Sie war eine süße Brünette mit atemberaubenden hellblauen Augen, und ich brachte sie jeden Tag nach der Schule nach Hause. Barbara und ich blieben allerdings nicht allzu lange zusammen. Ich ging auch mit schwarzen Mädchen aus, darunter mein bevorzugtes Date Peggy Milton, doch ich belastete mich nie großartig mit Gedanken an ethnische Zugehörigkeit. Wenn ich ein Mädchen mochte, warb ich um ein Rendezvous. Und wenn andere Leute damit ein Problem hatten – tja, entweder wusste ich nichts davon oder, was noch wahrscheinlicher war, ich schenkte ihnen keine Aufmerksamkeit.
Meine Eltern versuchten eine Zeitlang, uns in Kirchengänger zu verwandeln, doch ohne großen Erfolg. Zuerst schleppten sie uns in die Ebenezer Baptist, eine von Dutzenden Baptistenkirchen, die sich in der South Side breitgemacht hatten. Die Musik war fantastisch. Es gab einen Gospelchor für Kinder und Jugendliche und einen für Erwachsene. Ich mochte besonders den Teil des Gottesdienstes, in dem sie sangen. Allerdings durchzogen die Predigten Feuer, Pech und Schwefel, was weder mich noch meine Mutter ansprach. Bei einem Priester, der ständig Hölle und Verdammnis zitierte, lernte man nicht viel.
Daraufhin brachten sie uns in eine African Methodist Episcopal Church, nur wenige Blocks entfernt. Auch dort gefielen mir die Chöre, doch nicht die religiösen Lieder. Allerdings widersprach mir die Botschaft, die auf der Vorstellung von Himmel und Hölle und von Vergeltung und Bestrafung beruhte. Offensichtlich ging es meinen Eltern ähnlich, denn als Nächstes suchten wir eine Kirche der Unitarier auf, wo niemand Feuer, Pech und Schwefel predigte. Mutter mochte die Glaubensgemeinschaft, denn sie war offen und schien auf einer intellektuellen Basis – und keiner emotionalen – zu beruhen. Dennoch besuchten wir auch diese Kirche nicht allzu lange.
Mich sprach keine der Religionsgemeinschaften an, doch als Kind war ich immer neugierig, was die große und bedeutende Frage der Existenz betraf. Abends, wenn mein Bruder schon eingeschlafen war, setzte ich mich oft auf die Fensterbank, schaute zu den Sternen hoch und dachte über den Tod, das Leben und das Universum nach. An einem bestimmten Punkt angelangt, kam ich zu der Überzeugung, dass wir nach dem Tod als andere Wesen erneut wiederkehren würden. Jahre später erfuhr ich, dass darin der Glaubenskern des Buddhismus bestand.
Die Vorstellung von Himmel und Hölle ergab niemals einen Sinn für mich. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass man nach dem Tod erlischt und dann an einem unbekannten Ort wieder auftaucht. Materie und Energie wandelten sich, doch verschwanden nicht: Aus dem Samen wird ein Baum, aus dem Baum ein Stuhl, aus dem Stuhl wird Asche, wonach der Zyklus erneut beginnt. Ich empfand es schlichtweg als unlogisch, dass unser Leben und der Tod sich davon unterscheiden sollten.
So arbeitete mein Verstand. Es war die Suche nach der logischen Sequenz der Dinge. Als Kind liebte ich die Mechanik und die Wissenschaften und verbrachte Stunden mit dem Auseinanderbauen von Uhren und Toastern, da ich ein drängendes Bedürfnis verspürte, ihre Funktionsweise exakt kennenzulernen. Mich zog der rationale Zusammenhang der Systeme an, ich war verzaubert von der Vorstellung, dass das Zerlegen eines Objekts zu einem umfassenden Verständnis desselben führt.
Eines Tages in der Highschool entschied ich mich dazu, diese Art der Logik auf andere Lebensbereiche zu übertragen. Ich hatte etwas angestellt, das meine Eltern verärgerte, und sie wollten mich als Strafe nicht zu einer Party gehen lassen, auf die ich mich schon lange freute. Die Strafe erschien mir ungerecht, und ich war wütend. Das Gefühl des Zorns überkam mich nur selten, doch das hier schien so unberechtigt zu sein, dass ich regelrecht überschäumte. Ich stand vor einer Art unüberwindbarer Barriere, fühlte mich hilflos und wegen der Ungerechtigkeit beinahe schon als Opfer. Es brodelte tagelang in mir.
Am Tag der Party saß ich niedergeschlagen in meinem Zimmer und kam zu dem Entschluss: Okay, ich werde jetzt rational darüber nachdenken, was hier vor sich geht. Dann entschied ich mich, die Situation wie ein mechanisches Objekt auseinanderzunehmen und sie zu analysieren. Die Party begann um zweiundzwanzig Uhr, und ich müsste sie schon wieder um Mitternacht verlassen, da ich nie länger ausbleiben durfte. Das waren also zwei Stunden meines Lebens, und danach würde ich mich wie eh und je mit anderen Dingen beschäftigen, egal, ob ich nun bei der Party gewesen war oder nicht. Plötzlich wurde mir alles klar: Ich muss nur diese zwei Stunden überstehen, und dann geht das Leben wieder seinen normalen Gang.
Ich verhielt mich dementsprechend. Von zweiundzwanzig bis vierundzwanzig Uhr las ich in Büchern, hing in meinem Zimmer ab, und nach Mitternacht war alles überstanden. Ich fühlte mich nicht mehr wie ein Opfer, sondern war stattdessen stolz auf mich. Ich hatte die Kontrolle über meine Emotionen erlangt und einen Weg gefunden, den Ärger zu umgehen. Von dem Zeitpunkt an gab es keine Möglichkeit mehr, mich zu bestrafen, da mir klargeworden war, dass ich allein die Verantwortung für die Reaktion auf eine gegebene Situation trug.
Das stellte eine großartige Entwicklung dar. Ich würde mich niemals mehr von externen Faktoren zum Opfer machen lassen, da mir die Kontrolle oblag, in welchem Umfang sie mich emotional beeinflussten. In vielerlei Hinsicht war das eine nützliche und hilfreiche Charakterentwicklung, die ich aber im Laufe der Zeit bis zum Extrem ausreizte und mich somit desensibilisierte. Ich bin niemals ein besonders gefühlsbetontes Kind gewesen, doch von der Highschool an hielt ich meine Emotionen im Zaum. Ich weinte fast nie, egal, wie traurig oder aufgewühlt ich mich fühlte. Wenn mich etwas zu stark negativ berührte, machte ich eher „zu“, als die unangenehmen Gefühle wahrzunehmen.
Doch es gab eine schreckliche Ausnahme. Es geschah zu Beginn meines letzten Highschool-Jahres – der Mord an Emmett Till.
Emmett Till war vierzehn, nur ein Jahr jünger als ich, und stammte auch aus der South Side von Chicago. Im August 1955 reiste er nach Mississippi, um Verwandte zu besuchen. Seine Mutter hatte ihn vor der Abreise vor den krassen Diskrepanzen zwischen dem Norden und dem Süden der USA gewarnt, ihn darauf hingewiesen, sich angemessen zu verhalten. Doch als Till und einige Freunde in ein Geschäft gingen, um Süßigkeiten zu kaufen, forderte ihn einer der anderen Jungs heraus, die einundzwanzigjährige weiße Verkäufern Carolyn Bryant anzusprechen. Offensichtlich pfiff er ihr nach und gab damit vor den Freunden an. Als Bryant ihrem Mann Roy davon erzählte, entschied der sich für Vergeltung.
Wenige Tage später kidnappten Roy Bryant und einige andere Männer Till und verprügelten ihn mit dem Knauf einer Pistole. Dann legten sie den blutenden Jungen auf die Ladefläche eines Pick-ups, warfen eine Abdeckplane über ihn und fuhren zu einer Entkörnungsmaschine, wo sie einen ungefähr 35 Kilogramm schweren Ventilator abmontierten. Die Fahrt endete an den Ufern des Tallahatchie River, wo man Till in den Kopf schoss, den Ventilator als Gewicht an seinem Hals befestigte und ihn dann ins Wasser warf.
Drei Tage danach fanden im Fluss fischende Kinder den Leichnam Tills. Seine trauernde Mutter bestand darauf, dass man den Körper ihres Sohnes in einem Piniensarg aufbahrte und mit dem Zug nach Chicago überführte, statt ihn in Mississippi zu beerdigen. Der Sarg erreichte A. A. Rayners Bestattungsunternehmen Anfang September. Als Tills Mutter das schrecklich entstellte Gesicht ihres Sohns erblickte, entschied sie sich, bei der Beerdigung den Sarg offen zu lassen, damit die ganze Welt sehen konnte, was diese Männer in Mississippi Till angetan hatten.
Zufälligerweise fuhren wir exakt an dem Tag der Ankunft von Tills sterblichen Überresten an Rayners Bestattungsunternehmen vorbei, das nicht weit entfernt von unserem Apartment in der South lag. Ich beobachtete weinende Menschen, die aus der Tür herausstolperten, und sah schockiert, wie ein tränenüberströmter und verzweifelt um Worte ringender Mann auf die Straße trat und mit in den Himmel gestreckten Händen hilflos gestikulierte. Niemals zuvor hatte ich Menschen so außer sich gesehen, und das verängstigte mich zutiefst.
Das Jet-Magazin publizierte eine Nahaufnahme von Tills verschwollenem und verunstaltetem Antlitz. Obwohl meine Eltern versuchten, uns davon abzuschirmen, überkam mich die Neugier. Als ich das Magazin nahm, zum Foto blätterte und es sah, überwältigten mich panische Angst und Entsetzen. Egal, wie sehr ich auch geglaubt hatte, meine Gefühle zu kontrollieren – nichts hätte mich darauf vorbereiten können, das grausam entstellte Gesicht eines Jungen meines Alters zu sehen, aus meiner Nachbarschaft, den man für eine Lappalie brutal ermordet hatte. Wochen danach noch plagten mich Albträume.
Die Radiosendung des WGES-DJs Al Benson stellte meinen erstmaligen Kontakt zum Jazz her. Bekannt als der „Godfather of Chicago Black Radio“ legte Benson den ganzen Tag Platten auf, meist Blues oder R&B, gewürzt mit einer gelegentlichen Jazz-Nummer. „Moonlight In Vermont“ – gespielt von dem Gitarristen Johnny Smith, mit Stan Getz am Tenorsax – war die erste Jazz-Performance, die ich bewusst wahrnahm. Es war eine Ballade, einfach ein schöner Song, den ich mochte, aber sicherlich keine Offenbarung des Jazz. Zum Erscheinungstermin im Jahr 1952 hörte ich wie auch die anderen Kids in der Nachbarschaft überwiegend R&B.
Meistens standen wir an Straßenecken, sangen und imitierten unsere Lieblingsgruppen – die Orioles, die Midnighters, die Five Thrills und die Ravens. Später hörte ich die Four Freshmen, ein Gesangsquartett, das Mitte der Fünfziger mit Songs wie „Mood Indigo“ und „Day By Day“ berühmt wurde.
Die Four Freshmen sangen Harmonien, die weit entfernt von den sogenannten Vier-Part-Barbershop-Tonschichtungen entfernt lagen, die in den Dreißigern populär gewesen waren. Sie sangen eher jazzige Harmonien mit großen Septimen und sogar einigen Nonen-Akkorden, die mich faszinierten und dazu brachten, selbst den Gesang zu erlernen. Ich liebte auch die Hi-Lo’s, eine weitere Vokalgruppe, deren Pianist Clare Fisher viele ihrer Songs arrangierte. Fishers Arrangements übten einen unglaublichen Einfluss auf mein Verständnis harmonischer Zusammenhänge aus.
Ich liebte die Art des Gesangs so sehr, dass ich in der Hyde Park meine eigene Gesangsgruppe gründete. Obwohl mich R&B und benachbarte musikalische Genres interessierten, kam es mir nie in den Sinn, etwas anderes als klassische Musik auf dem Klavier zu spielen.
Meist spielte ich bei den Proben des Highschool-Orchesters, um die Geiger und andere Instrumentalisten zu unterstützen, die mühselig ihre Stimmen lernten. Allerdings trat das Orchester nie mit einem Pianisten auf, weshalb ich bei Konzerten Becken und generell Percussion übernahm. Die Hyde Park hatte auch eine Tanzband, deren Pianist Don Goldberg hieß. Er war zwar in meiner Stufe, doch ich hatte ihn damals noch nicht kennengelernt. Don spielte in einem Schüler-Jazz-Trio. Als ich sie schließlich an einem Nachmittag in meinem zweiten Jahr sah, machte er etwas, das mein Leben radikal veränderte: Jedes Semester führte die älteste Stufe eine Varieté-Show für alle Klassen auf. Dons Trio – Klavier, Kontrabass und Drums – ging auf die Bühne, und als sie zu spielen begannen, beobachtete ich natürlich sein Spiel. Sein Auftritt haute mich förmlich um, denn er improvisierte! Ich hatte keine Ahnung, dass das Jungs in unserem Alter konnten, denn ich dachte immer, dass nur ältere Musiker improvisierten. Bitte denken Sie daran – „älter“ bedeutete für mich: mit vierzehn, neunzehn oder zwanzig Jahren.
Seit dem Alter von sieben Jahren hatte ich Klassik gespielt und war somit ziemlich gut im Notenlesen, doch Don konnte etwas auf meinem Instrument, das mir bisher vorenthalten war. Er selbst kreierte die Musik, exakt in dem Moment, und las sie nicht von einem Blatt Papier ab! Mein Herz begann wie verrückt zu rasen, und nachdem das Trio die drei Stücke beendet hatte, hetzte ich zur Garderobe, wo ich Don fand. Schnell stellte ich mich vor, und dann konnte ich mich nicht mehr zurückhalten.
„Mann, wo hast du nur gelernt, so zu spielen? Ich habe überhaupt nicht verstanden, was du gemacht hast, stand aber total drauf. Ich will das auch lernen – lernen, wie man Jazz spielt.“
Don lachte und meinte: „Tja, wenn dir mein Spiel gefiel, solltest du dir als Erstes unbedingt eine Platte von George Shearing besorgen.“ Er riet mir, Shearings Stil anzuhören und danach die Parts zu imitieren, die ich mochte. So hatte er es gelernt und war im Alter von fünfzehn Jahren schon ziemlich gut in der Improvisation.
Als der Schulbus mich nachmittags absetzte, rannte ich nach Hause, raste durch die Wohnungstür und rief: „Mama! Wir müssen uns unbedingt Platten von George Shearing kaufen!“ Sie starrte mich an, als hätte ich drei Köpfe. „Herbie“, meinte sie ungläubig, „du hast doch schon welche.“
„Nein, Mama“, entgegnete ich. „Du verstehst mich nicht. Wir brauchen ganz dringend George Shearing-Platten. Nicht irgendwelche Platten.“
„Herbie“, antwortete sie belehrend, „kannst du dich an letztes Jahr erinnern, als ich dir einige Platten mit nach Hause brachte? Du warst sauer auf mich, weil du andere wolltest, hast gesagt, es seien die falschen. Das waren Platten von George Shearing! Geh, schau mal in den Schrank.“
Ich ging durch das Wohnzimmer zum mit 78ern gefüllten Schrank, und da standen sie: Alben von George Shearing und seinem Quintett. Ich hatte sie mir niemals angehört, immer den Jazz als die Musik der Älteren empfunden, als etwas, das irrelevant für mich war. Aber nun – dank des Erlebnisses, einen Gleichaltrigen beim Improvisieren gesehen zu haben – fand ich die Musik aufregend und wollte sie selbst machen.
Ich ließ die 78er aus der Hülle in meine Hand gleiten und legte sie auf den Plattenteller. Dons Trio hatte drei Songs des George Shearing Quintett aufgeführt: „Lullaby Of Birdland“, „I’ll Remember April“ und „A Nightingale Sang In Berkeley Square“. Ich setzte die Nadel bei „I Remember April“ auf und erkannte, während ich mir das Stück anhörte, dass es stark nach Don klang! Das verriet mir alles – wenn Don das spielen konnte, warum sollte ich es nicht können? An dem Nachmittag versuchte ich, es zu erlernen.
Die ersten Ansätze waren schrecklich. Ich klang so, wie ich immer spielte, wie ein Klassiker, der das Improvisieren zu erlernen versucht. Doch dann kam mir die Liebe zur Mechanik und den Wissenschaften in den Sinn, und ich entschied mich, die Improvisation auf demselben Weg zu erkunden, wie ich eine Uhr auseinandernahm: analytisch. Ich suchte mir eine Phrase aus, die mir gefiel, und hörte die Töne heraus, indem ich sie mir wieder und wieder anhörte – auch wenn ich nur eine Einzelton-Improvisation mit der rechten Hand fand. Danach versuchte ich, über die Melodie hinaus die improvisierten Abschnitte zu hören, um die einzelnen Töne einzugrenzen, die ich für mein Spiel benötigte.
Waren die richtigen Noten erst mal gefunden, spielte ich zu der Aufnahme. Doch am Anfang hatte ich den Eindruck, als gelänge es mir nicht, den einzelnen Tönen den gleichen Charakter zu verleihen, woraufhin ich zur nächsten Phrase überging und danach längere und längere Phrasen lernte, bis ich sie endlich im Einklang mit dem spielen konnte, was ich auf der Platte hörte.
Ich arbeitete weiter, fand neue Phrasen, die ich mochte, und transkribierte sie auf Notenpapier. Damals wusste ich es noch nicht, aber ich absolvierte im Grunde genommen ein Hörtraining, da ich zeitgleich zum Lernen der Abschnitte mein Gespür für die relative Tonhöhe verfeinerte. Ich verbrachte damit dann täglich Stunden, ließ George Shearing hinter mir und beschäftigte mich bald mit anderen Pianisten wie Erroll Garner und Oscar Peterson. Je mehr ich lernte, desto mehr wollte ich lernen!
Aufgrund meiner individuellen Auffassungsgabe erkannte ich Muster schnell. Ich spielte eine Tonfolge, schrieb sie auf und dachte: Warte mal – er hat die Noten doch schon bei einer früheren Phrase des Songs benutzt. Ich wusste nichts über den Aufbau des Jazz, und somit musste ich es mir beim Üben selbst zurechtlegen. Auf mich wirkte die Improvisation wie ein sich dahinziehender Bewusstseinsstrom, was jedoch nicht der Realität entsprach, da sie in einem bestimmten Ausmaß organisiert war.
Trotz der Tatsache, dass ich Klassik gut spielte, war mein Wissen hinsichtlich anderer musikalischer Formen recht begrenzt. Ich kannte zwar Dur- und Mollakkorde, doch musste mir alles andere selbst beibringen, weshalb ich viel Zeit damit verbrachte, mich in der Schule mit anderen Kids zu unterhalten, die auf den Stil abfuhren, darunter Don Goldberg und Ted Harley, der Waldhorn spielte. Die beiden waren gute Musiker. Don wurde später professioneller Komponist und Arrangeur, änderte seinen Namen in Don James und arbeitete bei großen Shows wie der Eiskunstlaufrevue „Ice Capades“ und Baryshnikov On Broadway. Die Gespräche mit Don und Ted halfen mir dabei, mehr über die Theorie und die Struktur der Improvisation zu erfahren.
Werde ich gefragt, wie man das Improvisieren lernt, gebe ich immer denselben Ratschlag, den Don mir damals gab: Finde einen Musiker, den du magst, und kopiere dann seinen oder ihren Stil. Dieser analytische, beinahe mechanische Ansatz wird dir das Erlernen der Grundlagen ermöglichen. Doch nachher besteht die große Kunst darin, nicht im Kopieren stecken zu bleiben, sondern einen eigenen Weg zu finden. Man muss damit beginnen, eigene Melodielinien zu kreieren, die eigene Stimme auszubilden.
Wenn du dir eine bestimmte musikalische Form vornimmst – sagen wir mal einen 32-Takter –, spielst du zuerst die Melodie, quasi den Überbau, und danach improvisiert man zu der speziellen Akkordstruktur. Innerhalb der Struktur besteht viel Freiheit – der Raum, der Rhythmus, die Akkorde sowie die Schattierungen. Egal, was du spielst, was Moment für Moment aus dir herauskommt: Es ist ein Ausdruck, geprägt von einer Kombination verschiedenster Elemente, die auch – falls du mit einer Band Musik machst – die Beiträge der anderen Musiker beinhalten. Da so viel geschieht, muss man höchst präsent sein, und da alles so schnell geschieht, darf man sich nicht durch theoretische Überlegungen bremsen lassen.
Die Improvisation – das Sein im Augenblick – ist eine Art Erkundung des Unbekannten. Sie bedeutet, einen dunklen Raum zu betreten, in dem man nichts erkennt. Es bedeutet, mit dem Erinnerungsvermögen zu arbeiten, bildlich gesprochen einer Art Muskelgedächtnis, und zugleich dem Bauchgefühl freien Lauf zu lassen im Gegensatz zum bewussten Spiel. Damit setze ich mich auch heute noch auseinander: zu lernen, mir selbst aus dem Weg zu gehen! Es ist sicherlich nicht einfach, doch wenn es gelingt, erscheinen diese Augenblicke wie die reinste Magie. Die Improvisation gleicht dem Öffnen einer Schatztruhe, in der alles daraus Entnommene neu ist. Man langweilt sich nie, denn der Inhalt der Truhe variiert jedes Mal.
Jazz ist keine vollkommen zu beherrschende Musik, da der Stil vom Moment abhängt. Jeder Moment ist einzigartig und verlangt vom Musiker, dass er sein tiefstes Inneres ausschöpft. Die klassische Musik erschien mir hochgeistig, wohingegen der Jazz das Geistige und Intuitive vereint. Jazz zog mich wie ein Magnet an, und ich konnte es kaum erwarten, mehr zu lernen.