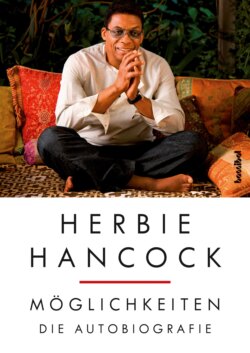Читать книгу Möglichkeiten - Lisa Dickey, Herbie Hancock - Страница 8
ОглавлениеIm Herbst 1956 setzte ich meine Laufbahn auf dem Grinnell College fort. Die Grinnell war eine kleine, hauptsächlich geisteswissenschaftlich geprägte Hochschule in Iowa, was für mich keine naheliegende Wahl bedeutete. Doch eine der engsten Freundinnen meiner Eltern, Mrs. Smith, die auch in der South Side lebte, hatte sie besucht, und so entschied ich mich zur Immatrikulation. Ich gewann ein Pullman-Stipendium und machte mich im Alter von sechzehn Jahren nach Iowa auf. Dort fand ich einen angenehmen und warmherzig anmutenden Campus mit Studenten aus aller Welt vor. Der Besuch der Hyde Park High School hatte meine Augen geöffnet und mich mit Menschen aus den verschiedensten Bereichen in Kontakt gebracht. Die Grinnell aber sollte meinen Horizont noch einmal immens erweitern.
Noch bevor ich auch nur einen Fuß auf den Campus setzte, beschäftigte ich mich analytisch mit meinen Optionen. Sollte ich Musik als Hauptfach studieren? Oder eine Wissenschaft? Ich liebte beides, doch wollte ich eine kluge Entscheidung treffen. Und so fragte ich mich: Wie gut stehen die Chancen, mit Jazz den Lebensunterhalt zu bestreiten? Bedenklich. Und wie stehen die Chancen, mit einem wissenschaftlichen Studiengang das Auskommen zu sichern? Wahrscheinlich sehr gut. So sehr ich Jazz auch liebte, entschied ich mich also für den pragmatischen Weg und somit für das Hauptfach Ingenieurswissenschaften/Elektrotechnik. Ich versprach sogar meiner Mutter, die sich einen „handfesten“ Studienabschluss wünschte, dass ich vom Musikstudium absähe.
Im ersten Jahr trug ich mich nicht für Musikseminare ein, doch nahm Klavierunterricht und verbrachte Stunden mit dem Studium des Jazz. Meine Noten waren eher durchschnittlich, da ich mich im Fach Elektrotechnik nie großartig bemühte. Zwar traf man auf dem College kaum Jazz-Musiker, doch mir begegneten einige außergewöhnlich gute Instrumentalisten, mit denen ich die Zeit beim Spielen und mit Gesprächen verbrachte. Das waren der dänische Drummer Bjarne Nielsen, ein Bassist namens Dave Kelsen und die beiden wirklich guten Trompeter John Scott und Bob Preston. John wurde ein enger Freund, und wir schrieben sogar gemeinsam einen Song, den ich später für mein zweites Album My Point Of View aufnahm.
Einige professionelle klassische Musiker probten acht oder mehr Stunden am Tag, doch das war nichts für mich. Tatsächlich übte ich nie länger als eine Stunde täglich, verbrachte jedoch ungezählte Stunden mit dem Studium, dem Erlernen neuer Musik und dem Analysieren. Ich unterhielt mich scheinbar endlos lange mit den anderen über Strukturen, Theorie und Improvisation, und wir „warfen“ uns die Noten bis tief in die Nacht zu. Ich wurde niemals müde und begeisterte mich zunehmend, je mehr ich lernte.
Auch heute noch fasziniert mich die Improvisation. Höre ich Platten von Oscar Peterson, muss ich immer rätseln: Wie hat er das gerade gemacht? Ich liebte das Spielen verknüpft mit dem Jammen, denn es stellte eine gute Möglichkeit dar, um sich auszudrücken. Man musste nicht die Noten eines anderen lesen, man drückte sich selbst aus, indem man die eigene Musik exakt im Moment erschuf.
Während des zweiten Studienjahrs entschied ich mich zur Organisation des ersten Jazz-Konzerts auf der Grinnell. Das sollte doch nicht schwer sein, oder? Ich würde mir einige Bigband-Aufnahmen anhören, die Noten der anderen Instrumente heraushören und das komplette Arrangement selbst schreiben. Dann musste ich nur noch genügend Musiker für die verschiedenen Parts finden, ihnen die Phrasierungen und die Dynamik beibringen und sie „konzertbereit machen“. In meinem siebzehnjährigen Kopf schien das alles umsetzbar.
Auf der Grinnell gab es nur 1.200 Studenten, und zudem lag die Universität mitten in Iowa. Wo sollte ich also genügend Jazz-Musiker für ein komplettes Konzert finden? In der ganzen Universität befestigte ich Zettel an den schwarzen Brettern und suchte Musiker mit genügend Spielerfahrung, besonders solche, die schon einmal in einer Highschool-Tanzband gewesen waren. Ich wusste, dass die sechzig Meilen östlich der Grinnell gelegene University of Iowa tatsächlich eine Jazz-Band hatte, und so lieh ich mir von ihnen einige Arrangements. Irgendwie gelang es mir letztendlich, fünf Saxofone, drei Posaunen, vier Trompeten, Bass und Schlagzeug und sogar eine kleine Vokalgruppe zusammenzuwürfeln.
Dann versuchte ich, mehr über die Arrangements einiger Count-Basie-Platten zu erfahren, und arbeitete exakt wie bei den George-Shearing-Songs: Ich hörte mir die Musik an und notierte danach die verschiedenen Instrumente. Das stellte sich als kompliziert und zeitraubend heraus, aber ich lernte viel dabei.
Nach der abschließenden Transkription der einzelnen Parts begann ich mit Einzelproben für jedes Instrument des Orchesters. Dabei entdeckte ich, dass zwar alle die einzelnen Töne spielen konnten, doch nur zwei Musiker etwas über Jazz-Phrasierung wussten. Ich wollte mir nicht all die Mühe machen und danach ein mittelmäßiges Konzert abliefern, weshalb ich selbst alle Einzelproben dirigierte – die der Saxofonisten, der Posaunisten und der Trompeter. Da niemand auch nur den blassesten Schimmer von einem Solo hatte, musste ich diese Abschnitte ausnotieren. Ich benötigte das gesamte Semester, um die Musiker zu unterrichten und sie für die Show aufzubauen. Die Vorbereitungen nahmen mich so stark in Anspruch, dass mir keine geistigen Kapazitäten mehr zur Verfügung standen. Somit rasselte ich bei einigen Prüfungen durch.
Es war das zweite Semester des zweiten Universitätsjahres, und das Datum für das Konzert lag knapp vor den Abschlussprüfungen. Als der Tag näherrückte, ging ich gar nicht mehr zu den Vorlesungen – ich hatte einfach viel zu viel zu tun! Ich arbeitete Tag und Nacht mit den Musikern und schlief kaum. Doch als der große Tag anbrach, waren wir bereit. Oder besser gesagt, so bereit, wie wir sein konnten.
Das Konzert fand im Mai 1958 im Alumni Recitation Hall Auditorium statt. Die Zuschauer hatten niemals daran gedacht, in Grinnell, Iowa, ein Jazz-Konzert zu hören. Bedenkt man die niedrig angesetzten Erwartungen, klangen wir fantastisch. Bei jedem Song klatschte und jubelte das Publikum frenetisch. Ich liebte die Bühnenerfahrung der Improvisation mit einer Gruppe von Jazz-Musikern, sich gehen zu lassen, egal welche Richtung ich einschlagen wollte. Der ganze Abend fühlte sich magisch an.
Doch dann kam der eklige Weckruf zurück in die Realität: Ich hatte die Seminare so einschneidend ignoriert, dass die Gefahr wie ein Damoklesschwert über mir schwebte, von der Uni geworfen zu werden, würde ich nicht die Abschlussprüfung mit akzeptablen Noten bestehen. In der nächsten Woche „prügelte“ ich mir alles in den Schädel. Als ich bei den Prüfungen auftauchte, schienen einige Professoren, die mich schon seit Wochen nicht mehr gesehen hatten, erstaunt zu sein. Meine Eltern wären bei einem Versagen wie am Boden zerstört gewesen, und so versuchte ich verzweifelt, zumindest so gute Resultate abzuliefern, dass ich weiterstudieren durfte.
Und irgendwie gelang mir das. Ich bestand alle Abschlussprüfungen, womit ich das Semester mit dreimal Note „gut“ und einem „befriedigend“ abschloss. Ein Professor zeigte sich davon so verblüfft, dass er glaubte, ich hätte geschummelt. Er bestellte mich in sein Büro und wollte nachdrücklich wissen, wie mir die guten Abschlüsse gelungen seien, da ich doch fast das gesamte Semester gefehlt hätte. Er begann mich mit Fragen zu löchern und wollte prüfen, ob ich den Lernstoff tatsächlich nachweisen konnte. Ich war zum Glück in der Lage, ihm die Antworten zu liefern, weshalb er schließlich nachgeben musste.
Danach zog ich mich völlig erschöpft in meine Studentenbude zurück und starrte in den Spiegel. Ich sah verdammt schlecht aus, hatte blutunterlaufene Augen. „Was willst du werden?“, fragte ich das Gesicht im Spiegel. Ich versuchte mein Möglichstes, um mich dem Studiengang Elektrotechnik anzupassen, doch es lag auf der Hand, wohin mich die Leidenschaft zog. Zu dem Zeitpunkt gab es keine Wahlmöglichkeit mehr. Und so entschied ich mich an dem Tag für das Hauptfach Musik.
Als ich die Einführungskurse des ersten Jahres besuchte, war ich erleichtert, schon beinahe den gesamten Lernstoff draufzuhaben. Ich hatte schon so viel Zeit mit den Themen Theorie, Harmonie und Struktur verbracht, dass ich die Seminare übersprang und nur zur Abschlussprüfung erschien.
Um mir etwas zusätzliches Geld zu verdienen, jobbte ich in der Mensa des Studentenwerks, nahm Bestellungen entgegen und bediente die Gäste. An einem Wochenende hatte ich einen Gig als Pianist in Des Moines und war regelrecht geschockt, als ich herausfand, dass ich für den einen Abend mehr erhielt als für eine Woche in der Mensa. Die Erkenntnis verwirrte mich: die Vorstellung, all die langen Stunden Essen durch ein Restaurant zu schleppen, wenn ich doch so viel mehr bei einer Tätigkeit verdienen konnte, die ich liebte. Von dem Moment an war es mir unmöglich, in der Mensa zu arbeiten, und ich schmiss den Job.
Der Trip nach Des Moines stellte sich jedoch nicht als so angenehm heraus, was wie eine Ironie des Schicksals anmutete. Der Gig lief gut, doch danach geschah etwas Merkwürdiges: Ich war damals achtzehn Jahre alt, doch die in dem Nachtclub spielenden Typen hatten schon von mir gehört. Ich erklärte mich bereit, mit ihnen in Des Moines aufzutreten, plante aber schon, in den frühen Morgenstunden zur Grinnell zurückkehren, um das Geld für ein Hotelzimmer zu sparen. Einer der Musiker bot mir jedoch an, in dem Haus zu übernachten, das er und seine Frau bewohnten. Ich dachte: Cool! Ein kleines Abenteuer! Der Typ war ein waschechter Profimusiker, und ich würde bei ihm abhängen.
Der Gig endete um etwa zwei Uhr morgens. Als ich mit ihm zum Wagen ging, meinte er: „Ich muss noch einige Male einen Zwischenstopp einlegen, bevor ich nach Hause fahre.“ Ich antwortete: „Das stört mich nicht.“ Mir war es egal, wohin es ging, denn ich freute mich über die gemeinsame Fahrt.
Beim Wagen warteten noch einige andere Leute, und wir quetschten uns ins Auto. Der Typ fuhr vom Parkplatz los, und schon kurz darauf stoppten wir vor einem Haus. Sobald wir die Auffahrt hochfuhren, gingen alle Lichter in dem Gebäude an. Ich fand das ein wenig seltsam – warteten die etwa auf uns? Jemand sprang aus dem Auto, hastete zur Vordertür und kam mit einer kleinen Papiertasche zurück. Danach ging es zu einem anderen Haus, wo wir die Frau des Musikers abholten. Ich bemerkte voller Verwirrung, dass sie zitterte, obwohl es draußen noch sehr warm war.
Wir hielten noch einige Male an, um Mitfahrer abzusetzen, und dann saßen nur noch der Musiker, seine Frau und ich in dem Gefährt. Er fuhr zu seinem Haus, und wir gingen über eine Hintertreppe in das Gebäude. Als er die Tür öffnete, klappte meine Kinnlade runter: Es war ein winzig kleiner Raum mit nur einem Bett. Der Typ und seine Frau legten sich hin und winkten, ich solle mich zu ihnen gesellen.
„Willst du high werden?“, fragte er mich, dabei den Inhalt der Papiertüte über die Matratze ausbreitend. Ich schaute auf die herausgefallene Injektionsnadel und das kleine Tütchen mit Pulver und antwortete: „Nein, vielen Dank.“ Ich war zuvor noch nie von irgendeiner Substanz high gewesen und hatte auch nicht vor, mich von dem Zeug abhängig zu machen. Doch ich war neugierig und fragte: „Kann ich dabei zusehen?“ Wenn ich schon mal hier war, wollte ich auch wissen, wie man so was macht.
Ich beobachtete ihn, wie er das Pulver vorsichtig in einen Löffel mit ein wenig Wasser schüttete, das Feuerzeug anmachte und dann die Unterseite erhitzte. Das Pulver verwandelte sich in eine schwarze Flüssigkeit, die er in die Spritze füllte. Er band seinen Arm mit einem Plastikschlauch ab, klopfte auf die Vene, so wie man es im Kino sah, und setzte sich den Schuss. Seine Frau zitterte, weil sie von einem High runterkam, doch als er ihr die Spritze anbot, griff sie zu. Ich konnte kaum glauben, dass ich hier saß und sie beim Fixen beobachtete, ihre Gesichter musterte, um eine Veränderung zu erkennen, und wurde zunehmend nervös. Würden sie auf komische Gedanken kommen?
Offensichtlich hielten sie nicht viel vom dem Stoff, denn nach einiger Meckerei meinte der Typ: „Wir werden jetzt schlafen.“ Ich dachte: Okay, und wo zum Teufel soll ich pennen?
Schließlich lag ich auf der einen Seite des Betts, der Typ in der Mitte und seine Frau auf der anderen. Ich glaube, ich war so nervös, dass ich die ganze Nacht kein Auge zutat. Sie schienen mir nicht besonders high zu sein, doch ich hatte bislang keinen Kontakt zu Junkies gehabt. Was wusste ich schon? Was härtere Drogen anbelangte, war ich ein Novize, obwohl ich kürzlich mit dem Trinken begonnen hatte. Ich empfand das hier als eine mir unbekannte Welt. Bislang hatten mich Drogen nicht angezogen, doch das sollte sich noch ändern.
1960 verließ ich die Grinnell und kehrte nach Chicago zurück, nur eine Prüfung von einem regulären Abschluss entfernt, denn ich war in meinem ersten Jahr bei einem Seminar durchgefallen. Ich wollte den Abschluss, doch ich brannte für den Jazz, für das ernsthafte Spielen, und die Grinnell war sicherlich nicht der Ort dafür.
Ich zog zurück zu meinen Eltern und nahm während der Suche nach Arbeit für einen Pianisten einen Job bei der Post an. Meine Aufgabe bestand darin, fünfmal täglich Post zuzustellen, und wenn ich Gigs hatte, machte ich von einundzwanzig Uhr bis vier oder fünf Uhr am Morgen Musik. Die Arbeitszeiten stellten sich als brutal heraus, denn mir blieb fast keine Zeit für Schlaf. Meist musste ich noch den Zug zu und von den Gigs nehmen. Im „L“ sackte ich vor Erschöpfung zusammen, während er in den frühen Morgenstunden an der South Side entlangratterte.
Doch ich brauchte den Job bei der Post, denn ich verdiente noch nicht genügend mit den Auftritten. Und so trug ich im Herbst 1960 immer noch Briefe aus, als mich ein Anruf von Coleman Hawkins erreichte. Hawkins war ein legendärer Saxofonist, der Mann, der das Sax im Jazz popularisierte und an die „vorderste Front“ brachte. Er spielte schon seit den frühen Zwanzigern, als er seine Karriere mit Mamie Smith’s Jazz Hounds begonnen hatte. In den darauffolgenden vier Jahrzehnten war er mit all den großen Namen aufgetreten: Louis Armstrong, Django Reinhardt, Miles Davis, Benny Goodman, Thelonious Monk und Oscar Peterson. Meine Güte, ich wäre schon aufgeregt gewesen, mich mit Coleman Hawkins nur im selben Raum zu befinden, ganz zu schweigen davon, tatsächlich mit ihm zu spielen.
Um seine Kosten so gering wie möglich zu halten, arbeitete Hawkins meist mit Spontan-Besetzungen, was bedeutete, dass er lokale Musiker engagierte – einen Pianisten, einen Drummer und einen Basser –, und das in jeder Stadt, in der er auftrat. Für den Gig in Chicago war der Pianist erster Wahl – ein Typ namens Jodie Christian – nicht verfügbar, woraufhin Hawkins’ Schlagzeuger Louis Taylor vorschlug, es mal mit mir zu versuchen. Damals war ich noch ziemlich grün hinter den Ohren, hatte aber schon einige Male mit Taylor gespielt, der meinte, ich verdiene die Chance.
Coleman holte mich für ein vierzehntägiges Engagement im Cloisters-Nachtclub ins Boot. Er war der erste international bekannte Musiker, mit dem ich arbeitete. Sein Saxofon-Solo auf der Aufnahme von „Body And Soul“ wurde als die ultimative Interpretation des Klassikers angesehen. Ich fühlte mich geehrt, die Bühne mit ihm zu teilen, und war gespannt auf das, was ich von ihm lernen konnte. Doch ich zeigte mich auch nervös und hoffte, den Ansprüchen gerecht zu werden. Coleman ermutigte mich und versuchte, mir ein angenehmes Bühnen-Feeling zu bereiten, und ich glaube, dass er mit meinem Stil zufrieden war.
Allerdings bot sich mir nie die Chance, mich ausführlich mit ihm zu unterhalten, da ich immer nach dem letzten Set nach Hause hetzen musste. Die Auftrittszeiten lassen sich als total verrückt beschreiben – jede Nacht vier Sets und fünf am Samstag, ohne einen einzigen freien Tag. Und so spielte ich bis in die frühen Morgenstunden und versuchte dann den ganzen Tag, die Post auszutragen. Schon am dritten Tag war ich ein komplettes Wrack. An dem Morgen stand ich vor einer Apartmenttür, blätterte durch die Briefe und fühlte mich, als würde ich im Stehen einschlafen – was sicherlich nicht gut war, denn das Apartment lag am Ende einer hohen Betontreppe. Ich quälte mich, lag hinter der Zeit, und dann wurde mir auch noch übel – was wohl niemanden überrascht.
Louis Taylor, der Drummer, der mir den Gig beschafft hatte, riet mir: „Herbie, der Job bei der Post kommt deiner Musik in die Quere. Du musst da aufhören.“ Ich erkannte, dass es keinen Weg gab, beide Tätigkeiten miteinander in Einklang zu bringen, doch ich hatte Angst, bei der Post zu kündigen, da mir der Job Stabilität und ein regelmäßiges Einkommen garantierte.
Doch am vierten Tag, nachdem ich um vier Uhr regelrecht nach Hause kroch, wusste ich, dass mir keine Wahl blieb. An dem Morgen erzählte ich den Kollegen bei der Post von der beabsichtigten Kündigung. Viele von ihnen – selbst Musiker – rieten mir dringlichst davon ab. Man ermahnte mich zur Vorsicht: „Mann, du wirst deine Krankenversicherung verlieren!“ Ich wusste, wenn ich kündigte, würde man mich nicht wieder einstellen, falls es mit der Musik nicht funktionierte. Doch ich musste das Risiko eingehen, und so betrat ich das Büro meines Vorgesetzten und erklärte ihm, dass ich hier fertig sei.
Nach Ende des zweiwöchigen Engagements bei Coleman Hawkins saß ich dann neben dem Telefon und hoffte auf ein Angebot für einen weiteren Job. Ohne reguläre Arbeit fühlte ich mich seltsam. Zudem war ich nicht sicher, als Pianist genügend zu verdienen. Doch meine Eltern kümmerten sich um mich, ließen mich mietfrei wohnen und fütterten mich mit einem täglichen Abendessen durch. Ich konnte mich ihrer Unterstützung glücklich schätzen, während ich an der Verwirklichung des Traums arbeitete, irgendwann einmal ein professioneller Jazz-Musiker zu sein.
Im Dezember 1960, einige Monate nach der Coleman-Episode, rief mich John Cort an, der Besitzer des Birdhouse, eines winzigen Clubs im zweiten Stock eines Gebäudes an der Dearborn Street in der North Side, den man nur über eine steile Treppe erreichte. „Donald Byrd und Pepper Adams spielen nächstes Wochenende in Milwaukee“, verriet er mir. „Willst du mit ihnen auftreten?“
„Du nimmst mich wohl auf den Arm?“, antwortete ich, ohne zu zögern. „Yeah, natürlich will ich mit ihnen spielen.“ Ich konnte es nicht glauben – gerade hatte man mich zu einem Gig mit einem der weltbesten Jazz-Trompeter eingeladen. Donald Byrd war ein „Veteran“ von Art Blakey’s Jazz Messengers und hatte sogar einen Master an der Manhattan School of Music gemacht. Über die Jahre war er mit zahlreichen Jazz-Größen aufgetreten, darunter John Coltrane und Thelonious Monk, worauf er 1958 mit dem Bariton-Saxer Pepper Adams ein Quintett gründete. Und das war exakt die Gruppe, zu der man mich einlud.
„Tja“, meinte John, „dann zieh dir dein kastanienbraunes Jackett an und komm mal rüber!“ Ich hatte schon gelegentlich in seinem Club gespielt, und so kannte er auch mein Jackett – das einzige Jackett, das ich für Auftritte besaß. Ich machte mich so schnell wie möglich auf den Weg ins Birdhouse.
Wie sich herausstellte, hatte Donald ursprünglich einen anderen Pianisten engagiert, doch ein Blizzard zog über den Südwesten hinweg, und der Musiker war sprichwörtlich gestrandet. Sie brauchten mich also nur als Ersatz für den Wochenend-Gig im Curro’s in Milwaukee, und ich sollte am anschließenden Montag wieder abgelöst werden. Ich traf Donald, Pepper und die anderen Kollegen im Birdhouse, woraufhin wir alle runtergingen und uns für die Fahrt in den Wagen quetschten. Mittlerweile hatte sich der Blizzard in einen unheimlich heulenden Orkan verwandelt. Wir kamen nicht weit, bis allen klar wurde, dass wir es nicht mehr rechtzeitig zum Gig in Milwaukee schaffen würden.
Ich war zutiefst enttäuscht, aber dann fragte Donald: „Sind heute nicht einige Jam-Sessions in Chicago? Vielleicht können wir dich wenigstens mal spielen hören.“ Ich wusste von einer lockeren Session mit dem Leader, Trompeter und Saxofonisten Ira Sullivan und erklärte Donald die grobe Richtung. So machten wir uns denn auf den Weg. Als wir im Club ankamen, dachte ich nur noch: Herbie, vermassle das nicht! Das war meine große Chance, eine Art Vorspielen für den schick gekleideten, hochgebildeten Donald Byrd, einen wirklich sympathischen Menschen. Ich wollte ihn unbedingt beeindrucken, so sehr, dass meine Hände zitterten, als ich an der Reihe war, die Bühne zu betreten, um mich zu den Musikern zu gesellen.
Ich schätze mal, dass das Zittern nicht aufhörte, denn ich klang schrecklich. Die Nervosität hatte mich fest im Griff, und ich konnte nichts richtig spielen. Nachdem ich mich durch eine Nummer gequält hatte, wusste ich, dass ich erledigt war. Ich schlich mit hängenden Schultern von der Bühne und ging mit gesenktem Kopf an den Tisch, an dem die anderen saßen.
Ich drehte mich zu Donald und sagte: „Ich möchte dir dafür danken. Ich weiß, dass du mich jetzt nicht mehr haben willst, aber ich schätze es sehr, dass du mir die Chance gegeben hast.“ Donald begann zu lachen und klopfte mir auf den Rücken. „Na los, Herbie! Wir werden dich morgen mit nach Milwaukee nehmen. Ich habe gespürt, dass du nervös warst – mach dir da mal keine Sorgen.“ Erleichterung durchströmte meinen ganzen Körper. Ich hatte es also doch nicht vermasselt und immer noch eine Gelegenheit, Donald zu beweisen, was ich wirklich konnte.
Am nächsten Tag fuhren wir nach Milwaukee, und ich spielte an dem Abend wesentlich besser als bei der Jam-Session. Doch ein Song bereitete mir Probleme – ein Jazz-Standard aus den Dreißigern mit dem Titel „Cherokee“. Ich kannte die Akkord-Struktur, doch Donalds Quintett spielte die Nummer recht schnell. Bei Balladen und Songs mittlerer Tempi schlug ich mich recht gut, doch ich hatte bei den Soli schnellerer Stücke zu kämpfen.
Nach dem Gig entschied ich mich, Donald darauf anzusprechen. „Ich weiß, dass ich mit ‚Cherokee‘ nicht so gut klargekommen bin. Ich hatte bei schnelleren Tempi schon immer Probleme. Hast du vielleicht einige Tipps, die mir weiterhelfen?“
„Vor langer Zeit gab mir Barry Harris einen Ratschlag“, meinte Donald, sich dabei auf einen Pianisten aus seiner Heimatstadt Detroit beziehend. „Er sagte: ‚Der Grund, dass du nicht schnell spielen kannst, liegt darin, dass du dich noch nie gehört hast, wenn du schnell spielst.‘“ Und dann erläuterte er mir exakt Barrys Vorgehensweise, das Problem aus der Welt zu schaffen.
Laut Barry sollte man mit einer bestimmten Form anfangen – entweder einem zwölftaktigen Blues oder einem Rhythmus-Pattern (basierend auf den Akkorden von Gershwins „I Got Rhythm“), die man als die einzigen wahren traditionellen Muster im Jazz einstufen kann. Danach machte man sich an die kompletten Durchgänge: Ist es eine Blues-Form, notiert man die zwölftaktige Struktur und ein improvisiertes Soli darüber – in der Länge einiger Durchgänge. Hat man die komplette Struktur ausnotiert, übt man die aufgeschriebenen Noten, spielt sie immer wieder und dann immer schneller.
Am nächsten Tag befolgte ich Donalds Anweisungen. Ich machte mir keine allzu großen Gedanken, den ausnotierten Part exakt wiederzugeben, denn es war wichtiger, ihn schneller zu spielen und dabei zuzuhören, mich daran zu gewöhnen. Am Abend des zweiten Gigs in Milwaukee sagte Donald „Cherokee“ an und brachte den Song deutlich zügiger. Es war das erste Mal, dass ich ein gutes Solo bei einem schnellen Song spielen konnte, und das Gefühl, wie meine Finger über die Tasten sausten, beeindruckte mich selbst.
Nach dem Auftritt unterhielten Donald und ich uns erneut. Er wusste, dass ich noch viel lernen musste. Offensichtlich hatte er gemerkt, wie ernst ich seinen Ratschlag nahm, denn er meinte: „Herbie, ich habe es mit der Band schon abgesprochen. Wir mögen deinen Stil und wollen, dass du einsteigst.“
„Ihr habt doch einen Pianisten“, entgegnete ich verwirrt.
„Wir werden ihn feuern“, informierte er mich. „Wir wollen dich. Aber du musst nach New York umziehen. Was hältst du davon?“
Natürlich wollte ich, denn New York war das Zentrum des Jazz, die Stadt, in der die großen Chancen an jeder Ecke warteten. Chicago hingegen ließ sich als großartige, aber nicht impulsgebende Jazz-Stadt beschreiben, mit beeindruckenden Pianisten wie Ahmad Jamal und Ramsey Lewis. Ich hatte schon immer das Gefühl gehabt, dass meine Heimatstadt nur ein Sprungbrett auf dem Weg nach New York darstellte, wo es richtig abging. Allerdings hätte ich mir niemals vorstellen können, den Absprung so schnell anzuvisieren.
„Das würde ich gerne“, erklärte ich Donald. „Doch du musst zuerst meine Mutter fragen.“ Obwohl ich schon zwanzig war, fällte Mom immer noch die Entscheidungen in der Familie. Mein ganzes Leben hatte ich Vater sagen gehört: „Geh und frag deine Mutter.“ Und nun lag eine so bedeutende Chance vor mir, dass ich es als falsch empfunden hätte, den Entschluss ohne sie zu treffen.
Donald lächelte nur und antwortete: „Natürlich.“ Am nächsten Tag rief er Mom vom Club aus an und bat um die Erlaubnis, ihren jüngsten Sohn mit nach New York City zu nehmen, damit er in seiner Band spielte.
Meine Eltern sagten, sie würden alle ihre Kinder unterstützen, egal, was sie auch machen wollten, doch Mom war sich bei dieser Entscheidung nicht sicher. Sie drückte gegenüber Donald ihre Bedenken aus, was mein Alter und meine Sicherheit in der Metropole anbelangte, und Donald – schon „ganze“ achtundzwanzig Jahre alt – ging in seinem unnachahmlichen Stil darauf ein: „Haben Sie keine Angst! Ich werde mich persönlich um Herbie kümmern und darauf achten, dass es ihm gutgeht.“
Damit hatten sich weitere Gespräche erledigt, und nur weniger als einen Monat später – im Januar 1961 – unternahm ich meine erste Flugreise von Chicagos Midway Airport nach New Yorks Idlewild. Ich kam mit drei Taschen und einigen hundert Dollar in der Tasche an und stieg in den Bus nach Manhattan ein, um ein neues Leben zu beginnen.