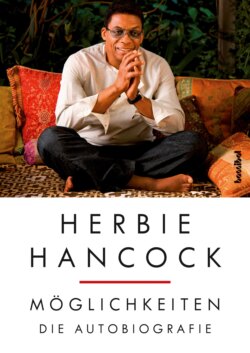Читать книгу Möglichkeiten - Lisa Dickey, Herbie Hancock - Страница 9
ОглавлениеWährend der Busfahrt nach Manhattan starrte ich ununterbrochen auf die vielen Wolkenkratzer. Obwohl in Chicago aufgewachsen, hatte ich kaum Zeit im Stadtzentrum verbracht, und in der South Side oder nahe der Hyde Park gab es keine riesigen Gebäudetürme, was mich hier so neugierig wie einen Touristen machte. Ich konnte nicht glauben, tatsächlich in New York City – dem Mekka des Jazz – und zum ersten Mal allein auf mich gestellt zu sein.
Ich stieg in Midtown Manhattan aus, nicht weit vom Times Square entfernt, und wuchtete die drei vollgestopften Taschen auf den Randstein. Damals hatten Reisetaschen noch nicht diese kleinen Rädchen, und so musste ich sie entweder zu meiner neuen Behausung tragen oder schleifen: dem Alvin Hotel an der 52nd Street zwischen dem Broadway und der Eight Avenue. Das Alvin gehörte zu den billigen Hotels, und ich hatte gehört, dass dort viele Musiker lebten. Es lag nur eine Ecke vom Birdland entfernt, dem Ort, wo ich sein wollte.
Das Birdland war der legendäre Jazz-Club, der seit 1949 all die Großen angezogen hatte. An der Fassade hing ein Schild mit der Aufschrift THE JAZZ CORNER OF THE WORLD, was man förmlich spürte. Dort waren bislang regelmäßig Musiker wie Count Basie aufgetreten, Charlie Parker, John Coltrane, Stan Getz und Art Blakey. Auch Miles Davis zählte zu den häufig gesehenen Gästen, obwohl die Polizei ihn nur fünf Monate zuvor vor dem Clubs für das „Verbrechen“ verprügelt hatte, eine weiße Frau zum Auto zu begleiten. Das Birdland war der heißeste Laden, dort, wo es richtig abging, und „Lullaby Of Birdland“, der George-Shearing-Song und zugleich eine der besten Jazz-Nummern, die ich zu kopieren versuchte, war nach dem Club benannt. Ich empfand es also als durchaus passend, meine ersten Nächte in New York im Schatten dieses großartigen Veranstaltungsorts zu verbringen.
Natürlich konnte ich mir einen Hotelaufenthalt nicht lange leisten – auch nicht einen billigen –, und als mich Donalds Bassist Laymon Jackson fragte, ob ich mir mit ihm ein Apartment teilen wolle, willigte ich unverzüglich ein. Wir fanden ein dreckiges, billiges Apartment in der baufälligen West Side, eine nur über eine Treppe zu erreichende winzige Behausung ohne Möbel, aber mit vielen Kakerlaken. Es gab nur ein Bett – eine auf dem Boden liegende Matratze –, die sich Laymon und ich teilten. Uns stand nicht genügend Geld zur Anschaffung einer zweiten zur Verfügung, auch wenn das Zimmer groß genug gewesen wäre. Allerdings fanden wir einige Stühle auf der Straße, womit jeder wenigstens eine Sitzgelegenheit hatte.
Die ersten Wochen in New York waren hart. Bevor ich dort hinzog, hatte ich überhaupt keine Vorstellung, wie das Leben von New Yorker Musikern ablief. Ich wusste, dass Donald eine erfolgreiche Jazz-Karriere verfolgte und dass sich seine Platten auf der ganzen Welt verkauften. Als fester Musiker in seinem Quintett würden wir doch sicherlich viel Geld verdienen? Doch schon bald fand ich heraus, dass sich die Realität grundlegend von meiner Einschätzung unterschied. Wir spielten weniger Gigs als erwartet und erhielten weniger Gage. Laymon und ich teilten uns das billigste Apartment, das man finden konnte, in der Nachbarschaft von Schwarzen und Hispanics, und sogar das war beinahe unerschwinglich.
Im Laufe der Zeit lernten wir ein Handvoll anderer Musiker in der Nachbarschaft kennen, darunter einen Vibrafonisten namens Jinx Jingles und seine Frau, eine Sängerin, die meist auch pleite waren. Am härtesten empfand ich einen Moment, ungefähr einen Monat nach Ankunft in der Stadt, in dem ich meine Taschen leerte und nur noch zwölf Cents fand. Doch wir achteten aufeinander, kratzten eines Nachmittags unser Geld zusammen und kauften für etwas mehr als einen Dollar einen Laib Wonder Bread, eine Tomate, einen Suppenknochen und etwas Mehl. Jinxs Frau kochte die Suppe, in die wir das Brot eintunkten. Ich war so hungrig, dass ich es als absolut köstlich empfand.
Alle paar Wochen rief ich meine Eltern an. Ich erzählte ihnen nichts von den miserablen Seiten des Lebens, doch sie schienen es zu spüren. „Willst du nicht nach Hause kommen?“, fragte Mom immer, was ich natürlich verneinte. Ich bin mir sicher, dass sie mir Geld geschickt hätten, hätte ich nur gefragt, doch ich war fest entschlossen, es allein zu schaffen. Mir war mein Stolz sehr wichtig.
Mein erster Gig mit Donald Byrds Formation fand im Five Spot statt, einem Club im Kabarett-Stil am Cooper Square in der Bowery. Seit der Eröffnung 1956 hatte sich der Laden zu einem Magneten für Künstler und Schriftsteller wie Allen Ginsberg, Jack Kerouac und Willem de Kooning gemausert sowie berührten Musikern wie Thelonious Monk und später Joni Mitchell. Vor dem Auftritt führte Donald noch ein kleines „Aufklärungsgespräch“ mit mir. „Hör mal, Herbie“, begann er. „Wenn wir im Five Spot spielen, werden sich dort auch andere Pianisten aufhalten, Musiker, deren Platten du liebst.“ Er meinte, möglicherweise kämen Horace Silver oder Bill Evans. Wenn ich sie im Publikum sähe, aufgereiht wie eine Jury, die über den „Neuen“ richtet, solle ich versuchen, jegliche Bedenken wegzustecken. „Werde nicht nervös, okay?“ Nein, überhaupt kein Druck.
Natürlich war ich nervös. Aber irgendwie habe ich den Auftritt wohl gut gemeistert, denn ich erhielt danach Anrufe anderer Musiker, die mich für Gigs engagierten. Jeder wusste, dass ich Donalds Pianist war, doch das Quintett arbeitete nicht immer, womit mir Zeit für zusätzliche Auftritte blieb und sogar Aufnahme-Sessions mit Jackie McLean, Kenny Dorham und Lou Donaldson. Nachdem der Stein einmal ins Rollen gekommen war, stand mir zu meiner großen Erleichterung ein eher akzeptables Einkommen zur Verfügung.
Eines Nachmittags kurz nach dem Five-Spot-Gig fuhr Donald von der Bronx zu meiner Bude in der 84th Street, um mich zu besuchen. Er kam in einem Jaguar angesaust, seine Freundin auf dem Beifahrersitz, und ich dachte: Okay, Donald scheint wohl recht gut zu verdienen! Er parkte den Schlitten und besuchte mich im Apartment. Nach einem prüfenden Rundumblick meinte er: „Herbie, du musst hier raus. Ich hole dich in die Bronx. Du kannst bei mir einziehen.“
Ich konnte mir ungefähr vorstellen, in was für einem Luxus Donald lebte, und so nahm sich das Angebot dankend an. Doch als ich wenige Tage später in sein Apartment einzog – nachdem ich meine Habseligkeiten fünf Etagen hochgeschleppt hatte –, war ich erstaunt, dass die Wohnung nur über ein Schlafzimmer verfügte. Im Wohnzimmer gab es ein versenkbares Klappbett, und dort sollte ich nächtigen. Der Jaguar gehörte übrigens nicht ihm, sondern seiner Freundin, die er jedoch nie fahren ließ.
Donald stellte drei Regeln für das Apartment auf. Erstens: Alles musste penibel sauber sein, um das Heer der Kakerlaken zu dezimieren. Zweitens: Ich musste jeden Morgen mein Bett machen. Drittens: Falls jemand vor neun Uhr klingeln sollte, musste ich ihn zuerst wecken, bevor ich an die Tür ging.
Ich hatte keine Vorstellung, aus welchem Grund die dritte Regel aufgestellt worden war. Eines Morgens fand ich es heraus. Die Klingel läutete vor neun Uhr, und ich ging in Donalds Schlafzimmer, um ihn zu wecken. Er war ziemlich groggy, sprang aber geschmeidig aus dem Bett, riss das Fenster auf und stieg auf die Feuerleiter. Als ich die Tür öffnete, stand ein Vollzugsbeamter des Finanzamts dort, der sich mit Donald unterhalten wollte – als hätte er es geahnt! Ich schätze mal, Donald hatte seit geraumer Zeit keine Steuern entrichtet, aber solange er den Finanzschnüfflern aus dem Weg gehen konnte, war er ihnen natürlich immer eine Länge voraus.
Donald hatte meinen Eltern versprochen, sich um mich zu kümmern, und er hielt sein Versprechen. Doch er war ein Freigeist, und die Feststellung ist durchaus berechtigt, dass sich seine Art der Fürsorge von der meiner Eltern unterschied. Kurz nach dem Einzug führte er mich in die Welt des Marihuanas ein. Wir fuhren zu einem Gig – irgendwo im Mittleren Westen, möglicherweise Detroit –, und ich kann mich nur noch daran erinnern, die ganze Nacht gelacht zu haben. Das erste Mal war großartig, doch letztendlich mochte ich das Kiffen nicht. Ich stand weder darauf, mich von der Realität zu entfernen, noch mochte ich die Art, wie das Kiffen manchmal meine Stimmung runterzog, und das Gefühl der Paranoia gefiel mir schon gar nicht. Ich bin eher ein „High-Energy“-Mensch, womit sich Marihuana als Droge für mich erledigte. Ich mochte jedoch das Trinken und entwickelte eine hohe Toleranz demgegenüber. Im ersten Jahr in New York blieb ich aber meist nüchtern und hielt mich zurück.
Ende 1961 hatte ich schon auf meinen ersten beiden Platten gespielt: Donald Byrds Royal Flush und Out Of This World von Donalds und Peppers Quintett. Für die Aufnahme von Royal Flush wählte Donald sogar eine meiner Kompositionen aus, ein Song mit dem Titel „Requiem“. Damals hatte ich keine große Erfahrung hinsichtlich des Songwritings. Als Kinder hatten Wayman, Jean und ich uns ein Stück mit dem Titel „A Summer In The Country“ einfallen lassen, und auf der Grinnell schrieb ich auch einige Nummern. In Chicago half ich bei den Kompositionen anderer Musiker, die nicht viel vom harmonischen Hintergrund wussten, was mich ein bisschen Erfahrung sammeln ließ. Ich wollte aber mehr komponieren. Als Donald mir von seinen Absichten berichtete, ein neues Album einzuspielen, schrieb ich „Requiem“ in der Hoffnung, dass er es für die Scheibe auswählen würde.
Es schien ein recht viel versprechender Start gewesen zu sein, auf diesen Platten zu spielen und meine Songs aufzunehmen. Doch ein Jahr, nachdem ich in New York angekommen war, arbeitete ich immer noch nicht so viel wie erwartet. Daraufhin fällte ich im Januar 1962 die Entscheidung, mich in der Manhattan School of Musik einzuschreiben. Statt tatenlos herumzusitzen, vertiefte ich meine Ausbildung, weshalb ich mich für Seminare in klassischer Komposition und Orchestrierung anmeldete.
Donald hatte seinen Master an diesem Institut gemacht. Gelegentlich schaute er vorbei, um sich mit mir zum Lunch zu treffen. Eines Tages kam er in die Mensa und sah den ihm bekannten Pianisten Larry Willis. Er stellte uns vor, und Larry starrte mich an: „Du bist der Herbie Hancock?“ Ich lachte, mir nicht sicher, ob er mich auf den Arm nehmen wollte. Larry hatte allerdings noch nie Platten aufgenommen, und ich hingegen schon ganze zwei (!) Scheiben, womit ich mir im Alter von nur einundzwanzig Jahren schon einen gewissen Ruf in New York erarbeitet zu haben schien.
Nach der Immatrikulation und der Bezahlung der Seminare – und das war wirklich ironisch – wurde ich von Anfragen überhäuft, so dass ich das Semester nicht beenden konnte. In dem Winter absolvierte ich unzählige Auftritte, darunter eine Performance im Birdland im Januar mit dem Posaunisten Al Grey, die man für das Album Snap Your Fingers mitschnitt. Nun entschied Donald, dass der nächste Schritt erfolgen musste.
„Herbie, es ist Zeit für deine eigene Platte.“
„Nein“, erwiderte ich. „Ich bin noch nicht bereit.“
„Doch, das bist du“, bekräftigte er seine Aussage. „Und ich werde dir erklären, wie man das anpackt.“
Donald stand bei Blue Note unter Vertrag, dem Top-Jazz-Label, das sich damit rühmte, Platten der „jungen Wilden“ des Jazz zu veröffentlichen – der heißen Musiker, die gerade ihre Karriere begannen. Freddie Hubbard, Wayne Shorter und Horace Silver waren alle bei Blue Note, und ihre Karrieren entwickelten sich steil nach oben. Doch es gab einen Haken: Die Verantwortlichen von Blue Note wollten einen jungen Künstler erst dann vertraglich verpflichten, wenn sie genau wussten, dass er Alben verkaufen konnte. Das ließ sich mit dem alten „Huhn-und-Ei“-Dilemma vergleichen, denn niemand stimmte einer Plattenproduktion zu, bis man bewiesen hatte, dass man auch genügend Platten absetzte.
Doch Donald hatte einen Plan ausgeheckt. Er riet mir: „Du musst Folgendes machen. Geh zu Alfred Lion“ – einem der Mitbegründer von Blue Note – „und erzähl ihm, sie hätten dich eingezogen.“ Es war die kurze Zeit zwischen dem Korea- und dem Vietnamkrieg. Obwohl die USA nirgendwo kämpften, nahm die Rekrutierung ihren gewohnten Lauf. „Sag ihm, dass du eine Platte machen willst, bevor du zur Armee gehst. Das ist der erste wichtige Punkt“, erklärte Donald.
„Zweitens: Die eine Hälfte des Albums kannst du für dich aufnehmen, die andere musst du für Blue Note einspielen.“ Ich wusste nicht, was das bedeuten sollte, woraufhin er seine Erklärung fortsetzte. Die Hälfte der Titel durften Eigenkompositionen sein, doch ich sollte mich darauf vorbereiten, mindestens genauso viele Versionen von Standards aufzunehmen. „Du musst was machen, das die Leute kennen“, setzte Donald seine Unterweisung fort. „Denn nur so verkauft man Platten. So läuft das Business eben, Herbie.“
Ich dachte einige Tage über Donalds Ratschläge nach, besonders über die Tipps zu den eigenen Songs. Ich mochte das Spielen von Standards wie jeder andere auch, doch mit der Komposition von eigenen Stücken wollte ich die Hörer packen. Komponisten wie Horace Silver hatten Stücke geschrieben, die sich verkaufen ließen. Seine heißen, funky Nummern gingen dabei am besten. Konnte ich einen „funky“ Song komponieren, der dem Verkauf eines Albums zuträglich war?
Ich beabsichtigte, etwas Authentisches zu schreiben, das auf der afroamerikanischen Erfahrung basierte. Allerdings wollte ich Themen wie Gefängnis, Chain-Gang oder Baumwollpflücken im Süden vermeiden. Ich war schwarz, stammte aber aus dem Norden, aus einer großen Stadt, und hatte somit nicht den blassesten Schimmer von Baumwollfeldern und Chain-Gangs. Ich besaß noch hochfliegende Ideale hinsichtlich meiner Integrität als Musiker und wollte, dass meine Songs mit dem wirklichen Leben übereinstimmten. Okay, warum also nicht eine Nummer schreiben, die auf der Erfahrung als Schwarzer in Chicago beruhte? Und dann blitzte das Bild des Watermelon Man vor meinem geistigen Auge auf, eines wohl eindeutig ethnisch prägnanten Charakters meiner Kindheit.
In den Vierzigern rollte der sogenannte „Wassermelonenmann“ [erst ab den Siebzigern wurde der Begriff „Watermelon Man“ mit einem Drogenhändler gleichgesetzt, A.T.] mit seinem Wägelchen durch die South Side und die Gassen entlang, um seine Früchte zu verkaufen. Damals bestand die Straßendecke noch aus altem Kopfsteinpflaster, und so wuchs ich mit dem Geräusch des Klack-Klack-Klack, Klack-Klack-Klack auf, das die Räder des von einem Pferd gezogenen Wagens machten. Ich hatte dieses rhythmische Klackern so oft gehört, weshalb es mir leichtfiel, es in ein Song-Pattern zu übertragen. Doch wie sollte die Melodie klingen?
Ich erinnerte mich, wie der Watermelon Man seine Ware mit einer Art Sing-Sang anpries. „Watey-mee-low! Red, ripe, watey-mee-low!“ Er rief das zu den Fenstern der Bewohner hoch, schwärmte davon, dass er den Leuten die Wassermelonen „stecken“ wolle, was bedeutete, ein kleines dreieckiges Stück zur Verkostung herauszuschneiden. Obwohl der Watermelon Man rhythmisch „sang“, war das Geheul nicht unbedingt melodisch. Ich dachte an all die Frauen, die auf der Veranda saßen, das Gesicht der Gasse zugewandt. „Hey-eyyy, watermelon man!“ Und da hatte ich sie – die Melodie meines Songs. Ich schrieb ein funky Arrangement, bei dem die Melodie über ein Rhythmus-Muster „säuselte“, welches das Geräusch der Wagenräder imitierte, die über das Kopfsteinpflaster der Straße klapperten. Ich nannte den Song schlicht „Watermelon Man“.
Mir gefiel die Nummer, und ich war glücklich darüber, sie aus einer Kindheitserinnerung heraus kreiert zu haben, einem Teil meines kulturellen Erbes. Ich wusste aber, dass nicht jeder auf den Song eines schwarzen Musikers mit dem Titel „Watermelon Man“ abfahren würde. Damals ließ sich das bestimmende Image von Schwarzen (mit Wassermelonen) mit einer eindeutig negativen Karikatur gleichsetzen, die ein kleines schwarzes Kind mit geflochtenem Haar, großen weißen Augen und glänzenden Zähnen zeigte. Durch die Komposition eines Songs mit dem Titel „Watermelon Man“ fühlte ich mich ein wenig peinlich berührt, denn ich war mir nicht ganz sicher, keinen Fehler zu begehen.
Und so nahm ich mir die Situation gedanklich vor und pflückte sie wie immer analytisch auseinander. Dabei stellte ich mir zwei Fragen: Gibt es negative Bezüge mit Blick auf Wassermelonen? Nein! Gibt es ein inhärentes Problem mit einem „Watermelon Man“? Nein. Dass etwas so Unschuldiges und Harmloses wie eine Wassermelone partiell vom herrschenden Rassismus in Beschlag genommen wurde, war eine Tatsache, die mir überhaupt nicht gefiel. Ich wollte mich davon nicht unterkriegen lassen, denn das hätte bedeutet, sich auf die Opfermentalität einzulassen, die Tendenz zu akzeptieren, unbewusst oder bewusst, das Negative anzunehmen, das mit Rassismus verknüpft ist.
Indem ich das Stück „Watermelon Man“ betitelte, beabsichtigte ich, die Deutungshoheit des Bildes von Schwarzen wieder für uns zu beanspruchen. Nach den gedanklichen Analysen fühlte ich mich erleichtert, da ich den Song mochte und ihn aufnehmen wollte – und mir wäre niemals ein anderer Titel eingefallen.
Es gab übrigens auch einen Gemüsehändler, der mit seinem klackernden Gespann durch die South Side zog, doch der hatte nicht diesen Sound …
Auf Donalds Drängen hin begab ich mich im Frühjahr 1962 zu einem Treffen mit Alfred Lion und Frank Wolff, die ich während der Arbeit an Royal Flush bereits kennengelernt hatte. Alfred und Frank waren deutsche Immigranten, in die USA ausgewanderte Kindheitsfreunde, die Blue Note 1939 gegründet hatten. Die beiden sprachen mit breitem Dialekt, und einige Jazz-Musiker hatten ihren Spaß daran, sie nachzuäffen. Man hätte den Eindruck gewinnen können, dass die Leute sich über sie lustig machten, doch in Wahrheit erkannte jeder, wie viel Herzblut Frank und Alfred investierten und wie viel ihnen die Musik bedeutete. Die Musiker schätzten sie dafür.
Wie Donald mir geraten hatte, erklärte ich Frank und Alfred zuerst, dass ich vor der Einberufung stünde. Dann erzählte ich ihnen von drei Eigenkompositionen, die ich mit zwei Standards und einem Blues einspielen könne, was eine Platte mit sechs Songs ergäbe, damals typisch für eine Jazz-LP. Sie baten mich, die drei Songs vorzuspielen. Als ich fertig war, fragte Alfred: „Kannst du noch drei Nummern schreiben, Herbie?“ Das überraschte mich, denn es war für Blue Note höchst ungewöhnlich, von einem jungen Künstler nur eigene Songs produzieren zu lassen. Vielleicht hatten sie bei „Watermelon Man“ etwas gehört, das sie überzeugte, dass man damit Platten verkaufen konnte, weshalb sie sich gewillt zeigten, ein komplettes Album nur mit eigenen Stücken von mir zu machen. Das verblüffte mich! Ich hatte das Büro an dem Tag in der vagen Hoffnung auf einen Plattenvertrag betreten, und nun boten sie mir viel bessere Konditionen an, als ich jemals zu träumen gewagt hätte.
Doch damit nicht genug. Donald hatte mir vor dem Meeting noch einen Tipp mit auf den Weg gegeben. Er meinte: „Ich werde dir dabei helfen, einen eigenen Verlag zu gründen, denn sie werden dir raten, alle Kompositionsrechte an ihren Verlag abzutreten. Und da musst du nein sagen!“ Ich entgegnete ihm, dass ich davor Angst hätte und befürchtete, sie würden mir aus diesem Grund keinen Vertrag anbieten. Doch Donald stärkte mein Selbstbewusstsein: „Sie werden dich nehmen.“
Damals hatte ich keine Ahnung von dem ganzen Platten-Business, weshalb ich Donald vertraute. Wie zu erwarten, wollte mich Alfred bei dem Treffen auf seine Seite ziehen: „Und natürlich wirst du deine Songs bei uns verlegen.“ Ich folgte Donalds Anweisung.
„Das tut mir leid, aber ich kann es nicht“, antwortete ich. Als er sich nach dem Grund erkundigte, log ich: „Ich habe sie schon längst in meinem Verlag veröffentlicht.“ Ich konnte kaum glauben, dass ich das tatsächlich gesagt hatte, und begann zu schwitzen. Hoffentlich würden die Männer in ihren Anzügen meinen Traum nicht zerstören, bevor er begonnen hatte.
„Tja“, meinte Alfred mit einem Seitenblick auf Frank. „Ich schätze mal, dass wir dann keine Platte mit dir machen können.“ Mir blieb die Luft weg. Ich war so unglaublich enttäuscht, dass ich kein Wort über die Lippen brachte.
Ich stand auf und machte mich auf den Weg, als etwas geschah, was man sonst nur aus Filmen kennt. Auf halbem Weg zur Tür rief Alfred plötzlich: „Herbie, warte mal.“ Die beiden Männer tuschelten miteinander, und dann verkündete er: „Okay, du kannst die Verlagsrechte behalten.“
Ich war einfach nur glücklich, meinen Plattendeal zurückzuhaben. Erst später erkannte ich die tiefe Weisheit von Donalds Ratschlag – und erntete die damit verbundenen Tantiemen. Am nächsten Tag rief ich Hancock Music ins Leben und meldete alle Stücke der ersten Scheibe mit dem Titel Takin’ Off für den Verlag an. Und als „Watermelon Man“ ein Hit wurde, verdiente ich eine Menge Geld damit – Geld, das sonst direkt in die Kasse von Blue Note geflossen wäre. Dank Donald Byrd machte ich wieder einen großen Karrieresprung.
Wir nahmen Takin’ Off in Rudy Van Gelders Studio in Englewood Cliffs, New Jersey, auf. Jahrelang hatte Rudy tagsüber als Augenoptiker gearbeitet und nebenbei als Tontechniker. In den Fünfzigern baute er ein fantastisches Studio und begann, sich ausschließlich der Musik zu widmen. Die meisten Studios hatten ein Flachdach, doch Rudys Aufnahmeraum besaß ein Kathedralen-ähnliches und oben konisch zulaufendes. Nicht nur war die Akustik hervorragend, auch der Raum war so konzipiert, dass die Musiker in einem Halbkreis spielten und nicht in verschiedenen Räumen oder separiert von hohen Abtrennwänden. Das einzigartige Design ermöglichte den Instrumentalisten, sich gegenseitig gut zu hören, und Rudy die exakte Kontrolle der Tonquellen im Mix, obwohl sich alle in einem Raum befanden.
Rudy war dafür bekannt, mit seinem Equipment überaus penibel umzugehen. Wenn er etwas im Studio berührte, trug er weiße Handschuhe, und die Musiker merkten schnell, dass sie auf gar keinen Fall etwas anfassen durften. Wenn etwas bewegt werden musste – auch wenn es sich nur um einen Mikroständer handelte –, bat man ihn darum. Hätte man sich selbst darum gekümmert, wäre die Session unverzüglich gestoppt worden, und man hätte die Bekanntschaft eines aus der Regie stürmenden und krakeelenden Rudy gemacht. Obwohl Rudy eher klein war, konnte er einen Musiker zu Tode ängstigen. Da er so wirkte, als wäre er auf Mord und Totschlag aus, fasste man nie etwas an.
Ich nahm mit Rudy unzählige Platten auf, und er wurde zu einer Art Familienmitglied. Jahre nach der ersten Aufnahme-Session befand ich mich im Studio und musste den Kopfhörer in eine andere Klinkenbuchse stöpseln. „Rudy, ich muss den Kopfhörer umstecken. Neben mir ist ein Anschluss. Als er „Alles klar, mach schon“ antwortete, schauten mich die anderen Musiker im Raum schockiert an. Ich dachte selbst, ich wäre vielleicht gestorben und befände mich im Himmel. Rudy erlaubte mir, den Kopfhöreranschluss selbst zu wechseln! Ich spähte zu ihm rüber und erkannte ein flüchtiges Lächeln. Von dem Moment an wusste ich, dass ich angekommen war.
Während der Aufnahmen zu Takin’ Off lernte ich etwas Neues über Frank Wolff: Spielt man eine Nummer ein, schaut man nicht in die Regie, da man sich auf die Musik konzentriert. Betritt man nach dem Take die Regie zum Abhören der Version, kann man ungefähr vorausahnen, was die anderen davon halten. Bei Blue Note achtete man hierbei besonders auf Frank. Er wippte den Groove – falls er die Musik fühlte – unmerklich mit dem ganzen Körper mit. Machte er das während des Playbacks, hatte man den Take. Falls nicht, bedeutete das: Zurück in den Aufnahmeraum. Sein Instinkt war unfehlbar.
Alfred hatte die Musiker für die Scheibe vorgeschlagen: Billy Higgins an den Drums, Butch Warren am Bass, Freddie Hubbard Trompete und Dexter Gordon Sax. (Dexter hatte einige Jahre in Dänemark gelebt und war gerade zurückgekehrt, eine Erfahrung, die ihm zugutekam, als er die Hauptrolle in Round Midnight [dt. Um Mitternacht] bekam, einem Film, in dem ich auch auftrat und den Score dazu schrieb.) Die Sessions liefen insgesamt reibungslos ab. Nur vor der Einspielung von „Watermelon Man“ spürte ich Bedenken aufkommen. Wie würde Billy Higgins, eigentlich ein Bebop- und Post-Bebop-Trommler diese funky Nummer spielen? Glücklicherweise hatte er einen Stil drauf, der zwischen geraden Achtelnoten und den für den Jazz typischen swingenden Triolen lag, womit er dem Stück ein großartiges funky-jazziges Feeling verlieh. Alles fügte sich zu einem wunderschönen Resultat.
Takin’ Off erschien im Mai 1962 und kletterte auf Platz 84 der Billboard 100. Zu der Zeit hatte Billboard noch keine eigenen Genre-Charts für Pop, Jazz und R&B. Für alle veröffentlichten Alben gab es eine Hitparade, und für ein Jazz-Album wurde das Erreichen der Top 100 schon als recht gut angesehen. „Watermelon Man“ war die das Album „anschiebende“ Single, und als ich sie im Radio hörte, fand ich das verdammt cool.
Nach der Veröffentlichung von Takin’ Off erhielt ich noch mehr Angebote von anderen Musikern. In dem Jahr spielte ich mit Freddie Hubbard auf seinem Album Hub-Tones und mit Roland Kirk auf Domino.
Eric Dolphy gehörte zu den Musikern, die mich damals grundlegend beeinflussten. Eric war der Leader der Avantgarde-Bewegung, im Jazz ein verhältnismäßig neues Underground-Phänomen. Ich hatte seine Musik gehört und schätzte sie. Er veröffentlichte in den Jahren 1960 und 1961 vier Platten, trat überall in New York auf, aber ich verstand seine Herangehensweise nicht. Sein Stil unterschied sich grundlegend von dem Jazz, den die meisten von uns spielten – war viel lockerer, ungezwungener, freier und weniger strukturiert. Im Herbst 1962 lud mich Eric zu einer kleinen Tour ein, doch zuerst war ich mir nicht sicher, ob ich das Spiel mit ihm überhaupt kapieren würde.
„Hast du bestimmte Songs?“, fragte ich ihn. „Oder fangt ihr alle einfach an?“
Eric lachte. „Ja, wir haben Songs und sogar Akkordwechsel.“
Das überraschte mich, denn die Musik klang ganz und gar nicht so. Wollte ich mit Eric auftreten, musste ich Akkordwechsel anders interpretieren, denn meine Herangehensweise und Auffassung führten in dem Kontext nicht zum Ziel. Ich spürte die Nervosität, doch ich dachte: Wenn ich einige der Regeln breche, auf die ich normalerweise alles aufbaue, könnte mich das auf die richtige Spur bringen. Ich entschied mich, es einfach zu versuchen.
Bei den Auftritten mit Eric brach ich absichtlich die vorherrschenden rhythmischen und harmonischen Gesetze und auch die Regeln der Improvisationslinien innerhalb eines Solos. Ich begab mich auf unbekanntes Terrain und fühlte mich in eine Spielweise ein, die ich vorher nicht einmal in Erwägung gezogen hätte. Zuerst fand ich es beängstigend, die Grenzlinien des von mir so mühselig und langwierig Erlernten zu überschreiten, doch es war zugleich berauschend. Aus dieser Erfahrung zog ich eine ungemein wichtige Lehre: Ich lernte, aus dem Bauch heraus zu spielen. So zu agieren, erforderte Mut, Ehrlichkeit, das „Anzapfen“ von grundlegenden und ungefilterten Emotionen, doch der Lohn war enorm.
Eric war für mich ein wichtiger Lehrer, ein liebenswerter, sanfter Mann, der die Musiker immer ermutigte und sich neuen Ideen gegenüber öffnete. Er war in der Lage, den Balanceakt zwischen den Jazz-Konventionen und der Avantgarde zu meistern und produzierte dabei unvergleichbare Musik. Mich stimmt es traurig, dass wir noch mehr kreative und wunderschöne Musik von Eric hätten genießen können, doch er verstarb tragischerweise weniger als zwei Jahre, nachdem ich mit ihm gespielt hatte in Berlin. Eric kollabierte bei einer Show, und als er im Krankenhaus ankam, nahm das medizinische Personal an, er sei offensichtlich auf Drogen und ließ ihn zur Entgiftung einfach im Bett liegen. Doch Eric hatte mit Drogen nichts am Hut – er war Diabetiker. Hätte man ihm Insulin gespritzt, wäre er heute möglicherweise noch am Leben, doch so verstarb er im Alter von nur 36 Jahren im Krankenhaus.
Die mit Eric verbrachten Wochen im Winter 1962/1963 stellten einen wichtigen Entwicklungsschritt dar, denn ich musste zum ersten Mal meinen Platz in einer freien musikalischen Struktur finden. Das, was ich von Eric lernte, sollte nicht nur meinen Stil bei Miles Davis beeinflussen, sondern sich auch auf die Formation und Evolution der Band Mwandishi auswirken. Das Zusammenspiel öffnete mich mental, ließ mich die Möglichkeiten im Jazz erkennen.
Darin lag der Zauber, sich in den Sechzigern in New Yorks Jazz-Szene zu bewegen. Es gab so viele talentierte Musiker, so viele unterschiedliche Entwicklungsstränge im Genre, die man in der ganzen Stadt erkundete, so dass es beinahe einem Oberseminar des Jazz glich. Die Gestaltungsmöglichkeiten, wie man etwas spielte, waren grenzenlos. Sie reichten vom Cool Jazz über Hard Bop und Avantgarde bis hin zum Latin Jazz. Man konnte beinahe jeden Club besuchen und dort einige der weltbesten Musiker hören. Wir empfanden uns als Kinder in einem riesigen Süßwarengeschäft. Ende 1962 nahm ich meinen ersten Job bei einer Latin-Band an. Der Leader war der kubanische Conga-Spieler Mongo Santamaria. Sein Pianist – erst Jahre später fand ich heraus, dass es Chick Corea gewesen war – hatte gerade die Gruppe verlassen. Mongo brauchte für das Wochenende einen Mann fürs Klavier, und ich erklärte mich bereit, auszuhelfen. Ich hatte noch niemals Latin gespielt, doch Mongo meinte, er werde mir leichte Montunos beibringen – einfacher ausgedrückt: Latin-Pattern – und dass ich den Gig damit gut überstünde.
Wir traten in einem Supper Club in der Bronx auf, nicht weit von Donalds und meinem Apartment entfernt. Am dritten Abend kam Donald vorbei, um zu sehen wie es so läuft. Mittlerweile ähnelte er einem großen Bruder, achtete immer auf mich und versicherte sich, dass es mir gutging. An dem Abend herrschte im Club eine apathische Stimmung. Das Publikum saß an den Tischen, unterhielt sich und trank, doch die Tanzfläche war wie leergefegt. Nach Beendigung des ersten Sets schlenderte Donald zum Musikpavillon und stellte sich vor.
Während der Pause unterhielten sich er und Mongo angeregt, denn mein Mitbewohner war ein wahrer „Musikstudent“, der Gespräche über Musikgeschichte und -theorie liebte, mit jedem, der sich dafür interessierte. Die beiden führten eine tiefschürfende Diskussion über afrokubanische Musik und den afroamerikanischen Jazz. Mongo verriet ihm, dass er schon lange nach einem gemeinsamen Bindeglied zwischen den Stilen suche, bislang aber noch keines gefunden habe. Doch er sei sich sicher, dass es dort draußen etwas gebe, eine von der afrikanischen Diaspora ausgehende Verbindung.
Ich hörte nur mit halbem Ohr zu, denn ich empfand es als recht komplexes Gespräch für eine Spielpause bei einer Show in einem Supper Club. Dann rief Donald: „Hey, Herbie – spiel doch mal ‚Watermelon Man‘ für Mongo.“
Mongo nickte mit seinem Kopf im Rhythmus und meinte: „Einfach weiterspielen.“ Er trat vor seine Congas und spielte dazu einen Latin-Beat – er nannte ihn Guajira –, und was soll ich sagen, es passte perfekt. Der Bassist warf einen verstohlenen Blick auf meine linke Hand, um zu sehen, was ich gerade spielte, und kopierte die Basslinie. Kurz danach stieg die komplette Band ein und jammte bei der Latin-gewürzten Neufassung von „Watermelon Man“.
Zwischenzeitlich standen die Leute auf – die den ganzen Abend förmlich an den Stühlen geklebt hatten – und gingen paarweise zur Tanzfläche. Innerhalb von wenigen Minuten ging es unglaublich heiß zur Sache, und das Publikum tanzte und kreischte vor Freude. Auf Mongos Gesicht zeigte sich ein breites Grinsen. Die Musiker schauten sich gegenseitig verblüfft an. Was geschieht hier? Wir begannen zu lachen, denn der Song machte Spaß. Als wir die Nummer beendeten, jubelten einige Leute und klatschten mir auf den Rücken. „Das ist ein Hit! Das ist ein Hit!“ Mongo fragte: „Darf ich es aufnehmen?“
„Bitte, mach nur“, antwortete ich. Ich konnte nicht fassen, was gerade geschehen war, denn bei „Watermelon Man“ hatte ich niemals an einen Latin-Beat gedacht, aber der Rhythmus brachte frisches Leben in den Song.
Mongo Santamaria veröffentlichte seine Version von „Watermelon Man“ im Frühjahr 1963. Es wurde ein großer Hit, erreichte schließlich sogar Platz 10 der Cash Box und Platz 11 in den Billboard-Charts. Ich ging die Straße hinunter und hörte die Nummer laut aus den Fenstern und aus den vorbeifahrenden Autos dröhnen. Ich war zweiundzwanzig Jahre alt – beinahe schon dreiundzwanzig – und hatte einen Riesenhit! Und dank Donalds Ratschlag hinsichtlich des Musikverlags sollte ich endlich ordentliches Geld verdienen!
Nach dem Erfolg von Mongos Version von „Watermelon Man“ erteilte ich dem Urheberrechtsanwalt Paul Marshall ein Mandat, der mir riet, mich bei der BMI als Verlag registrieren zu lassen und nicht nur als Komponist. [BMI – Broadcast Music Incorporated, eine der US-amerikanischen Musikverwertungsgesellschaften, ähnlich der deutschen GEMA.] Damit fiel es der Organisation leichter, die mir zustehenden Tantiemen aufzuspüren. Ich war der BMI schon bei der Ankunft in New York beigetreten, doch wusste nicht, dass man als Komponist und Verleger sogar einen Vorschuss auf die Tantiemen zukünftiger Verkäufe erhielt, hatte man erst einmal einen Erfolg erzielt. Als Marshall dann in meinem Namen bei der BMI anrief, forderte er für mich einen Vorschuss von 3.000 Dollar. Und so überbrachte mir ein Kurier den Scheck innerhalb von einer guten Stunde.
Ich hatte im vorhergehenden Jahr insgesamt nur 4.000 Dollar verdient. Als ich den Briefumschlag öffnete, hielt ich den „dicksten“ Scheck in meiner Hand, den ich bis dato je erhalten, geschweige denn gesehen hatte. Was in aller Welt sollte ich mit dem Geld machen? Ich dachte darüber nach und fällte eine Entscheidung. Ich würde einen Kombi anschaffen!
„Einen Kombi?“, rief Donald verblüfft und runzelte Stirn. „Hey, Mann, meinst du das ernst?“
Ich erklärte ihm den Plan. Mit dem Erfolg von „Watermelon Man“ begann ich über eine eigene Band nachzudenken, mit der ich rausfahren und den Song promoten könnte. Hätte ich aber eine eigene Band, bräuchte ich natürlich einen Wagen, um das Equipment zu den Gigs zu karren und wieder zurück. Das am effizienteste und vernünftigste Vehikel war ein Kombi.
Donald legte eine Hand auf meine Schulter und musterte mich eindringlich: „Herbie, hast du nie daran gedacht, dir einen Sportwagen zuzulegen?“
„Nein“, lautete meine knappe Antwort. Und das entsprach der Wahrheit. Mir war es niemals in den Sinn gekommen, Geld für einen Sportwagen auszugeben, was möglicherweise daran lag, dass ich nie auch nur annähernd so viel besessen hatte. Donald wusste, wie es sich anfühlte, mit einem schönen und teuren Schlitten durch New York zu brausen – auch wenn er nicht ihm, sondern seiner Freundin gehörte.
„Hör mal, es gibt da diesen neuen Wagen namens AC Cobra. Es ist das Straßenmodell eines Rennwagens, der sogar einen Ferrari ausgestochen hat.“ Er berichtete mir alles über den von Ford produzierten Cobra, das heißeste neue Geschoss, über das sich Autoliebhaber unterhielten. Am Broadway befand sich ein Showroom, und dort durfte man sogar eine Probefahrt machen. „Schau ihn dir mal an und überleg, ob du danach immer noch einen Kombi haben willst.“ Ich stimmte zu, mal einen Blick zu riskieren, obwohl der superschnelle Sportwagen nicht meinen Bedürfnissen entsprach.
Kurz darauf besuchte ich das Charles Kreisler Automotive und betrat den Ausstellungsraum. Einige Verkäufer saßen hinter einem großen Tisch, doch sie würdigten mich keines Blickes, als ich hereinkam. Besonders ein Typ schien mich um alles in der Welt ignorieren zu wollen. Ich lehnte mich schließlich über das Möbel und sprach ihn direkt an: „Entschuldigen Sie bitte. Sie haben doch einen Cobra hier.“ Er schaute mich immer noch nicht an, sondern deutete mit einer tippenden Fingerbewegung in Richtung des Autos.
Ich wusste, was er dachte: Dieser arme schwarze Kerl schnüffelt hier rum, doch er kann sich den Wagen überhaupt nicht leisten. Um fair zu bleiben: Ich war gerade erst dreiundzwanzig Jahre alt geworden und dort mit Jeans und Hemd, aber ohne Jackett aufgetaucht. Wahrscheinlich sah ich wie jemand aus, dessen Budget so ein schnittiges, teures Cabrio tatsächlich weit überstieg, doch es gab überhaupt keinen Grund, mich so geringschätzig zu behandeln. Als ich zum Wagen schlenderte, spürte ich regelrechte Hitzewellen.
Ich hatte mir noch nie einen fahrbaren Untersatz zugelegt und wusste somit nicht, auf was man achten musste. So umkreiste ich den Wagen, tippte vorsichtig mit dem Fuß gegen einen Reifen und bückte mich, um die Scheinwerfer zu inspizieren. Doch statt mich zu beruhigen, wurde ich wütender und wütender. Ich schlenderte zurück zum Schreibtisch des Verkäufers und sagte: „Mich interessiert der Cobra.“
Endlich blickte der Mann auf. „Wissen Sie, wie viel der Wagen kostet?“
„Yeah“, schnappte ich zurück. „Er kostet 6.000 Dollar, und ich werde ihn kaufen. Ich bringe Ihnen morgen das Geld in Cash.“ Ich raste innerlich. Mir war es in dem Moment egal, was ich kaufte – ich wollte es dem Kerl nur zeigen.
Am nächsten Tag fuhr ich mit Donald im Jaguar seiner Freundin zu dem Händler und betrat den Laden in einem schicken Sportmantel, mit dabei die 3.000 Dollar für die Anzahlung. Nun wurde ich natürlich von allen sehr zuvorkommend behandelt. Während ich den Papierkram unterschrieb, sah ich den großartigen Saxofonisten Jimmy Heath, der mit einigen mir bekannten Musikern den Broadway entlangspazierte. Als sie sahen, was hier gerade vor sich ging, zeigte sich auf ihren Gesichtern ein breites Grinsen, woraufhin sie rüberkamen, um sich den Schlitten anzusehen. Jimmy machte tatsächlich die erste Fahrt, denn ein Mechaniker fuhr mit ihm eine Runde um den Block, während ich die letzten Unterschriften unter die Verträge setzte – mit einem Lächeln im Gesicht.
Mir war es nur recht, dass Jimmy die erste Runde mit dem Mechaniker drehte, denn ehrlich gesagt hatte ich eine Höllenangst, den Cobra zu fahren.
Am Morgen hatte mich der Verkäufer schon zu einer kurzen Probefahrt mitgenommen, und ich konnte kaum glauben, wie schnell der Wagen war. Ich hatte zudem Bedenken, da die Kupplung wegen des Drehmoments des Motors hart ansprach. Den Papierkram hinter mich gebracht, warf mir Donald dann die Schlüssel des Jaguars zu, und ich gab ihm die des Cobra, damit er ihn für mich in die Bronx fuhr.
Ich hatte dort eine Garage angemietet. Die nächsten zwei Wochen ging ich ständig dorthin, setzte mich in den Wagen und tat so, als würde ich fahren. Ich übte mit der Gangschaltung, drückte mich in den Sitz und fühlt mich schließlich mutig genug für eine Spritztour.
Ich machte mir in der Anfangszeit große Sorgen vor eventuellen Kratzern oder Beulen, doch ironischerweise war es Donald, der den Wagen ungefähr sechs Wochen nach dem Kauf schrottete. Der Unfall war nicht seine Schuld und ich wiederum froh, dass ihm nichts zugestoßen war, doch es kostete eine ganze Stange Geld, ihn wieder zu reparieren.
Wie bereits die anderen Ratschläge Donalds – meine Kompositionen im eigenen Verlag zu publizieren und Mongo Santamaria „Watermelon Man“ vorzuspielen – erwies sich auch der Tipp zur Anschaffung des Cobra letztlich als finanziell lukrativ. Jahre später fand ich nämlich heraus, dass ich der Erste an der Ostküste gewesen war, der sich einen Cobra zugelegt hatte. Zudem war es der sechste der Produktionsreihe. Da die Modelle zwischenzeitlich unglaublich selten sind, hat sich der damalige Preis von exakt 5.825 Dollar um einiges vervielfacht.
Und: Ich besitze ihn immer noch.