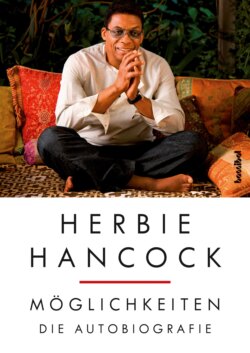Читать книгу Möglichkeiten - Lisa Dickey, Herbie Hancock - Страница 6
ОглавлениеMitte der Sechziger in einer Konzerthalle in Stockholm. Ich sitze auf der Bühne vor dem Klavier und spiele mit dem Miles Davis Quintett. Wir befinden uns auf einer Tournee, und diese Show heizt sich langsam auf. Die Band ist tight – alle synchron, alle auf derselben Wellenlänge. Die Musik fließt, wir haben eine Verbindung zum Publikum hergestellt, und es fühlt sich magisch an, als würden wir einen Zauber beschwören.
Tony Williams, das Drummer-Wunderkind, der bei Miles als Teenager einstieg, glüht förmlich. Ron Carters Finger flitzen auf dem Basshals auf und ab, und Wayne Shorters Saxofon schreit und kreischt. Aus uns fünfen ist eine Einheit geworden, die sich im Flow der Musik hin- und herbewegt. Wir spielen „So What“, einen von Miles’ Klassikern, und nähern uns rasant seinem Solo. Es ist der Höhepunkt des Abends, und das Publikum sitzt – bildlich gesprochen – erwartungsvoll auf der Stuhlkante, spürt die Erregung.
Miles beginnt seinen Part, baut das Solo auf und holt kurz Luft, bevor er sich gehen lässt. Und exakt in dem Moment spiele ich einen Akkord, der unglaublich falsch ist. Ich weiß gar nicht, woher er kam – es ist ein falscher Akkord an der falschen Stelle, und er liegt nun wie der Geruch von fauligem Obst in der Luft. Oh, Scheiße! Wir alle kreierten dieses herrliche Klanggemälde, und ich habe aus Versehen ein Streichholz darunter entzündet.
Miles zögert den Bruchteil einer Sekunde und spielt dann einige Töne, die meinen Akkord wie durch ein Wunder korrekt erscheinen lassen. Ich glaube, dass ich exakt in dem Moment mit offenem Mund dasaß. Was war das für eine Alchemie? Und danach nahm er die Melodie auf und entfachte ein Solo, das den Song in eine neue Richtung führte. Die Menschenmenge rastete aus.
Zu dem Zeitpunkt befand ich mich in den frühen Zwanzigern und hatte Miles schon seit einigen Jahren begleitet. Doch er war immer noch in der Lage, mich zu verblüffen und zu erstaunen, was er an dem Abend auch machte, indem er den Akkord von „falsch“ nach „richtig“ modulierte. Nach dem Auftritt sprach ich ihn in der Garderobe darauf an. Ich fühlte mich ein wenig verlegen, doch Miles winkte ab, der Hauch eines Lächelns auf seinem scharfgeschnittenen Gesicht. Er sagte nichts. Das musste er nicht. Miles war niemand, der viel redete, wenn er uns stattdessen etwas beibringen konnte.
Ich brauchte Jahre, um zu verstehen, was in dem Moment auf der Bühne geschehen war. Sobald ich den Akkord angeschlagen hatte, bewertete ich ihn. Meiner Auffassung nach war es ein „falscher“ Akkord. Miles hingegen fällte kein Urteil – er hörte einen Klang, der gerade entstanden war, und interpretierte ihn als eine Herausforderung, als eine Frage des: „Wie kann ich den Akkord in das integrieren, was wir gerade spielen?“ Und weil er nicht bewertete, konnte er damit umgehen, daraus etwas Neues und Erstaunliches entstehen lassen. Miles vertraute der Band, er vertraute sich selbst, und er ermutigte uns, diesem Beispiel zu folgen. Das war eine der zahlreichen Lektionen, die ich von ihm lernte.
Wir alle haben die allzu menschliche Tendenz, den sicheren Weg einzuschlagen – das zu machen, von dem wir wissen, dass es funktioniert –, und verpassen damit die sich bietenden Chancen. Doch das ist die Antithese des Jazz, der von der Präsenz des Augenblicks lebt. Beim Jazz erlebt man den Moment, und zwar in jeder Facette. Der Jazz beinhaltet das Selbstvertrauen eines Musikers, blitzschnell zu agieren. Gestattet man sich das, wird man niemals mit dem Erforschen und dem Lernen aufhören, was sowohl für die Musik als auch das Leben gilt. Ich hatte das große Glück, dies nicht nur beim Spielen mit Miles zu lernen, sondern auch in den folgenden Jahrzehnten, in denen ich Musik machte.
Und ich lerne es noch immer, jeden Tag aufs Neue. Es ist ein Geschenk, das ich niemals hätte vorhersehen können, als ich im Alter von sechs Jahren auf dem Klavier meines Freundes Levester Corley herumklimperte.
Levester Corley wohnte im selben Gebäude wie meine Familie, an der Ecke der 45st Street/King Drive in der South Side von Chicago. Wir lebten in einer armen Gegend, doch es war nicht die schlimmste in den Vierzigerjahren dort, möglicherweise eine Stufe darüber, was bedeutete, nicht in einer Sozialwohnung zu hausen, doch in der Nähe dieser Wohnprojekte. Ich habe unser Viertel damals nicht als „schlecht“ eingeordnet, obwohl es in einigen Straßen recht hart zuging. Dort gab es Gangs, und am Ende des Blocks befand sich ein baufälliges und von uns so bezeichnetes „Big House“, Slang für ein Gefängnis. Ständig hingen junge Männer vor dem Big House ab, und wenn man sie sah, wusste man, dass es ratsam war, die Straßenseite zu wechseln. Doch meist fühlte ich mich sicher und nicht bedroht. Ich nahm an, dass meine Nachbarschaft der anderer ähnelte.
Ich wurde 1940 geboren. Als ganz kleines Kind glaubte ich, wir seien reich, da uns alles zur Verfügung stand, was wir haben wollten. Wir hatten Kleidung, genügend Essen und jedes Jahr einen Weihnachtsbaum und Spielzeug. Wie hätte ich das anders empfinden können als mit dem Gefühl, „reich zu sein“? Ich hatte noch nie jemanden getroffen, der außerhalb des Viertels lebte, und verglichen mit einigen anderen Familien des Blocks, schien es uns gutzugehen. Im Keller unseres Hauses wohnte eine Familie mit zehn Mitgliedern, die sich in einem einzigen Raum drängten. Im Vergleich dazu standen uns zwei Schlafzimmer für fünf Bewohner zur Verfügung – für meine Eltern, meinen Bruder Wayman, meine Schwester Jean und mich. Das fühlte sich wie purer Luxus an.
Levester wohnte auf einer anderen Etage, und als wir sechs Jahre alt waren, kauften ihm seine Eltern ein Klavier. Ich hatte es schon immer gemocht, bei Levester abzuhängen, doch als er das Klavier besaß, wollte ich permanent nur noch sein Apartment aufsuchen, um darauf zu spielen. Ich liebte das Gefühl der Tasten unter den Fingern, obwohl ich nicht so recht wusste, was ich da machte. Wir klimperten auf dem Instrument herum, und ich versuchte, richtige Songs zu spielen. Wenn ich in unsere Wohnung zurückkehrte, erzählte ich Mom davon. Nach einiger Zeit sagte sie zu Vater: „Wir müssen dem Jungen ein Klavier kaufen.“ Mit sieben Jahren schenkten sie mir ein gebrauchtes Instrument aus dem Keller einer Kirche, erstanden für ungefähr fünf Dollar.
Es stellte keine Überraschung dar, dass meine Mutter, Winnie Griffin Hancock, so versessen darauf war, mir ein Klavier zur Verfügung zu stellen. Sie zeigte sich bedacht darauf, ihren Kindern Wertschätzung für Kultur beizubringen, was auch dazu führte, dass sie mich Herbert Jeffrey Hancock nannte – nach dem afroamerikanischen Sänger und Schauspieler Herb Jeffries. Für Mutter bedeutete Kultur Musik. Sie achtete darauf, dass wir als Kinder Tschaikowsky, Beethoven, Mozart und Händel hörten. Sie liebte auch die Musik, die die schwarze Community hervorbrachte – Jazz und Blues –, und ihr lag intuitiv viel daran, dass wir eine Verbindung dazu aufbauen sollten, als Teil unseres kulturellen Erbes. Doch für sie war „gute Musik“ in erster Linie klassische Musik, und nachdem ich das Klavier bekommen hatte, schickte sie mich und meinen Bruder zum Klassikunterricht.
Das Gefühl für soziale Klasse und Kultur wurzelte in der ungewöhnlichen Kindheit von Mom im Süden. Ihre Mutter – meine Oma Winnie Daniels – wuchs unter ärmlichen Verhältnissen in Americus, Georgia, auf, in einer Familie von Kleinpächtern, die den Besitz einer reichen Familie namens Griffin bewirtschaftete. Als meine Großmutter alt genug war, heiratete sie einen der Griffin-Söhne und war somit vom Kind eines Pächters zur Frau eines Landbesitzers „aufgestiegen“. Und so lebten meine Mutter und ihr Bruder Peter in einer wohlhabenderen Umgebung als die meisten schwarzen Kids zu der Zeit.
Während ich aufwuchs, erzählte man mir immer, dass mein Großvater Griffin schwarz sei, doch auf den wenigen Fotos, die man mir zeigte, sah er gar nicht wie ein Schwarzer aus. Jahre später verriet mir Mom, dass er in Wirklichkeit ein Weißer gewesen sei, weshalb ich bis zum heutigen Tag die Wahrheit nicht kenne. Ich weiß aber, dass Großvater in den Zwanzigern sein gesamtes Vermögen verlor. Er starb kurz danach, und Oma packte ihre Sachen und zog mit der Familie nach Chicago, um von vorne anzufangen.
Es war ein harter Einschnitt in ihrem Leben. Nachdem sie in Georgia ein privilegiertes Leben genossen hatten, sahen sich meine Oma und meine Mutter gezwungen, in Chicago Arbeit als Hausmädchen anzunehmen. Mutter putzte während der gesamten Highschool-Zeit die Häuser weißer Familien, was sie verständlicherweise hasste. Sie verbrachte zwei Jahre auf dem College, und das ermöglichte ihr dann, eine Anstellung als Sekretärin anzunehmen. Schließlich war sie als Beraterin für das Arbeitsministerium des Bundesstaates Illinois tätig. Mom arbeitete hart und zog ihre drei Kinder in dem Glauben auf, dass wir etwas Großartiges erreichen könnten.
Das war die positive Seite meiner Mutter. Doch es gab auch eine andere Seite. Sie litt unter einer bipolaren Störung, was wir damals nicht einordnen konnten. In jenen Tagen benutzten die Leute nur Umschreibungen wie „starrsinnig“ und „aufgekratzt“. Sie verlor sich in Auseinandersetzungen mit Familienmitgliedern, schlimmen Streitigkeiten, bei denen sie schrie, weinte und so lange wütete, bis man die geschwollenen Adern an ihrem Hals entdeckte. In unserem Haus lief alles nach dem Willen meiner Mutter ab, oder aber man musste sich aus dem Staub machen, doch Dad tat ihre Tobsuchtsanfälle ab und meinte: „So ist Winnie nun mal.“ Er liebte seine Frau sehr und neigte dazu, sie auf ein Podest zu stellen, da Mutter sich auf eine würdevolle Art durchs Leben schlug. Doch er wusste, dass man ihr nicht in die Quere kommen durfte. Wann immer wir ihn um etwas baten, antwortete er schnell: „Geht und fragt eure Mutter.“
Mein Vater lässt sich als ein liebenswerter, unkomplizierter Mensch beschreiben, die Art von Mann, der in jeder Gruppe Witze riss. Er wurde von Oma und Opa Hancock aufgezogen, doch kaum jemand ahnte, dass er nicht unter dem Namen Hancock geboren worden war, denn er erblickte das Licht der Welt während der ersten Ehe von Großmutter, die damals mit einem Mann mit Nachnamen Pace verheiratet war. Ich weiß nichts über meinen Großvater Pace, abgesehen davon, dass Oma ihn immer als schlechten Kerl beschrieb. Sie verließ ihn und heiratete Louis Hancock, der Vater adoptierte und ihm seinen – und nun meinen – Namen gab.
In seiner Jugend wollte Vater Arzt werden, doch für eine arme schwarze Familie aus Georgia stand das in den Dreißigern völlig außer Frage. Es gelang ihm noch nicht einmal, die Highschool zu beenden, denn nach einer Familiendiskussion hinsichtlich der Finanzen musste er bereits nach dem zweiten Jahr abgehen. Zu dem Zeitpunkt war die Familie schon nach Chicago gezogen, und Dad wusste, dass seine beiden jüngeren Brüder das College besuchen könnten, würde er nur hart genug arbeiten. Er opferte also seine eigene Ausbildung zugunsten der seiner Brüder. Schon als Teenager arbeitete er in einem Gemischtwarengeschäft. Obwohl er niemals wieder die Schule besuchte, gelang es ihm schließlich, einen eigenen Laden zu eröffnen.
Unglücklicherweise verhielt er sich zu großzügig für einen guten Geschäftsmann. Er billigte den Kunden einen immer größeren Kredit zu und hatte dann seine Schwierigkeiten, das Geld energisch genug einzufordern. Manchmal kaufte er als eine Art Großhändler für andere Familiengeschäfte voluminöse Fleischstücke von den Schlachthöfen, was in die gleiche Story mündete. Er gewährte ihnen einen Kauf auf Pump und brachte es nicht übers Herz, das ausstehende Geld zu verlangen. Dads Großzügigkeit gefährdete seine geschäftliche Existenz, und er verkaufte schließlich das Geschäft. Während ich aufwuchs, ging er verschiedensten Jobs nach, ungelernten Tätigkeiten wie der als Bus- und Taxifahrer, da er ja nur zwei Jahre auf der Highschool gewesen war. Letztendlich stieg er allerdings zum behördlichen Fleischbeschauer in den Chicagoer Schlachthöfen auf.
Meine Onkel sahen meinen Vater als Helden, der sich für sie geopfert hatte. Was seine mangelnde Bildung betraf, zog ihn Mutter jedoch manchmal mit scharfer Zunge auf gemeine und rechthaberische Weise auf, nannte ihn dumm oder wählte noch schlimmere Wörter. Sie machte das nicht oft, und es ließ sich meist auf ihre Erkrankung zurückführen, doch sie wusste genau, wie man Sprache einsetzte, um ihn zu verletzen.
Ich war mir dessen bewusst, dass sich meine Eltern liebten, und beobachtete, wie geduldig Vater mit Mom umging, sogar wenn sie sich in ihrer „starrsinnigen“ Phase befand. Doch manchmal wurden aus ihren Tobsuchtsanfällen regelrechte Übergriffe. Eines Nachmittags sah ich Dad zufällig in seinem Unterhemd und entdeckte auf dem ganzen Rücken Kratzspuren. Er redete auch später nie darüber. Ich habe niemals erlebt, dass er auch nur ein einziges negatives Wort über Mutter verlor. Egal, wie launisch und sprunghaft sie sich verhielt, er gab sich immer ausgeglichen und beständig. Darin liegt vermutlich der wichtigste Grund, warum ich mich an meine Kindheit als eine stabile, glückliche Zeit erinnere.
Doch dafür gab es auch noch einen weiteren Grund: Schon als kleines Kind tendierte ich dazu, eher das Gute und nicht das Schlechte in verschiedenen Situationen zu sehen. Nicht, weil ich versuchte, ein tugendhafter Mensch zu sein oder es anderen zu zeigen – ich habe die negativen Aspekte einfach nicht wahrgenommen oder ihnen Aufmerksamkeit geschenkt. Ich bin von ganzem Herzen ein Optimist – und dies immer gewesen.
Jahre, nachdem meine Schwester Jean von Chicago fortgezogen war, verfasste sie einen knappen Lebenslauf für ein Seminar. Und sie beschrieb das Umfeld, in dem wir aufgewachsen waren, folgendermaßen:
Die Mädchen wurden schon in der Pubertät schwanger, die Jungs verehrten die Heroindealer und kopierten schließlich deren Angewohnheiten. Der Tratsch in der Küche drehte sich um den Kauf gestohlener Waren, die Messerstechereien am Wochenende und die „Berufswahl“ einer netten jungen Lady mit einem schönen Körper. Bei uns gab es – was die Geschäfte anbelangte – überwiegend Schnapsläden, stinkende Gemischtwarengeschäfte, gut gesicherte Wechselstuben und schäbige Billigläden …
Konnte das alles wahr sein? Ich schätze mal, ja. Aber wenn ich mich an unsere Nachbarschaft entsinne, denke ich an das Murmelspielen mit meinem Bruder oder daran, wie ich im Geschäft meines Dads Goldenrod-Eiscreme bekam oder mit Freunden an einer Ecke stand und R&B-Songs von Gruppen wie den Five Thrills oder den Ravens sang. Seit ich mich erinnern kann, tendiere ich dazu, die gute und nicht die schlechte Seite einer Sache zu sehen. Es ist ein Charakterzug, der mich glücklich stimmt.
Einige ältere Brüder wollen sich nicht mit ihren jüngeren Geschwistern abgeben, doch mein Bruder Wayman verhielt sich anders. Obwohl drei Jahre älter, nahm er mich überallhin mit.
Er liebte Spiele und Sport, und so nahm er mich zum Murmelspielen mit oder zum Softball, obwohl ich darin schrecklich schlecht war. Für mein Alter war ich klein geraten und hatte auch kein Interesse an Sport, doch er schien es trotzdem zu mögen, mich bei sich zu haben.
Wayman erinnert sich an ein spezielles Softball-Spiel, in dem sein Team zwanzig Runden vorne lag und er mich ermutigte, es als Pitcher zu versuchen. Ich war ungefähr sechs Jahre alt, und sie stellten mich nahe an die Base, doch ich konnte keine Strikes erzielen. Ich ging dann näher heran, doch es klappte immer noch nicht. Als ich endlich einen Ball weit genug geworfen hatte, jubelte das ganze Team.
Die Beziehung zu meiner Schwester lässt sich hingegen als schwierig beschreiben. Jean war das einzige Mädchen und zudem die Jüngste in der Familie, wodurch sie sich manchmal ausgeschlossen fühlte. Sie versank in eine regelrechte Frustration, denn sie wollte zu den Jungs gehören. Einmal erwischten wir Jean, als sie im Badezimmer versuchte, im Stehen zu pinkeln, woran wir sie natürlich immer erinnerten.
Jean war zwar drei Jahre jünger als ich, doch sie konnte so clever und scharfzüngig wie meine Mutter sein. Da sie so klug war, fiel es ihr leicht, sich verbal in allen Situationen durchzusetzen. Hatte sie sich erst mal eine Meinung gebildet, verbiss sie sich wie eine Bulldogge darin. Eigentlich hätte sie als Siegerin aus jeder Debatte gehen können, da sie genau wusste, wie man Auseinandersetzungen provozierte und manipulierte. Wir kamen gut miteinander aus, doch wenn wir stritten, drängte sie mich immer in eine Ecke. Einmal war ich sogar so genervt, dass ich sie schlagen wollte. Doch meist, zumindest in unserer frühesten Kindheit, verstanden wir uns gut.
Obwohl jünger, wirkte Jean manchmal einschüchternd. Sie verhielt sich dann stürmisch, und sowohl sie als auch Mutter wussten, wie man andere verbal verletzte. Mom und meine Schwester hatten oft Auseinandersetzungen, vielleicht, weil sie sich in ihrer Angriffslust so sehr ähnelten. Die bipolare Erkrankung meiner Mutter eskalierte während der Kinderjahre von Jean, weshalb sie, verglichen mit uns, bereits in jungen Jahren die ganze Wucht des Verhaltens in einem stärkeren Ausmaß zu spüren bekam.
Meine Schwester zog in ihrem Leben in vielerlei Hinsicht oftmals den Kürzeren, obwohl sie daran nicht die Schuld trug. Sie war brillant, übersprang in der Schule die Klassen, brachte sich selbst das Gitarrenspiel bei und trieb Sport. Sie konnte fast alles besser als andere Menschen, doch für eine junge schwarze Frau, die in den Fünfzigern und Sechzigern aufwuchs, gab es nur wenige Ausnahmen von der Regel und noch weniger Möglichkeiten. Sie musste sich um alles über die Maßen bemühen und kämpfen, worüber ich erst Jahre später gründlich nachdachte, nach Ende ihres allzu kurzen Lebens.
Zu dem Zeitpunkt realisierte ich, wie sehr Jean meine Anerkennung brauchte. Sie war ein zutiefst leidenschaftlicher Mensch, deutlich passionierter als ich selbst, hochemotional, wohingegen ich tendenziell zu Rationalität und vernunftgeleitetem Handeln neige. Manchmal versuchte sie bei mir, Reaktionen zu provozieren, doch ich erkannte den Beweggrund dafür nicht. Es war keine Provokation an sich, sondern ein Bedürfnis ihrerseits, Anerkennung zu erlangen. Wie bei so vielen Themen, die mich nicht direkt bewegten, verschwendete ich kaum einen Gedanken daran. Ich tendierte schon immer dazu, mich auf das unmittelbar vor mir Liegende zu konzentrieren. Das ist der Grund, warum ich die Nuancen im Leben anderer nicht bemerke und das, was mit ihnen geschieht.
Schon von frühester Kindheit an verfügte ich über die Fähigkeit – eigentlich ist es sogar eine Art Zwang –, mich in meiner jeweiligen Tätigkeit komplett zu verlieren. Ich war von mechanischen Objekten regelrecht besessen und verbrachte Stunden damit, Uhren bzw. Armbanduhren auseinanderzunehmen, um mir ihr Innenleben anzuschauen. Mich überkam ein regelrechter Drang, die Mechanik eines Gegenstands zu verstehen, und wenn ich es nicht kapierte, schirmte ich mich mental ab und fokussierte mich obsessiv auf die Lösung. Zuerst inspizierte ich alle nur erdenklichen Gerätschaften, die ich im Haus fand. Nachdem mir meine Eltern das Klavier geschenkt hatten, lenkte ich mein obsessives Fokussieren dann auf das Erlernen des Instruments.
Als das Klavier in unserer Wohnung stand, wollte ich nur noch spielen. Mein Bruder und ich nahmen Stunden bei derselben Lehrerin, einer gewissen Mrs. Jordan, die etwa ein Dutzend schwarzer Schüler unterrichtete. Wir erlernten die Klassik, was auf alle anderen schwarzen Kids zur damaligen Zeit auch zutraf, denn es gab keinen Unterricht in Blues, R&B oder vergleichbaren Stilen. Das Erlernen des Klavierspiels bedeutete das Studium klassischer Musik, was Mom natürlich nur recht war.
Bei Mrs. Jordan standen Klavierkonzerte und Wettbewerbe auf dem Lehrplan, und es dauert nicht lange, bis ich mich für die Laufbahn eines Konzertpianisten entschied. Von dem Punkt an füllte die Musik mein ganzes Leben aus. Ich verbrachte jeden freien Augenblick am Klavier, nahm mir Akkorde und Melodien vor, lernte das Notenlesen und machte Fingerübungen. Egal, wie viel ich auch lernte – es gab noch mehr zu lernen, was ich liebte und immer noch liebe.
Natürlich gefiel mir das Klavierspiel auch und reizte mich, denn im Gegensatz zum Sport war ich darin gut. Als kleiner Junge mit einer schlechten Koordination war ich beim Sport immer unterlegen, doch nun hatte ich eine Aktivität gefunden, bei der ich genauso gut sein konnte wie mein Bruder und seine Freunde. Wayman erwies sich als großartiger Pianist, doch er hatte nicht meine obsessive Konzentrationsfähigkeit, und schon nach kurzer Zeit spielte ich besser als er. Als das Klavier erst einmal in unserer Wohnung stand, habe ich nie mehr mit Wayman und seinen Freunden Sport getrieben.
In unserem Viertel fand man es übrigens cool, Klavier zu spielen! Da ich so klein war, wurde ich von anderen Kindern manchmal herumgeschubst. Das geschah einmal direkt vor dem Big House, wo einige Kids mich niederrissen und auf mich drauf sprangen. Doch als es erst mal die Runde gemacht hatte, dass ich Klavier spielte, fand ich mich in einer höheren Liga wieder. Musik zu machen, veränderte alles in meinem Leben. Ich hatte ein Ziel und das Bestreben, es zu erreichen. Die anderen sahen mich plötzlich in einem anderen Licht, doch am wichtigsten war meine neue Selbstwahrnehmung.
Im Alter von elf Jahren meldete mich Mrs. Jordan beim jährlich stattfindenden Wettbewerb des Chicago Symphony Orchestra an. Als Teil der Jugendförderung lud das CSO Schüler ein, um einen Satz aus einem Konzert vorzuspielen. Dem Gewinner wurde die Ehre zuteil, das Stück live mit dem CSO aufzuführen.
Damals hatte ich schon vier Jahre Unterricht genommen und meine Zeit fast ausschließlich mit Klavierspiel verbracht. Ich übte ein Jahr lang beinahe täglich Mozarts 18. Klavierkonzert in B-Dur, KV 456, und war mehr als bereit zum Vorspielen. Man hielt den Wettbewerb in der Orchestra Hall ab, heute bekannt als das Symphony Center. Von jedem Schüler wurde ein Soloauftritt erwartet, in Gegenwart des zweiten Dirigenten George Schick.
Ich betrat die Bühne, setzte mich ans Piano und schaute auf die Zuschauerreihen hinunter. Dort saß Mrs. Jordan, und ich bemerkte auch zwei andere Ladys, die hereinkamen und neben ihr Platz nahmen. Dann richtete ich meine Aufmerksamkeit auf das Klavier, und von dem Moment an, in dem ich die ersten Töne anschlug, schien die Welt um mich herum nicht mehr zu existieren. Ich spielte den ersten Satz, und erst, nachdem die letzten Töne verklungen waren, schaute ich auf.
Tja, das war sehr gut, dachte ich. Als ich die Bühne verließ, ging ich zu Mrs. Jordan, die mich drückte und mir versicherte, dass ich gut gespielt habe. Sie verriet mir, dass die beiden Frauen auch Klavierlehrerinnen seien und dass beide nach Ende des Vorspielens geweint hätten. Für einen Elfjährigen kam so ein Urteil einem Rausch gleich.
Wenige Monate darauf fand ich in der Post eine Karte mit der Aufschrift „Herzlichen Glückwunsch“. Ich hatte den Wettbewerb gewonnen und erhielt somit die Einladung, am 5. Februar 1952 mit dem Chicago Symphony Orchestra aufzutreten. Unglücklicherweise stand auf der Postkarte, dass das CSO sich nicht in der Lage sehe, für das von mir vorgetragene Konzert die Orchester-Partituren zu besorgen. Somit musste ich ein neues Stück erlernen oder diese großartige Chance verstreichen lassen.
Ich starrte schockiert auf die Postkarte. Wie konnte das nur sein? Während eines ganzen Jahres hatte ich das Konzert in- und auswendig gelernt, und nun standen mir nur wenige Monate zur Verfügung, ein brandneues einzuüben. Und hier ging es nicht um einen simplen Vortrag, es handelte sich um mein Bühnendebüt mit dem Chicago Symphony Orchestra. Ich wollte mir die Chance auf gar keinen Fall entgehen lassen – auf gar keinen Fall! Und so wählten wir ein neues Konzert aus – das 26. Klavierkonzert in D-Dur, KV 537 –, und ich begann, fieberhaft zu üben. Ich spielte das Stück Stunde um Stunde, und als der Konzerttermin immer näher rückte, konnte ich es gut, wenn auch nicht so gut wie Nummer 18.
Schließlich war der große Abend gekommen. Ich stand nicht an erster Stelle des Programms, weshalb ich nervös an der Bühnenseite verharrte, während das Orchester sein erstes Stück aufführte. Neben dem Podium des Dirigenten befand sich ein Fahrstuhlschacht. Kurz vor dem Auftritt wurde damit ein Konzertflügel hochbefördert und in Position gebracht. Ich holte tief Luft, ging auf die Bühne und nahm vor dem großen Instrument Platz.
Ich muss beim Rausgehen wohl recht niedlich gewirkt haben, denn mit elf war ich noch sehr klein und schmächtig. Nur mit Müh und Not ließen sich die Pedale des Flügels erreichen. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was ich trug, glaube aber, es waren ein Jackett, kurze Hosen und Kniestrümpfe. Doch in dem Moment, als ich mit dem Stück begann – das ähnelte dem Vorspiel –, verschwand die Welt um mich herum. Nur noch ich und die Musik existierten.
Am Ende des Konzerts explodierte das Publikum förmlich mit einem lauten Applaus, und einige Leute baten mich sogar um ein Autogramm. Ich schrieb eines für ein Mädchen meines Alters, sorgfältig darauf achtend, „Herbert Hancock“ in einem geschwungenen Zug aufs Papier zu setzen. Stolz erfüllte mich und zugleich Erleichterung, das neue Konzert in so kurzer Zeit gelernt zu haben.
Ein oder zwei Wochen später erhielt ich von Mrs. Jordan eine Einladung zu einem Konzert der britischen Pianistin Dame Myra Hess in der Chicago Symphony als eine Art Geschenk zu meinem Erfolg. Als wir das Programmheft sahen, erstarrten wir beinahe von Verblüffung: Mozarts 18. Klavierkonzert in B-Dur, KV 456! Irgendwie war es ihnen gelungen, die Noten für das Orchester aufzutreiben. Vielleicht waren sie aber auch nie verschwunden gewesen? Es wäre leichtgefallen, misstrauisch zu sein, die Frage aufkommen zu lassen, ob das CSO einen kleinen afroamerikanischen Jungen habe entmutigen wollen, der jeden erstaunt und den prestigeträchtigen Wettbewerb gewonnen hatte. Für einen Schwarzen, der in den USA der Vierziger und Fünfziger aufwuchs, gehörten die rassistischen Seitenhiebe zu einem Teil des Lebens. Doch schon mit elf Jahren tendierte ich dazu, mögliche Anzeichen von Rassismus zu ignorieren, statt ihnen Gewicht einzuräumen. Das lag einfach in meiner Natur.