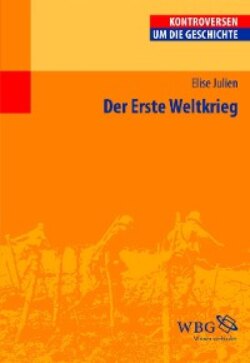Читать книгу Der Erste Weltkrieg - Élise Julien - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Zur Geschichtsschreibung
ОглавлениеIn diesem Zusammenhang sollte die Darstellung des Ersten Weltkrieges nicht den Historikern vorbehalten sein. Seit nun bald einem Jahrhundert sind selbst diese nie von politischen Agenden und sozialen Forderungen vollkommen getrennt geblieben. Nichtsdestotrotz sind die Geschichtswissenschaftler unentbehrlich, denn letztlich können sie den Konflikt greifbar machen. Schon die bloße Masse der geschichtswissenschaftlichen Veröffentlichungen zeigt ihr beharrliches Bemühen, diese Herausforderung anzunehmen. Sie ist aber zugleich auch ein Zeichen für die Schwierigkeit dieser Aufgabe. Schon die seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts angesammelten Schriften zu diesem Thema haben immense Ausmaße angenommen, doch heute sind allein die in jedem Jahr neu erscheinenden Veröffentlichungen nicht mehr für einen einzelnen Forscher zu bewältigen.
Thematische Felder und historiographische Konstellationen
Dennoch können angesichts dieses unermesslichen Ausmaßes an Publikationen Tendenzen und maßgebliche Veränderungen über die quantitativen Fluktuationen hinaus festgestellt werden. So fällt es leicht, die thematischen Felder der Kriegsforschung zu benennen, die jeweils militärische, diplomatische, politische, wirtschaftliche, gesellschaftliche oder kulturelle Dimensionen und Aspekte betonen. Darüber hinaus ist es möglich, nach Antoine Prost und Jay Winter aus den geschichtswissenschaftlichen Untersuchungen zum Ersten Weltkrieg drei unterschiedliche, sich zeitlich ablösende Konstellationen der Historiographie herauszuarbeiten (99).
Die erste Konstellation entspricht dem „militärischen und diplomatischen“ Ansatz, der ab dem Ausbruch des Krieges sowohl von politischen und militärischen Führungsakteuren als auch von Essayisten und professionellen Historikern erarbeitet worden ist. Dieses Konzept ist durch historiographische Themen gekennzeichnet, die im Zusammenhang mit der Politik stehen, besonders mit der Frage der Kriegsschuld. Bei diesem Ansatz wird die Geschichte des Krieges unter einem nationalen Gesichtspunkt untersucht. Kritische Methoden werden angewandt, um eine eigene legitime Argumentation zu erzielen. Daher klammert sich dieser Ansatz an die am besten nachprüfbaren Ereignisse, um den Krieg letztlich „von oben“ zu untersuchen und dabei der Gesellschaft und den Soldaten wenig Platz einzuräumen.
Die zweite Konstellation ist durch eine „soziale“ Herangehensweise gekennzeichnet und entwickelte sich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Unter dem diffusen Einfluss des Marxismus und angesichts eines steigenden Interesses des Publikums an der Geschichtsforschung verbreiterte sich die Sichtweise der Historiker. So wechselte der Fokus von den Generalstäben zum alltäglichen Leben der Soldaten, von den Diplomaten zu den Zivilisten und auch zu den Arbeitern. Dieses Kriegsbild ist demnach nachhaltig von wirtschaftlichen und sozialen Fragestellungen beeinflusst.
Ausgehend von dieser zweiten Herangehensweise und aufgrund des fortschreitenden Wandels der Interessengebiete hat sich eine dritte Konstellation der Geschichtsschreibung herausgebildet, die sich deutlicher auf „kulturelle und soziale“ Themen und Probleme konzentriert. Dieser Übergang verlief unkompliziert, da die Kulturgeschichte seit langer Zeit nicht nur Teil der Sozialgeschichte war, sondern sich sogar in der Politikgeschichte fand. Im Rahmen der Kulturgeschichte geht die historische Kriegsforschung „von unten“ aus, indem sie sich auf individuelle Einzelfälle fokussiert, um Erfahrungen zu beschreiben und auf unterschiedliche Weise darzustellen. Darüber hinaus untersucht dieser Ansatz die persönlichen und intimen Erfahrungen des Krieges, die durch Gewalt und Trauer entstandenen Verhaltensweisen, aber auch Mentalitäten, Repräsentationssysteme oder Faktoren der Mobilisierung und Demobilisierung der Bevölkerung. Diese kulturgeschichtliche Beschäftigung mit Konflikten ist auch heute noch aktuell.
Doch auch wenn diese drei Konstellationen aufeinanderfolgen, hebt die jeweils jüngste die ältere nicht auf, denn jede Herangehensweise behält ihre Berechtigung. Es handelt sich vielmehr um einen thematischen Ausdehnungsprozess, bei dem die Forschungsthemen immer vielfältiger geworden sind und dabei immer breitere Untersuchungsfelder erfasst haben. Diese inhaltliche Erweiterung ist von einem chronologischen Ausdehnungsprozess begleitet worden, bei dem sich die Forschung auf den Zeitraum vor dem Beginn des Krieges ebenso fokussiert (vorhergehende Konflikte, Militärstrategien, Kriegsvorstellungen) wie auf die Periode nach seinem Ende (unterschiedliche Formen der Demobilisierung, Kriegsausgang, Trauer und generell die tiefen Spuren des Krieges in den Nachkriegsjahren).
Die Erweiterung des Spektrums der behandelten Probleme sowie die chronologische Ausdehnung haben einen tiefgehenden Erneuerungsprozess in der Kriegsforschung hervorgerufen, der sich seit etwa dreißig Jahren vollzieht. Er hat dazu geführt, dass Historiker sich auch selbstkritisch fragen, auf welche Art und Weise Geschichtsforschung in diesem Themengebiet betrieben wird. Als beispielhafte Symptome dieser kollektiven Reflexion können die diversen Enzyklopädien genannt werden, die in den Jahren nach der Jahrtausendwende erschienen und sich dem Ersten Weltkrieg widmen. Jedes dieser Werke beansprucht für sich, eine Synthese des bisherigen Forschungsstandes, eine Bilanz der gegenwärtigen Veränderungen sowie ein Panorama weiterhin ungeklärter Fragen zu bieten (54, 6, 58). Auf einer anderen Ebene bemühen sich auch Aufsätze, die Bilanz der langfristigen historiographischen Trends und der jüngsten Entwicklungen der Forschung zu ziehen (u.a. 11, 71, 65).
Ein Jahrhundert von Kontroversen
Hierbei wird deutlich, dass es der Forschung nach fast einem Jahrhundert nicht an Kontroversen fehlt. Solche Kontroversen folgen übrigens dem Ablauf der untersuchten Geschehnisse: Was sind die Gründe für den Konflikt? Wie kann der Kriegseintritt im Jahr 1914 erklärt werden? Woher rührten die Länge des Krieges und die Intensität der Gewalt? Warum haben einige Frontkämpfer den Befehlen gehorcht, während andere desertierten? Weshalb blieben die Friedensbeschlüsse so unsicher? Wie ist der Kult um die Kriegsgefallenen zu interpretieren?
Einige dieser Fragen lassen sich deutlicher durch eine bestimmte Teildisziplin der Geschichtswissenschaft – wie Militärgeschichte, Politikgeschichte, Wirtschaftsgeschichte oder Sozialgeschichte – beantworten als andere. Doch die Kontroversen spiegeln oft auch die Gegensätze zwischen unterschiedlichen historischen Forschungsweisen wider, wie die jeweilige Eignung des politischen oder kulturellen Ansatzes zur Erklärung eines Ereignisses oder Prozesses. Daher bleibt die Geschichte des Krieges offen für zukünftige Entwicklungen in der Forschung und ruft weiterhin leidenschaftliche Debatten hervor.
Die folgende Darstellung konzentriert sich auf die Geschichte des Krieges, auf seinen Verlauf und seine unmittelbaren Konsequenzen, auch wenn die letzte Frage des Buches die Perspektive auf das gesamte Jahrhundert ausdehnt. Hierbei wird der Krieg in seinen unterschiedlichen Dimensionen betrachtet, wobei auf Politik, Diplomatie, Militär, aber auch auf soziale, wirtschaftliche und kulturelle Aspekte eingegangen wird. Am Anfang eines Krieges und erst recht eines internationalen Konfliktes steht zwangsläufig mehr als ein einzelner Beteiligter. Es wäre daher absurd, sich im Folgenden auf eine einzige nationale Geschichtsschreibung zu beschränken. Daher ist das Buch weder auf deutsche Quellen begrenzt noch auf französische (aufgrund der Staatsangehörigkeit der Autorin), englische, amerikanische (auch wenn die verwendete Bibliographie weitestgehend angelsächsisch ist) oder sonstige Quellen. Der hier genutzte breite Ansatz ist aufgrund des internationalen historiographischen Dialoges sinnvoll, auch wenn dies nicht ausschließt, dass manche Fragen in einigen Ländern oder Milieus in bestimmten Zeiträumen besonders intensiv gestellt und bearbeitet worden sind. Letztlich ist es die transnationale Herangehensweise, die es erlaubt, solche Abweichungen zu erfassen.
1 Unter ihnen sind: Erich Kästner, letzter Veteran der deutschen Armee, starb am 1. Januar 2008; Lazare Ponticelli, letzter Veteran der französischen Armee, starb am 12. März 2008; Franz Künstler, letzter Veteran der österreichisch-ungarischen Armee, starb am 27. Mai 2008; Delfino Borroni, letzter Veteran der italienischen Armee, starb am 26. Oktober 2008; John Babcock, letzter Veteran der kanadischen Armee, starb am 18. Februar 2010; Frank Buckles, letzter Veteran der amerikanischen Armee, starb am 27. Februar 2011; Claude Choules, letzter Veteran der britischen Armee, starb am 5. Mai 2011. Siehe: http://dersdesders.free.fr/presentation.html.