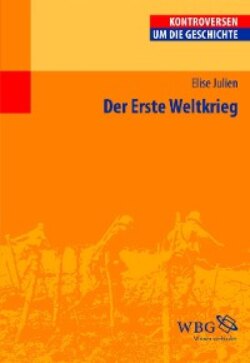Читать книгу Der Erste Weltkrieg - Élise Julien - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Der Kriegsverlauf, an der Front und in der Heimat
Оглавление1914 sagten die Prognosen aufgrund der eingesetzten Mittel – die Ausdruck der modernen Kriegsführung waren – einen kurzen Krieg voraus. Überall gründete die militärische Strategie auf dem einfachen Prinzip der Offensive, die in der entscheidenden Schlacht zügig den Sieg bringen sollte. Die offensiven Planungen scheiterten jedoch schnell: An der Westfront wurde die französische Armee im Elsass und in Lothringen zum Rückzug gezwungen, während die deutschen Streitkräfte in der Schlacht an der Marne aufgehalten wurden. An der Ostfront wurde die russische Armee Ende August in der Nähe von Tannenberg zurückgehalten, und die Österreich-ungarischen Streitkräfte mussten sich in Galizien zurückziehen.
Von dem Bewegungskrieg zum Stellungskrieg
Die ersten Wochen des Konflikts verursachten dennoch enorme militärische Verluste. Die Invasionswellen hatten massive materielle Zerstörungen und Übergriffe auf die Zivilbevölkerung zur Folge, sowohl während der deutschen Invasion in Frankreich und Belgien als auch während des russischen Einmarsches in Ostpreußen. Solche Ereignisse verstärkten die Notwendigkeit, den Krieg zu exportieren, um solche Zerstörungen und Gräueltaten auf dem Heimatterritorium zu verhindern. Dieses Vorhaben wurde während des gesamten Kriegsverlaufs aufrechterhalten und durch die Einrichtung von Besatzungs- bzw. besetzten Gebieten umgesetzt, deren Aufteilung für die Mittelmächte vorteilhaft war.
Die Westfront stabilisierte sich nach den ersten Monaten zwischen den erschöpften Armeen zum Herbstende 1914. Um die Stellungen besser halten zu können und dem gegnerischen Vordringen Einhalt zu gebieten, vergrub sich jede Armee in Schützengräben. Was ursprünglich als Provisorium gedacht war, mutierte zu einem dauerhaften und modernen Befestigungssystem zur Verstärkung der Verteidigung. Der Krieg wandelte sich damit zum Stellungskrieg, der den Konflikt enorm verlängerte.
Vorrang der Offensive
Die Führungsstäbe blieben jedoch vom Vorrang der Offensive überzeugt. Dies äußerte sich in den von Joffre initiierten großen Operationen vom Jahresende 1914 bis Ende 1915 (Artois, Champagne, Argonne). Demgegenüber sicherte die deutsche Feuerkraft die defensiven Möglichkeiten der Reichswehr. Da die Westfront blockiert war, konzentrierte sich die deutsche Oberste Heeresleitung auf die Ostfront, um den russischen Feind auszuschalten: Die Offensive Hindenburgs in der Region der Masurischen Seen (Februar 1915) war dafür bezeichnend. Im Herbst 1915 scheiterte diese Strategie jedoch und die Ostfront stabilisierte sich ihrerseits. Um die Initiative im Westen zu übernehmen, stieß Falkenhayn 1916 die Schlacht von Verdun an, deren Stahlgewitter bis Dezember andauerte. Im Juli desselben Jahres setzten die Alliierten die Schlacht an der Somme in Gang, wo der Widerstand der deutschen Truppen den Kampf bis November 1916 verlängerte. Der Durchbruch an der Front war für den Sieg weiterhin unumgänglich. Noch im April 1917 versuchte Nivelle dieses Vorhaben umzusetzen, als er eine Offensive in der Aisne (auf dem Chemin des Dames) auslöste. Die Briten beriefen sich ebenfalls auf diese Idee, um im Sommer 1917 einen neuen Angriff auf den Norden der Front in Passchendale in der Nähe von Ypern zu initiieren. Diese Initiativen wurden mit hohen Verlusten bezahlt, obgleich der Durchbruch auf der einen wie auf der anderen Seite der Front immer noch nicht erreicht wurde. Erst im Herbst 1917 hatten die deutsch-österreichischen Truppen gegen die Italiener in der Nähe von Caporetto mehr Glück, und im Frühling 1918 erreichten die Deutschen die Verschiebung der Westfront durch die Kaiserschlacht, vor dem Beginn der alliierten Sommeroffensiven.
Industrieller Krieg
Über all die Jahre war dieser fast bewegungslose Krieg ein industrieller Krieg, der auf immer massiveren Bombardierungen vor den Offensiven beruhte; es handelte sich außerdem um einen Abnutzungskrieg, da die Personalstärke und die Ressourcen eines jeden Landes durch die neuen Formen des Kampfes immer mehr aufgerieben wurden. Dieser neue Kriegstyp verlangte den Streitkräften materielle und technologische Anpassungen ab. Von den ersten Kriegsmonaten an wurde die Ausrüstung der Soldaten zugunsten einer funktionaleren Bekleidung und eines besseren Schutzhelms verändert. In der Infanterie wurden Granaten allgemein gebräuchlich. In der Artillerie entwickelte sich das Maschinengewehr zur Verteidigungswaffe, und Kanonen wurden perfektioniert (Verlängerung der Schussweite, Vergrößerung der Kaliber, Abgabe von Parabelschüssen zur Erreichung der gegnerischen Gräben). Ab April 1915 wurden Gaswaffen eingesetzt und auch Flammenwerfer, die auf die „Säuberung“ des Gebiets ausgelegt waren; zudem nutzte man während der Schlacht an der Somme erstmals Panzer. Schließlich wurde die Luftwaffe für die Beobachtung sowie für die Bombardierung der gegnerischen Frontlinien und Heimatzonen zunehmend unentbehrlich.
Seekrieg
Darüber hinaus spielte der Seekrieg eine entscheidende Rolle für das Gleichgewicht der Kräfteverhältnisse und dessen Entwicklung während des Konflikts. Die britische Regierung nutzte ihre maritime Überlegenheit, um eine besonders restriktive Blockade zur Lähmung Deutschlands und seiner Verbündeten zu erreichen. Angesichts eines langen Krieges wollte die deutsche Regierung diese Einkreisung durchbrechen, dabei jedoch möglichst keine neutralen Staaten brüskieren: Daher zögerte sie bei der Wahl zwischen Vergeltungsmaßnahmen und Vorsicht. Ende 1916 favorisierte die deutsche Oberste Heeresleitung die Wiederaufnahme des U-Boot-Krieges, dieses Mal in uneingeschränkter Weise, der Wilhelm II. im Januar 1917 zustimmte. Obgleich der uneingeschränkte U-Boot-Krieg zunächst spektakuläre Ergebnisse erreichte (gemessen an den versenkten Tonnagen), erleichterte er zugleich den Kriegseintritt der Vereinigten Staaten im April 1917, die ihre wirtschaftlichen Interessen durch den Stopp ihrer Handelsschiffe für den Export schwerwiegend gefährdet sahen. Dieser Kriegseintritt äußerte sich in der Bereitstellung der amerikanischen Handelsflotte für die Alliierten, während zugleich effiziente Methoden gegen die Versenkung umgesetzt wurden. Im Sommer 1917 schien der U-Boot-Krieg nicht mehr den deutschen Sieg zu ermöglichen und zog gravierende Folgen nach sich: Ab dem Frühling 1918 traf eine große Anzahl amerikanischer Soldaten in Europa ein.
Erfahrungen der Frontkämpfer
Die Erfahrungen der Frontkämpfer des Ersten Weltkriegs variierten je nach räumlicher und zeitlicher Nähe zur Front und je nach Zuordnung in die Truppengattungen. Dabei sticht jedoch der Schrecken der Schützengräben heraus, dem die meisten Soldaten ausgesetzt waren: Die Lebensbedingungen waren fürchterlich und die Gefahr allgegenwärtig. Nichtsdestotrotz beteiligten sich die Soldaten mehr als vier Jahre an dem Krieg. Ihr auffälliges Durchhaltevermögen hat zahlreiche Debatten hervorgerufen. Historiker haben zur Erklärung dieses Durchhaltevermögens verschiedene gegensätzliche oder auch komplementäre Faktoren ausgemacht: von der patriotischen Motivation der Frontkämpfer über ein Netzwerk von Zwängen, die Anpassungsfähigkeit der Soldaten bis zur Kraft von sozialen Interaktionen in der Armee sowie zwischen der Front und der Heimat (Forschungsproblem 3).
Mobilisierung der Gesellschaften
Der neue, seit 1914 geführte Kriegstyp implizierte außerdem, dass alle Ressourcen der kriegsbeteiligten Nationen dem Ziel der Kriegsführung bis zum Sieg untergeordnet wurden. Der Sieg war also nicht nur ein militärisches Ergebnis, sondern hing von den politischen, wirtschaftlichen, sozialen und moralischen Mobilisierungsfähigkeiten der Gesellschaften ab. Für die Bevölkerung in der Heimat richtete sich die Präsenz des Krieges nach ihrer Position im Verhältnis zur Front. In Europa war der Krieg in allen Aspekten des Alltagslebens spürbar. Die Regierenden bemühten sich, die innere Sicherheit ebenso aufrechtzuerhalten wie die nationale Verteidigung, indem sie eine autoritäre Funktionsweise politischer Institutionen und eine strenge Informationskontrolle anstrebten. Darüber hinaus wurde ihnen die Versorgung der Bevölkerung abverlangt, trotz der kriegsbedingten Umwälzung von Versorgungs-, Produktions- und Verteilungsketten. Mit der Dauer des Konfliktes wuchsen die Versorgungsmängel, vor allem bei Nahrungsmitteln und Energieträgern, so dass diese rationiert werden mussten. Zugleich hieß es die Akzeptanz der Bevölkerung für die Rationierung zu schaffen, um Revolten vorzubeugen. Folglich waren die Gesellschaften in der Heimat keine passiven Einheiten; vielmehr handelte es sich um regelrechte Heimatfronten, die ebenfalls für den Konflikt mobilisiert wurden.
Die Effizienz der Mobilisierung wurde anhand von materiellen Kriterien gemessen: Finanzierung, Umfang der Waffenproduktion sowie Grad der Versorgung der Streitkräfte und der Bevölkerung. Die Konzentration auf diese Aspekte implizierte eine Neuausrichtung der nationalen Ökonomien und eine Neuverhandlung sozialer Verhältnisse (u.a. zwischen sozialen Schichten, den Geschlechtern und Generationen). Trotz der Orientierung auf die genannten materiellen Kriterien kam es zu zahlreichen Streiks (vor allem ab 1917, als die Kriegsmüdigkeit anstieg) und zum Kriegsende gar in einigen Ländern zu Revolutionen. Seither bemaß sich die Effizienz der Mobilisierung auch am gesellschaftlichen Zusammenhalt gegenüber dem Konflikt. Dieser Zusammenhalt stärkte die Mobilisierung eines jeden Bürgers in seiner Arbeit und seiner Freizeit und forderte ihn im Sinne einer Aufopferung dazu auf, den in Kriegszeiten nötigen Verzicht zu akzeptieren. Allerdings war dieses beachtenswerte Durchhaltevermögen der Gesellschaften im Kriegsverlauf nicht konstant, was zumindest teilweise die Siege und Niederlagen in den einzelnen Schlachten erklärt. Fasst man den Krieg mit Lenin als Beschleuniger der Geschichte auf, erklären die Variationen im Durchhaltevermögen außerdem die in Europa ausbrechenden Revolutionen.
Die Historiker stehen sich in der Erklärung der Mobilisierungsabläufe entgegen: Einige ziehen kulturelle Grundlagen als Erklärung für die Zustimmung der Bevölkerung heran, während andere die komplexen Verhandlungsprozesse des fragilen Nationalkonsenses hervorheben (Forschungsproblem 4).