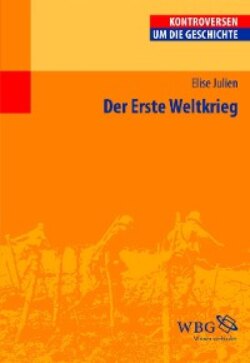Читать книгу Der Erste Weltkrieg - Élise Julien - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. Der Erste Weltkrieg heute
ОглавлениеSo wichtig dieser Krieg für das 20. Jahrhundert auch war, wird er in seinen Auswirkungen zu Beginn des 21. Jahrhunderts als abgeschlossen betrachtet. Der 100. Jahrestag des Kriegsbeginns steht bevor, während die letzten Veteranen der jeweiligen Länder inzwischen verstorben sind.1 Im Laufe des 20. Jahrhunderts schoben sich zahlreiche Ereignisse zwischen den Ersten Weltkrieg und unsere Gegenwart, angefangen mit dem Zweiten Weltkrieg, der den vorherigen aufgrund seiner Ausbreitung, des Grades der Mobilisierung der kriegsteilnehmenden Gesellschaften, der Zerstörungskraft der Waffen und der Anzahl der Opfer sogar noch übertraf. Später, zu Beginn der neunziger Jahre, verschwand mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion eine der größten Folgeerscheinungen des Ersten Weltkriegs auf politischer, ideologischer und geopolitischer Ebene. Zudem scheint in den letzten Jahren die europäische Integration schrittweise zu einem Ende der Nationalstaaten zu führen, zumindest im Vergleich zum 19. und dem Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Erinnerungen an den Ersten Weltkrieg müssten daher eigentlich allmählich verblassen, während im geschichtlichen Rückblick die Analyse des Konfliktes durch den Abstand erleichtert werden sollte.
Präsenz des Krieges
Allerdings scheint aufgrund eines kuriosen geschichtlichen Winkelzuges das genaue Gegenteil der Fall zu sein. Der Erste Weltkrieg widersteht seinem zeitlichen Verfall und ist in der gegenwärtigen westlichen Gesellschaft erstaunlich präsent. So exhumierte die australische Regierung noch im Jahr 1993 die Leiche eines unbekannten Soldaten im Beisein einer Delegation von über 90-jährigen Veteranen auf einem Soldatenfriedhof in Frankreich und überführte den Leichnam des Gefallenen ins Australian War Memorial in Canberra, in dem er beigesetzt wurde. Auch die Feierlichkeiten anlässlich des 11. November in Paris und in London erinnern in jedem Jahr daran, wie sehr das Kriegsende in beiden Staaten in Erinnerung bleibt und welche Emotionen dieses Datum noch immer in der Bevölkerung hervorruft. Auf den angelsächsischen Soldatenfriedhöfen der Westfront trifft man zudem noch heute Enkel oder Urenkel, die Pilgerreisen zur Grabstätte ihrer gefallenen Vorfahren unternehmen. Schließlich verdeutlicht das Ausmaß der Gedenkveranstaltungen zum 90. Jahrestag des Kriegsbeginns und Kriegsendes (2004 bzw. 2008), das an den bevorstehenden 100. Jahrestagen (2014 bzw. 2018) mit einem noch größeren Interesse und imposanten Veranstaltungen gerechnet werden kann.
Sicherlich sind diese Gedenkveranstaltungen ein eindeutiges Zeichen für die Präsenz des Ersten Weltkriegs in der Öffentlichkeit, zumindest in den westlichen Gesellschaften. Denn in Osteuropa gilt dieser Krieg gemeinhin als der „vergessene Krieg“ (104, 49). In diesen oft ethnisch gemischten Räumen hatten sogenannte Ko-Nationale auf beiden Seiten der Front gekämpft; dies machte es schwierig, die gefallenen Soldaten als Helden bzw. Opfer für die eigene Nation in Anspruch zu nehmen. Des Weiteren wurden dort in Gestalt von Staatsgründungskriegen, Grenz- und Bürgerkriegen die militärischen Auseinandersetzungen nach 1918 mit großer Erbitterung fortgesetzt, sodass im nationalen Gedächtnis der betroffenen Völker diese Kämpfe tiefere Spuren hinterließen als der Weltkrieg.
Im Westen jedoch geht das Interesse für diesen Konflikt über bloße Erinnerungsveranstaltungen hinaus. Es findet sich auch in vielen anderen Bereichen, insbesondere in verschiedensten kulturellen Werken wie Romanen, Comics, Filmen, Theateraufführungen, aber auch in plastischen Kunstwerken oder Pop- und Rock-Musik, die vom Schlamm der Schützengräben, den Sturmangriffen und Meutereien erzählen. Ebenfalls finden heutzutage unzählige Vereinsaktivitäten in der Umgebung der ehemaligen Frontlinie statt. Nicht zu vergessen sind auch die vielen Hobby-Historiker, deren Interesse an einzelnen militärischen Einheiten bis zur Gestaltung von eigenen Internetseiten oder der Eröffnung eines Privatmuseums reicht, oder die Ahnenforscher, deren Recherchen zu den Kriegserfahrungen ihrer Vorfahren sich oft in der Veröffentlichung der Notiz- oder Tagebücher dieser Kriegsteilnehmer niederschlagen. Solche Tätigkeiten nähren wiederum den Zustrom von Touristen zu den historischen Schlachtfeldern, deren Interessen öffentliche Institutionen durch die Schaffung von „Gedenkwegen“ (chemins de mémoire) oder Rundgängen aufzunehmen versuchen. Alle diese Aktivitäten zeigen die gesellschaftliche und kulturelle Bandbreite auf, in der sich die Nachfahren der Beteiligten passend zu ihren persönlichen Beweggründen an den Ersten Weltkrieg erinnern können (95).
Dem steht die Geschichtsschreibung zu diesem Thema in nichts nach. Sie findet in einer Vielzahl von unterschiedlichen Formen statt: durch die Gründung von Forschungsgruppen und -zentren, die Eröffnung neuer Museen über den Krieg sowie durch Ausstellungen in Archiven, Heimat-, Geschichts- oder Kunstmuseen. Darüber hinaus nimmt diese Geschichtsschreibung die Form von Publikationsinitiativen, die nicht nur aus dem akademischen Bereich stammen, sondern auch aus der sogenannten öffentlichen Geschichte (public history) (36), deren Dynamik an dieser Stelle hervorgehoben werden soll.
Schließlich drückt sich die Allgegenwart des Ersten Weltkriegs auf vielfältige, nicht nur geschichtliche Weise aus. Vielmehr bündeln sich rückblickende, politische, geschichtliche, literarische und künstlerische Aspekte, die sich widersprechen oder sogar gegenseitig verstärken und somit zu einer spektakulären Rückkehr des Krieges in das allgemeine Bewusstsein führen. Trotz des zeitlichen Abstandes ist der Krieg damit gegenwärtig alles andere als ein vergangenes Thema.
Eine relativ neue Erscheinung
Diese Präsenz des Ersten Weltkriegs ist umso erwähnenswerter, als sie in der Vergangenheit nicht immer so deutlich war. In der Zeit zwischen den beiden Kriegen kam es zwar zu einem wahrhaftigen Erinnerungskult, der oft mit der Verehrung der Kriegsgefallenen einherging, denn die Soldaten durften nicht ohne Grund gestorben sein. Entweder sollten die Gefallenen dabei gerächt werden oder es sollte im Gegenteil der kommenden Generation durch das Gedenken der Opfer ein erneuter Krieg erspart und der Frieden gefördert werden. Jedoch scheiterten diese Bemühungen mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. In den fünfziger Jahren, im Schatten der zweiten Katastrophe, die ein noch schlimmeres Ausmaß hatte, wurde der Erste Weltkrieg dann aus dem öffentlichen Bewusstsein verdrängt. Nunmehr waren die Helden der Epoche die Kämpfer des Widerstandes gegen den Nationalsozialismus, gegen die Faschisten und Kollaborateure. Während der sechziger und siebziger Jahre blieb das öffentliche Interesse größtenteils weiterhin auf den Zweiten Weltkrieg gerichtet, auch wenn nunmehr verstärkt die Opfer des nationalsozialistischen Genozids in den Vordergrund rückten. In diesen Jahren nahm auch die Kritik an den patriotisch-affirmativen Erinnerungsnarrativen zu. Während die Kriegsveteranen des Ersten Weltkriegs alterten, wurden die Gedenkstätten zu Orten des Spotts und des Aufbruchs. Auch Veröffentlichungen über diesen Konflikt trafen nur auf eine schwache Resonanz. Erst in den achtziger und mehr noch den neunziger Jahren kehrte in den westlichen Gesellschaften das öffentliche Interesse am Ersten Weltkrieg zurück.
Gründe einer solchen Präsenz
Es stellt sich die Frage nach den Gründen für diese Rückkehr, denn eventuell erweisen sich die bislang als gegeben betrachteten Faktoren für die Abwendung vom Ersten Weltkrieg als illusorisch. Ende des 20. Jahrhunderts nämlich schien Europa wieder in aggressive, nationalistische Auswüchse in denjenigen Gebieten zu verfallen, von denen sich der sowjetische Kommunismus zurückgezogen hatte. So gewann „Sarajevo“, wo das Attentat auf den österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand 1914 den Ersten Weltkrieg ausgelöst hatte, 1992 eine tragische Aktualität: Der Kriegsausbruch im ehemaligen Jugoslawien rief Erinnerungen an die Balkankonflikte von 1912–1913 hervor sowie an die europäische Krise im Juli 1914, die zum ersten weltumspannenden Krieg geführt hatte. Die radikale Gewalt, durch die der Konflikt in Jugoslawien gekennzeichnet war, ließ daraufhin den Eindruck der Rückkehr eines Krieges aufkommen.
Die Rückkehr der Erinnerung an den Ersten Weltkrieg hat sich wohl auch aus dem Ende von Emanzipationsutopien ergeben. Um 1990 haben der Fall der kommunistischen Regime, die aufgrund wirtschaftlicher Probleme zunehmend desillusionierte sozialdemokratische Politik in den westlichen Wohlfahrtsstaaten und auch die abnehmende gewerkschaftliche, gesellschaftliche und politische Einflussnahme einen Rückgang zukunftsorientierter Narrative bewirkt. Dieses Richtungsdefizit hat sicherlich den Blick in die Geschichte verstärkt, um anhand der gemeinsamen Erinnerung den Aufbau einer neuen Gesellschaft zu erleichtern. Teile dieser gemeinschaftlichen Geschichte fanden dabei größere Resonanz als andere. So stellte der Erste Weltkrieg aus vielfältigen Gründen eine wirkungsvolle Ressource dar: Weil er alle sozialen Klassen betraf, weil er das gesamte Volk gegen einen gemeinsamen Feind vereinte, weil er eine gemeinsame Erfahrung der kriegführenden Völker war, weil er zweifellos ein Drama darstellte und nunmehr zurückblickend Ansätze anbot, sich als Opfer oder auch als Held zu betrachten. Der Erste Weltkrieg kontrastiert dabei mit dem Zweiten Weltkrieg, der im Gegenteil tiefe Spaltungen innerhalb der Völker hervorrief und seit den neunziger Jahren viel selbstkritischer erinnert wird.
Schließlich stieß das soziale Interesse an der Vergangenheit besonders im Bereich des Ersten Weltkrieges mit persönlichen Anliegen zusammen. Da der Konflikt unzählige Familien in den einst kriegführenden Gesellschaften getroffen hat, kann jeder Einzelne seine eigene Familiengeschichte in einem übergreifenden historischen Kontext betrachten und so die individuellen Schicksale in einem größeren Rahmen sehen. Dabei kann es sich sowohl um die großen, symbolträchtigen Schlachten als auch um den Alltag in den Schützengräben handeln. Umgekehrt betrifft die „große Geschichte“ dieses Krieges aufgrund des familiären Kontextes immer auch die Nachkommen der Akteure des letzten Jahrhunderts. Da sich die Präsenz des Ersten Weltkriegs besonders aus seinen Opfern erklärt, ist das Gedenken des Krieges somit gegenwärtig vielleicht wohl der Ausdruck eines kollektiven und individuellen Trauerns, das noch immer „unvollendet“ ist (2).
Zusammenfassend lässt sich demnach ein bemerkenswertes Paradox feststellen: Auf der einen Seite gewinnen wir wegen des zunehmenden zeitlichen Abstands und der Fülle der historischen Forschungen eine immer größere Distanz zum Ersten Weltkrieg. Auf der anderen Seite jedoch scheint sich der Krieg angesichts gegenwärtiger Ereignisse und aus einem sozialen Bedürfnis heraus uns anzunähern, ohne dass sich diese beiden Vorgänge gegenseitig aufheben.