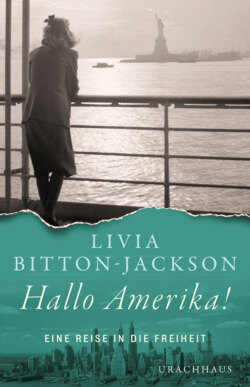Читать книгу Hallo Amerika! - Livia Bitton-Jackson - Страница 7
Mein erster Tag in Amerika
Оглавление»Oh Papa! Papa!«, kreische ich und werfe die Arme um den scheuen, fremden Mann, dessen Gesicht sich jetzt aus der Menge schält. Er hat hohe Wangenknochen, einen markanten Kiefer, haselnussbraune Augen. Er ist groß und schlank und hat breite Schultern. »Papa!« Ich kann die Tränen nicht zurückhalten. Wie sehr mir diese hohen Wangenknochen, der markante Kiefer, die haselnussbraunen Augen fehlen! Wie sehr ich diese breiten, athletischen Schultern vermisse! Oh, Papa! Ich kann immer noch nicht glauben, dass du niemals mehr aus dem Dunst auftauchen wirst, in dem du ohne Abschied verschwunden bist. Ich kann nicht glauben, dass du für immer von uns gegangen bist. Für mich wird deine Rückkehr auf ewig ein Wunschtraum bleiben.
Mein Ausbruch erschreckt alle um mich herum, und ganz besonders den großen, schlanken Mann mit den haselnussbraunen Augen. Es ist Papas Bruder, der meine Umarmung über sich ergehen lässt und sich dann mit einem verlegenen Hüsteln hinter eine äußerst imposante Frau stellt. Das muss Tante Lilly sein, die Frau meines Onkels. Sie sieht anders aus als auf den Fotografien, die in diesen blauen Briefumschlägen aus Amerika kamen. Auch wenn sie eine unglaubliche Lebensfreude ausstrahlt, verschwindet ihr Lächeln jetzt, und ihre Augen füllen sich mit Tränen.
Mein Übereifer bringt in unsere erste Begegnung genau das, was wir zumindest am Anfang unbedingt vermeiden wollten: dass das Unaussprechliche ausgesprochen wird. Tante Lilly unternimmt den ersten Schritt zu einer Schadensbegrenzung. Sie wischt sich die Tränen ab und breitet in einer großen Willkommensgeste die Arme aus.
»Laura! Elli! Willkommen in Amerika.«
Für Mutter ist es ein Wiedersehen nach über zwanzig Jahren. Sie hat meinen Onkel und meine Tante das letzte Mal getroffen, noch bevor Onkel Abisch mit Frau und kleinem Sohn aus Europa weg nach Amerika ist. Die beiden Frauen – Mutter eher groß, schlank und leicht gebeugt, Tante Lilly eher klein und etwas füllig – halten sich an den Armen, mustern sich genau, suchen nach Anzeichen der vergangenen Jahre und fallen sich schließlich in die Arme.
»Gott sei Dank, dass ihr da seid. Wie haben schon ewig gewartet«, ruft Tante Lilly, um das Stimmengewirr zu übertönen.
»Wie seid ihr denn am Sabbat hierhergekommen?«, fragt Mutter ganz erstaunt.
»Zu Fuß. Unsere Wohnung ist in Gehweite. Hoffentlich seid ihr nicht zu müde für den Spaziergang. Aber er wird die Mühe wert sein, Laurie und Ellike. Ein gutes Sabbatmahl erwartet euch bei uns zu Hause«, sagt Tante Lilly mit fröhlichem Augenzwinkern.
Ein Sabbatmahl! Das Wort erreicht mich durch einen Nebel aus Müdigkeit, Aufregung und jahrelanger Distanz. Eine Einladung zum Sabbatmahl – wie lange ist das her? Wann haben wir etwas so Festliches, so herzerwärmend Irdisches zum letzten Mal erlebt? Etwas so Schönes?
»Was machen wir mit dem Gepäck?«, fragt Mutter.
»Vielleicht könnt ihr die Sachen bis zum Ende des Sabbat bei den HIAS-Leuten lassen. Dein Cousin Tommy kann dann später herfahren und sie holen.«
Die HIAS-Mitarbeiter sind wirklich so freundlich, das Gepäck bei sich aufzubewahren, woraufhin Mutter und ich unseren Gastgebern aus der stickigen Empfangshalle hinaus in den strahlenden Sonnenschein folgen.
Ein Spaziergang durch die Straßen von New York! Es kommt mir vor, als würde ich auf Wolken gehen. Die Schlichtheit der Lower East Side kann dem Glanz dieses Augenblicks nichts anhaben: Der Gang vom Hafen zur Wohnung meiner Verwandten in der Avenue D bleibt einer der aufregendsten, denkwürdigsten Momente meines gesamten Lebens.
Aber ich bin neugierig. Wo ist das großartige, reiche Amerika, von dem ich schon so viel gehört habe? Wo sind die breiten Straßen, die chromblitzenden Schlitten, die Himmelskratzer oder die auffällig gekleideten Amerikaner, die ich aus Filmen kenne?
»Dieser Teil der Stadt ist nicht sehr repräsentativ für Amerika. Und auch nicht für New York selbst«, erklärt Bubi. »Keine Sorge, Leanyka. Du wirst die Hochhäuser, Straßen und grell angezogenen Leute schon noch sehen«, verspricht er. »Schon bald wirst du alles sehen – und alles erleben«, fügt er in väterlichem, fast schon neckischem Ton hinzu. Auch wenn ich mich an den nur allzu gut erinnere, ist es schön, wieder einmal Leanyka, kleines Mädchen, genannt zu werden. Nach so vielen Jahren.
»Das ist eine riesige Stadt, eine Metropole. Man braucht Zeit und Geduld. Bist du denn immer noch so ungeduldig, oder besser: ungestüm wie früher?«
Mami geht mit Tante Lilly und Onkel Abisch voraus. Mein unverzeihlicher Ausbruch am Kai hat ein Loch in den Damm gerissen, und die Fragen – brennende, besorgte Fragen – bahnen sich jetzt ihren Weg. Bubi und ich gehen hinter den anderen her und können verfolgen, was da an Furchtbarem, aber Unvermeidlichem gesprochen wird. Alle drei sind leicht nach vorn gebeugt – Mami in Erwartung der Fragen, und die anderen, die amerikanischen Verwandten, in Erwartung der Antworten.
Onkel Abisch und Tante Lilly waren seit dem Ausbruch des Krieges im Jahr 1939 vollkommen von ihren Familien abgeschnitten. Und als der Krieg dann aus war und in aller Welt wieder Kontakt aufgenommen werden konnte, mussten sie feststellen, dass es gar keine Familie mehr zum Kontaktieren gab. Alle Verwandten von Tante Lilly waren umgekommen. Für Onkel Abisch, dessen Mutter, Bruder, Schwester und Schwager mitsamt ihren fünf Kindern umgebracht wurden, sind wir – die Witwe seines toten Bruders und ihre beiden Kinder – alles, was er noch an Familie hat. Nur wir können als lebendige Zeugen, als verkohlte, vom Feuer verschonte Überreste, von den Geschehnissen berichten.
Beim Gehen fällt Bubi in seine alte Rolle des großen Bruders, des Lehrers, der für mich ultimativen Quelle des Wissens. Zuerst gibt es eine Lektion in örtlicher Geografie. Er erklärt, dass New York aus fünf Boroughs, also Stadtteilen, besteht, und nennt ihre Namen – Manhattan, Brooklyn, Bronx, Queens und Richmond beziehungsweise Staten Island.
»Jetzt sind wir gerade in Manhattan. Tante Celia und Onkel Martin wohnen in Brooklyn.«
Tante Celia ist Mamis Schwester. Bei ihr und ihrem Mann werden wir wohnen, wenn wir Onkel Abisch und Tante Lilly besucht haben.
»Ich weiß. Bis wir eine eigene Wohnung haben, können wir bei ihnen wohnen, also in Brooklyn. Aber ist es wirklich so, dass man einen Pass braucht, um von Manhattan nach Brooklyn zu kommen?«, frage ich. »Mami und ich haben keinen Pass. Offiziell sind wir ›staatenlos‹.«
»Wer hat dir denn erzählt, dass man dazu einen Pass braucht?«, fragt Bubi überrascht.
»Der Kapitän von unserem Schiff. Er hat gesagt, dass Brooklyn Ausland ist. Dass man extra eine Brücke überqueren muss und dafür eben einen Pass braucht.«
»Das hat er im Ernst gesagt?«, kichert Bubi. »Schwesterchen, glaub mir: Er hat dich nur veräppelt. Brooklyn gehört zu New York City, genau wie Manhattan. Das mit der Brücke stimmt, weil Manhattan eine Insel ist. Egal wohin man will, es kommt immer zuerst eine Brücke. Auch in die Bronx. Oder nach Queens.«
»Der Captain hat gemeint, das sei ›kidding‹«, gestehe ich meinem Bruder. »Aber ich wusste nicht, was es heißt.«
Wir erreichen die Wohnung meines Onkels und meiner Tante. Sie ist klein, aber schön geschnitten und makellos sauber. Der Esstisch ist schon eingedeckt: ein Damasttischtuch, darauf feinstes Porzellan, Silberbesteck und Kristallgläser. Und es riecht herrlich nach einem traditionellen Sabbatmahl.
Mein Cousin Tommy, der einzige Sohn von Onkel und Tante, trifft jetzt mit Freunden der Familie ebenfalls ein. Die Goldsteins kommen ursprünglich auch aus Ungarn und begrüßen uns freudig. Ihre beiden halbwüchsigen Töchter, dreizehn und fünfzehn Jahre alt, tragen Lippenstift und Schuhe mit hohen Absätzen! Obwohl sie so jung aussehen, sind sie wie erwachsene Frauen angezogen.
Wir setzen uns zu unserem festlichen Sabbatmahl. Tante Lilly serviert eine erstaunliche Vielfalt an Gerichten – Gefilte Fisch, Hühnersuppe, Roastbeef, Kugel, Tscholent und Schnitzel –, alles in feinsten Porzellanschüsseln angerichtet. Aus geschliffenen Gläsern trinken wir Wein, Selters oder Bier. Und der Nachtisch – Apfelstrudel und Tee – kommt auf kleinen Extratellern und in hauchdünnen Porzellantässchen.
Mein Gott. In Amerika ist die Zeit stehengeblieben. Unglaubliche Mengen von Essen, das ohne viel Nachdenken verzehrt wird. Ein richtiger Überfluss an Nahrung und Getränken – der als selbstverständlich erachtet wird! Hier war kein Krieg. Hunger, Lebensmittelrationierung … all das gab es hier nie. Der Abgrund zwischen Vorher und Nachher ist einfach nicht vorhanden. Edles Porzellan, Silberbesteck, schönes Teegeschirr, eine Tischdecke aus Damast. Die Alte Welt, die Welt des Vorher, die uns verloren ging und jetzt einem Nimmer-Nimmerland angehört, ist in Amerika Gegenwart. In der Neuen Welt erfreut sie sich bester Gesundheit!
Wo gehöre ich hin? Werde ich den Abgrund zwischen diesen beiden Wirklichkeiten jemals überbrücken? Werde ich den amerikanischen Luxus je genießen können, ohne mich an Not und Elend zu erinnern und ein schlechtes Gewissen zu haben? Werde ich mich jemals daran gewöhnen, den Überfluss so beiläufig wie die Amerikaner zu genießen? Kann ich wirklich einmal werden wie sie?
»Mom, der Riemen an meinem linken Schuh ist gerissen«, sagt die ältere der Goldstein-Töchter.
»Das ist aber blöd«, meint ihre Mutter. »Die sind doch ganz neu. Ich habe sie passend zu deinem Kleid gekauft.«
»Was soll ich machen? Ohne Riemen kann ich nicht gehen!«, ruft das Mädchen verzweifelt.
»Gleich am Montag kaufe ich dir neue«, verspricht die Mutter, was das Mädchen zu beruhigen scheint.
»Kannst du den Riemen nicht flicken lassen?«, frage ich.
»In Amerika reparieren wir die Dinge nicht«, erklärt mir Frau Goldstein. »Wenn etwas kaputt geht, kauft man etwas Neues.«
»Gibt es hier denn keine Schuster?«
»Die sind eher selten, und eine Reparatur ist teuer. Manchmal ist es billiger, wenn man etwas Neues kauft. Oder auch etwas ganz anderes.«
»Und was passiert mit dem, was kaputt ist?«
»Man wirft es weg.«
»Wirft es weg?«, rufe ich erstaunt. Man wirft ein Paar Schuhe weg, nur weil ein Riemen gerissen ist? Ich sehe mir unter dem Tisch die Schuhe an. Es sind wunderschöne Pumps aus cremefarbenem Leder. Hätte ich doch nur so elegante Schuhe! Ich würde sie selbst reparieren. Mit ein paar Stichen wäre der Riemen wieder angenäht. Wirklich eine Schande!
Ich bin völlig schockiert. Das ist Amerika? Halbwüchsige Mädchen, die Lippenstift und hochhackige Schuhe tragen! Cremefarbene Lederpumps, die man wegen eines gerissenen Riemens wegwirft!
Wie mag sich sein anfühlen, wenn man für jedes Kleid ein passendes Paar Schuhe hat? Wie viele Schuhe haben diese Mädchen denn? Ich war bislang glücklich über das eine Paar, das ich hatte … auf ewig dankbar, dass sie passen … stets in Gedanken an die Schuhe, die ich in den Todeslagern tragen musste, an die Schmerzen bei den endlosen Märschen – in Schuhen, die zwei Nummern zu klein waren.
Werde ich diese Schmerzen jemals vergessen? Werde ich aufhören, Gott für den Luxus bequemer Schuhe zu danken? Werde ich je wie ein amerikanischer Teenager sein und ein Paar gute Schuhe wegwerfen, nur weil sie einen winzigen Fehler haben?
Bitte, lieber Gott. Hilf mir, mich in Amerika zurechtzufinden.