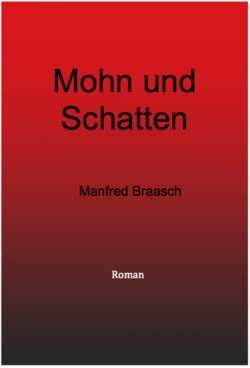Читать книгу Mohn und Schatten - Manfred Braasch - Страница 5
Wieder an den Tasten
ОглавлениеEs war der Tag nach der Europawahl. Der Mai entließ sich aus seiner kalendarischen Verantwortung mit einem überzeugenden blauen Himmel und ignorierte damit die politische Stimmung in vielen europäischen Hauptstädten. Bei der taz hamburg wurde vor allen das Abschneiden der rechtsradikalen Parteien diskutiert. Wilders in den Niederlanden, UKIP in Großbritannien, Goldene Morgenröte in Griechenland – unfassbar. In Frankreich avancierte der Fron National sogar zur stärksten Partei des Landes. Die Tochter eines ausländerfeindlichen Irrläufers inszenierte sich erfolgreich als Jeanne d´Arc der Neuzeit – einfach widerlich. Aber auch das Erstarken rechtspopulistischer Parteien in den wirtschaftlich stabilen skandinavischen Ländern ließ aufhorchen. Die Dänische Volkspartei war stärkste Kraft im Land geworden und in Schweden bekamen die sogenannten Schwedendemokraten viel Zuspruch vom Wahlvolk.
»Guten Morgen, Ladies und Gentleman – wir haben eine Wahl zu bewerten. Die Bundes- und Europaebene macht Berlin. Wir brauchen einen Bezug zu Norddeutschland, zu Hamburg. Also, gibt es Verbindungen beispielsweise der Goldenen Morgenröte nach Hamburg? Wie viele Griechen leben hier und was sagen diese zu den Wahlen in ihrem Heimatland, der Wiege der Demokratie? Wer ist Hamburgs französische Partnerstadt und wie hat der Fron National dort abgeschnitten? Was sagt Olaf Scholz dazu? Und gibt es vom SSW in Schleswig-Holstein eine Kommentierung zu den Ergebnissen in Kopenhagen?«
Redaktionsleiter Henning Haupt war voll in seinem Element, wirbelte wichtige Fragen in die Redaktionssitzung.
»Und wie sieht es in Hannover und Bremen aus, ich hoffe ihr seid schon wach?«
Mittlerweile waren auch die Kollegen aus Bremen und Hannover zugeschaltet, es gab ein kurzes Winken und ein Hallo über den Monitor aus Bremen und ein unverständliches Grunzen über die Telefonanlage aus Hannover. Die Videokonferenz klappte mit den Niedersachsen immer noch nicht – man beließ es notgedrungen seit Monaten beim Audio-Kontakt.
Henning Haupt verstand es immer wieder, sein Team zu motivieren, wenngleich in schlechten Zeiten sein Zynismus auch manchmal nerven konnte. Und schlechte Zeiten gab es bei der taz regelmäßig, die ökonomischen Rahmenbedingungen des Blattes waren immer angespannt. Zuwenig Genossen, zu wenig Abonnenten, zu wenig Anzeigenkunden. Aber Haupt war schon seit 17 Jahren bei der taz, war in Hamburg gut vernetzt und hörte das Gras meist früher als seine Kollegen vom Hamburger Abendblatt wachsen.
Henning übernahm heute auch den Job als CvD - Chef vom Dienst. Nachdem sie das Für und Wider einzelner Themen durchgesprochen hatten, ging er seine Notizen durch und legte die Verantwortlichen für die einzelnen Themen fest, für die sich bislang noch keiner zuständig fühlte.
»Ok, Martin übernimmt Scholz, Tanja die Griechen und Katharina die Dänen«.
Kurz war es still in der Redaktionssitzung. Der erste offizielle größere Auftrag an die Neue, direkt vom Chef. In den ersten Wochen fegten Volontäre üblicherweise die redaktionellen Brotkrumen auf. Katharina errötete leicht, nickte und schon ging das Palavern weiter. Kurze Zeit später verabschiedete man Bremen und Hannover, alles war geklärt, die Aufgaben verteilt.
Katharina kramte ihre Sachen zusammen und freute sich. Bislang hatte sie vor allem Themen mit wenig politischem Inhalt bearbeitet. Der Protest gegen das umstrittene Hamburger Busbeschleunigungsprogramm am Mühlenkamp war da noch die größte Sache gewesen. 150 Zeilen und erste anerkennende Blicke der Kollegen bei der Blattkritik am Folgetag.
Katharina Jensen hatte erst vor wenigen Wochen bei der taz nord ein Volontariat angefangen. Zu den üblichen links-alternativen und damit miesen Konditionen. Aber mit sehr netten Kollegen. Endlich hatte sie wieder die Kraft, das zu machen, was ihr manchmal wie eine Bestimmung vorkam. Schreiben.
Fast zwei Jahre war sie durch die halbe Republik gezogen, lebte erst einige Monate in Frankfurt, dann ging es nach Passau, Freiburg, schließlich Berlin. In all diesen Städten hatte sie sich mit Gelegenheitsjobs über die Runden gebracht, gekellnert, mal als Aushilfe in einer Tageszeitung gearbeitet, keine großen und vor allem keine auffälligen Sachen. Wut und Zorn, aber auch eine diffuse Angst waren ständige Begleiter seit den Ereignissen in Hamburg.
Das Gesicht von Walter Ramm tauchte nachts in ihren grauen Träumen auf. Immer wieder, auch heute noch. Vor zwei Tagen stand sie das erste Mal vor seinem Grab auf dem Friedhof Groß Flottbek in Hamburg. Ein schlichter Grabstein, ohne viel Tamtam, nur Geburts- und Todesjahr, das war´s. Das Grab sah gepflegt aus, frische Blumen in einer versenkten Vase. Hatte Ramm noch Eltern, war es die Tochter, von der er ihr mal erzählt hatte? Wie war noch ihr Name? Oder kümmerte sich seine Ex-Frau um die letzte Ruhestätte? Katharina wurde klar, wie wenig sie letztlich über Walter Ramm wusste. Spiegel-Journalist, Preisträger und Dozent an der Henri-Nannen-Schule. Aber was steckte noch hinter der investigativen Kämpfernatur, bei der sie sich für wenige Tage so geborgen gefühlt hatte. Sie würde es nie erfahren.
Sie hatte lange überlegt, ob es zu gefährlich sei, wieder nach Hamburg zurück zu kehren. Aufmerksam hatte sie aus der Ferne verfolgt, wie es in der Hansestadt nach Ramms Ermordung weiter gegangen war. Offiziell blieb es bei Herzinfarkt, die Redaktion trauerte um einen verdienten Kollegen, der so unverhofft aus dem Leben gerissen wurde. Aber Katharina war sich sicher, dass Walter Ramm an jenem Freitagnachmittag an der U-Bahnstation Hallerstraße ermordet worden war. Offenbar hatten Ramm und sie mächtige Männer aufgescheucht, die vor nichts zurück schreckten. Sie waren von einem äußerst gefährlichen Schatten bedroht und gejagt worden. Ein Mann, der aus dem Nichts auftauchte, in Wohnungen eindrang ohne die geringsten Spuren zu hinterlassen. Beauftragt, Katharina und Walter zum Schweigen zu bringen.
Als Katharina an jenem Nachmittag klar wurde, dass Walter etwas zugestoßen sein musste, hatte sie Hals über Kopf Hamburg verlassen. Sie fürchtete auch um ihr Leben und als sie zwei Tage später die Todesnachricht erreichte, wusste sie, dass sie instinktiv richtig gehandelt hatte. Sie brach alle Brücken ab und gab die Ausbildung an der Henri-Nannen Schule, um die sie so lange gekämpft hatte, auf. Sie erklärte niemanden in Hamburg irgendetwas, von heut auf morgen war sie einfach nicht mehr da. Wohnung und Konto kündigte sie von Frankfurt aus, wo sie mit viel Glück kurzfristig Unterschlupf gefunden hatte. Dann Wochen der Angst, jedes Telefonklingeln ließ sie zusammenschrecken. Irgendwann hatte sie aus dieser Angstspirale wieder herausgefunden. Und dann mühsam, aber mit dem wichtigen Gefühl ich bin wieder da, eine Botschaft auf den Weg gebracht. Sechs Monate nach ihrer Flucht aus Hamburg konnte sie über einen Bekannten bei der Frankfurter Rundschau einen Artikel über die Machenschaften des Pharmakonzerns SMP veröffentlichen. Unterzeichnet von Walter Ramm. Rache post mortem.
Der Artikel schlug einige Wellen, wenngleich deutlich weniger als Katharina erhofft hatte. Bei SMP wurden einige Baueropfer vor die Tür gesetzt, Vorstandschef Brandes blieb allerdings im Amt. Der Konzern versprach, die Forschung zum Wohle aller Diabetiker zu intensivieren und auch die Diabetesprävention stärker in den Fokus zu nehmen. Der Vorwurf, es hätte einen Mord gegeben, um Forschungsergebnisse zu verschleiern, die das milliardenschwere Diabetesgeschäft von SMP und anderen Konzernen in Frage stellte, war bei der Staatsanwaltschaft in Hamburg nicht auf fruchtbaren Boden gefallen. Noch nicht einmal Vorermittlungen wurden eingeleitet. Kein hinreichender Anfangsverdacht war in einer kurzen Internetnotiz nachzulesen. Und auch Walter Ramms ehemaliger Arbeitgeber strengte keine eigenen Nachforschungen an. Katharina war sich sicher, dass es eine Menge Leute gab, die in diesem Komplott verstrickt waren. Und die allesamt viel zu verlieren hatten. Man deckte sich gegenseitig, und sowohl der Mord an dem Diabetesforscher Professor Bünz als auch am Journalisten Walter Ramm blieben ungesühnt.
Einmal noch hatte Katharina mit Christl Bünz, der Frau des ermordeten Professors telefoniert. Sie hatten sich nur einmal persönlich getroffen, aber Katharina hatte die Hoffnung, dass sie in Christl Bünz eine Verbündete finden konnte. Sie wollte wissen, wie es dieser Frau ergangen war, ob sie die Polizei eingeschaltet hatte. Mehrere Male hatte sie in den ersten Frankfurter Wochen die Hamburger Telefonnummer in ihr neues Prepaid-Handy eingetippt, dann aber regelmäßig den Mut verloren. An einem Sonntagabend, draußen regnete es Bindfäden und in ihrem WG-Zimmer war es sehr still, hatte sie es dann doch getan.
Christl Bünz gab gar nicht erst vor, sich über den Anruf zu freuen. Sie antwortete auf die Fragen von Katharina resigniert, in denkbar kurzen, abgehackten Sätzen. Soweit Katharina verstand, hatte die Frau des Professors vergeblich auf neue Ermittlungen zum Absturz ihres Mannes in den Südtiroler Bergen gedrängt. Aber niemand glaubte ihr. Die Fakten seien eindeutig, man ginge davon aus, dass ihr Mann auf dem Altschneefeld ausgerutscht und so zu Tode gekommen sei. Es gebe keine neuen Zeugen und keine neuen Hinweise, basta. Christl Bünz hatte schließlich aufgegeben und trug sich nun mit dem Gedanken, nach Kanada zurück zu gehen. »Wo sind Sie und wie geht es Ihnen?«, hatte sie noch am Ende des Gespräches gefragt, aber das wusste Katharina seit Monaten selber nicht so recht.
Nach der Veröffentlichung ihres Artikels in der Frankfurter Rundschau fiel Katharina erneut in ein kurzes Angstloch. Doch nichts geschah, niemand tauchte bei ihr auf. Irgendwann ging es besser, Schlaf und so etwas wie Normalität stellten sich wieder ein. Schließlich glaubte Katharina nicht mehr, dass dieser Schatten-Mann noch hinter ihr her war. Nur hin und wieder, wie aus dem Nichts, erwischte sich Katharina dabei, wie sie sich abrupt umdrehte und das Gesicht jenes Mannes suchte, der ihnen in der Nacht vor Walters Tod die Konsequenzen ihrer Arbeit eindringlich klar gemacht hatte. Unsentimental, kalt, mit erschreckender Professionalität. Mit einem Warnschuss im wahrsten Sinne des Wortes hatte er es auf den Punkt gebracht: Wenn sie weitermachen und die Sache veröffentlichen, würden sie sterben. Und genau dies war mit Walter Ramm geschehen. Sie hatte überlebt – mit tiefen Narben auf ihrer Seele.
Es war kein zweites Leben, aber Katharina hatte wieder eine Aufgabe und ein Ziel. Und für heute hieß es, die Europawahl zu kommentieren. Sie setzte sich an den Rechner, überlegte kurz ihren Ansatz für den Artikel und ging auf die Homepage des Südschleswigschen Wählerverbandes, kurz SSW. Sie suchte nach aktuellen Kommentaren der Alphatiere, von Anke Sporrendonk oder Lars Harms. Da gab es offenbar noch nichts. Danach versuchte sie sich ein Bild zu machen, wer und was die Dänische Volkspartei eigentlich war und warum diese Gruppierung in dem kleinen sympathischen Nachbarland im hohen Norden so viel Zuspruch bekommen konnte.
Katharina lernte in den nächsten Stunden völlig neue Begriffe. So sei die Dänische Volkspartei von einem Wohlfahrtstaatschauvinismus geprägt. Merkwürdiges Wort, was so alles von der Politikwissenschaft an Wortschöpfungen kreiert wurde. Jedenfalls hatten es die Strategen der Dänischen Volkspartei geschafft, nationalistische und fremdenfeindliche Inhalte mit sozialdemokratischer Sozialpolitik zu einer besonderen Melange zusammen zu rühren und damit im bürgerlichen Spektrum wählbar zu werden. So war es der Partei gelungen, seit 2001 in verschiedenen Regierungskoalitionen oder unter Duldung von Minderheitsregierungen die dänische Einwanderungspolitik erheblich zu verschärfen. Das Abschneiden bei der aktuellen Europawahl würde der Partei mit Sicherheit neuen Auftrieb geben. Nationales und ausländerfeindliches Gedankengut sickerte Dank der Volkspartei in die gesellschaftliche Mitte Dänemarks und gewann an Legitimierung.
Katharina musste unweigerlich an die spannende und vielschichtige Politik-Serie Borgen – Verbotene Seilschaften denken. Aufgehängt an einer fiktiven charismatischen Politikerin – sehr überzeugend gespielt von Sidse Barbett Knudsen - zeigte dieser Mehrteiler, wie dänische Politik hinter den Kulissen funktionierte, wie Ideale wegen einer aktuellen Machtoption aufgegeben wurden und wie ein Spin-Doktor eine Regierung steuerte. Gerade diese Figur des Caspar Juul hatte es Kathrina angetan. Die Sendungen waren nie holzschnittartig, die Personen differenziert – ein tolles Format, das im letzten Herbst auf arte gezeigt wurde. Katharina hatte keine Sendung verpasst.
Katharina telefonierte kurz mit dem Pressesprecher des SSW, ja, ein schriftliches Statement von Anke Sporrendonk würde in Kürze ins Netz gestellt. Gut, damit hatte sie einen wichtigen Baustein für ihren Artikel. Katharina stolperte bei ihrer weiteren Recherche noch über etwas anderes. Der Hamburger Journalist Lars Meyer hatte vor zwei Jahren ein kurzes Portrait von Pia Kjærsgaard veröffentlicht.
Kjærsgaard hatte die Dänische Volkspartei mitgegründet und war bis 2012 ihre Parteivorsitzende gewesen. Die Dame hatte die Partei eisern geführt und unter anderem mit Hetzparolen gegen Muslime und einem Pfeffersprayangriff gegen eine Frau von sich reden gemacht. Lars Meyer, was für ein Zufall.
Katharina blickte aus dem Fenster. Ein paar schemenhafte Erinnerungen an Lars Meyer tauchten auf. Er war wie Walter Ramm Dozent bei Henri-Nannen gewesen. Ein eher stiller Typ, klassischer Schreibtischtäter mit einer zugegeben spitzen Feder. Doch im Grunde wusste sie nichts über diesen Kollegen.
Katharina zwang sich, wieder auf den Bildschirm zu schauen. Über Rechtsradikalismus in Dänemark gab es keine einheitliche und vor allem keine umfassende Informationslage. Reinhard Wolf, der Skandinavien-Korrespondent der taz, hatte 2011 einiges dazu geschrieben. Katharina überflog mit großem Interesse dessen Artikel. Offenbar hatte damals der dänische Verfassungsschutz Politiets Efterretningstjeneste, kurz PET, aufzeigen können, dass sich neue Gruppierungen und bislang unbekannte Logen formierten und versuchten, die nationale und rechtsradikale Szene Dänemarks neu zu organisieren. Die Gewaltbereitschaft war klar auf dem Vormarsch und die etablierten Parteien fanden kaum Antworten auf diese Entwicklung.
Katharina klickte sich wieder in ihren Text und schrieb in der nächsten halben Stunde wie in einem kreativen Rausch. Selbst der Kaffee in ihrem Lieblingsbecher wurde kalt. Letzter Schliff, hier noch eine andere Formulierung, das Zitat vom SSW machte sich gut, die Füllwörter raus. Fertig. Ein gutes Gefühl.