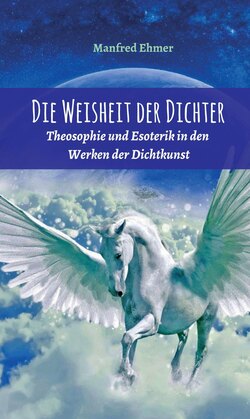Читать книгу Die Weisheit der Dichter - Manfred Ehmer - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDas Ramayana – Indiens
großes Märchen-Epos
Unter den Perlen der altindischen Literatur sticht das Ramayana (Sanskr. wörtl. „Der Lebenslauf des Rama“) besonders hervor, als eine einmalige Kulturleistung – ein großes, bunt schillerndes Märchen-Epos, das vom göttlichen Sonnenhelden Rama, seiner geraubten Gattin Sita und den rettenden Taten des Großen Affen Hanuman zu berichten weiß. Es ist eigentlich kein Göttermythos, sondern eher ein Helden-Epos, und zu einem Großteil einfach auch ein Märchen – allerdings ein monumentales Märchen, das sich in sieben Abschnitte oder Bücher („Kandas“) gliedert mit insgesamt 24.000 Doppelversen, damit wohl das längste Märchen aller Zeiten. Das Werk wird dem Weisen („Rishi“) Valmiki zugeschrieben, der jedoch nur eine legendäre Person ist; die ältere reinere Fassung stammt aus Nordindien aus dem 4. Jh. v. Chr., und es erfuhr in den folgenden Jahrhunderten in Bengalen wesentliche Veränderungen. Neben der Sanskrit-Version des Ramayana gibt es noch eine spätmittelalterliche Fassung des großen Epos in Hindi, die auf den gefeierten Dichter Tulsi Das (1541–1605) zurückgeht. Das Ramayana genießt heute in ganz Südostasien größte Verehrung.
Im Vergleich mit dem anderen großen epischen Dichtwerk Indiens, dem Mahabharata, scheint das Ramayana einer späteren Zeit anzugehören; wir finden in ihm eine voll entwickelte höfisch-feudale Welt orientalischen Stils dargestellt. Das Mahabharata mit seinem rauen Kriegertum ist archaischer, frühweltlicher; es erinnert an die Ilias des Homer im Vergleich zur späteren Odyssee. Das Ramayana ist im besten Sinn des Wortes höfische Kuntspoesie; es stammt aus dem klassischen Indien, und nicht aus einer legendären Frühzeit. Und zweifellos gehört das Ramayana auch zur Weltliteratur, obwohl es in Deutschland erst seit dem 19. Jahrhundert bekannt wurde, und zwar – anders als in England oder Frankreich – immer nur in Form von auszugsweisen Übersetzungen. Den Anfang machten natürlich die Gebrüder Schlegel, dann kam die Übersetzung von Friedrich Rückert, dann die von Adolf Holtzmann, die unter dem Titel Rama nach Walmiki 1841 erschien, aber nur eine Versübertragung des zweiten Buches war. So kann man sagen, dass das Ramayana in Deutschland nie richtig Fuß gefasst hat. Ganz anders die Wirkung des Epos in Asien: es gelangte von Indien aus nach Ceylon, in die Himalayaländer, nach Siam, Indochina und Insulinde; es findet sich im javanischen Schattenspiel ebenso wie in der Gründungslegende des Herrscherhauses von Thailand.
Im Mittelpunkt des Ramayana steht natürlich in erster Linie Rama selbst, der in den sieben Büchern zusammen mit seinem jüngeren Bruder Lakshmana und seiner Frau Sita sowie mit Unterstützung des weisen Affen Hanuman so manche „aventuire“ zu bestehen hat, nicht anders als später die Helden der höfischen Ritterromane des Mittelalters. Insbesondere hat er zahlreiche Dämonen, Feinde der Götter, zu bekämpfen; aber seine Hauptaufgabe besteht darin, den zehnköpfigen, zwanzigarmigen, proteusartig sich verwandelnden Dämonenfürsten Ravana zu besiegen, der mit einem gewaltigen Hofstaat auf der Insel Sri Lanka residiert. Eben dieser Ravana war es auch, der Ramas Frau Sita heimtückisch entführte, jene Sita, die einer Ackerkrume entsprang und so als eine Verkörperung der Mutter Erde gelten mag. Der Sieg über den Dämonen Ravana, durch die tatkräftige Unterstützung einer Affenarmee mit herbeigeführt, ist somit auch mit der Befreiung der in den Banden der Gefangenschaft liegenden Sita verbunden. So könnte dem Ramayana ein alter Vegetationsmythos zugrunde liegen: Rama als der göttliche Sonnen-Heros, der gegen das Dunkel kämpft; Sita als die Mutter Erde, die zur Frühjahrszeit aus den Ketten des Winterdämons Ravana befreit wird.
Und tatsächlich ist Rama mehr als bloß ein ins Übermenschliche gesteigerter Held; er gilt als die siebente Inkarnation des Gottes Vishnu auf Erden. Deshalb hat man das Ramayana als das „Evangelium des Hinduismus“ bezeichnet, weil es, wie das Johannes-Evangelium der Christen, von der Fleischwerdung des Wortes, von der Menschwerdung Gottes kündet. In diesem Sinne ist das Ramayana nicht nur Abenteuer-Roman, Märchen-Epos und ritterliche Helden-Erzählung, sondern in erster Linie Heilsgeschichte. Es setzt eine zyklische Folge von Avataren, göttlichen Verkörperungen auf Erden voraus, durch die sich ein Heilsplan zum Wohle der Erden-Menschheit vollzieht. Im Ramayana vermischt sich Transzendentes mit Historischem, Jenseitiges mit Innerweltlichem. Im Ersten Buch („Bala Kanda“) treten die Götter gemeinsam vor Vishnu hin, den obersten Gott, und bitten ihn, sich auf Erden als Mensch zu verkörpern und in dieser Gestalt den bösen Dämonen Ravana zu besiegen: denn nur ein Mensch vermag den allgewaltigen Ravana zu töten. Vishnu gibt den Wünschen der Götter nach und spricht:
„'O ihr Devas, fürchtet euch nicht. Friede sei mit euch. Um euretwillen will ich Ravana zerstören, zusammen mit seinen Söhnen, Enkeln, Ratgebern, Freunden und Verwandten. Und wenn ich diese schrecklichen und grausamen Dämonen erschlagen habe, diese Schrecken der göttlichen Weisen, will ich die Welt der Sterblichen elftausend Jahre lang regieren.' So gewährte Vishnu den Göttern ihren Wunsch, und dann überlegte er, wo er sich auf der Erde als Mensch gebären lassen sollte. Darauf beschloss der lotusäugige Gott, als die vier Söhne des Königs Dasharatha zur Welt zu kommen.“21 Nachdem Vishnu sich in Gestalt der vier Söhne König Dasharathas verkörperte, als Rama, Lakshmana, Bharata und Shatrugna, beschloss die Göttin Lakshmi, die Gemahlin Vishnus, sich als Sita zu inkarnieren, und zuletzt werden auch die Devas verkörpert, nämlich in Form einer gewaltigen Affenarmee, tapfere und mächtige Geschöpfe, die in der Zauberkunst genauso bewandert sind wie in der Kriegskunst. Die Affen unterstehen den beiden Brüdern Sugriva und Valin, Verkörperungen von Surya und Indra. So rüstet sich nun alles für einen geradezu endzeitlichen Kampf, eine Generalabrechnung zwischen Gut und Böse, worauf die elftausendjährige Periode eines „Goldenen Zeitalters“ folgen wird.
Im Lichte dieser endzeitlichen Ereignisse erweist sich Rama als eine fürwahr heilsgeschichtliche Gestalt. Edouard Schuré rechnet ihn zusammen mit Krishna, Thot-Hermes, Moses, Orpheus, Pythagoras und Platon zu den „Großen Eingeweihten“, und er sieht in ihm sogar einen legendären König aus arischer Frühzeit, der sein Volk aus den dichten Wäldern des Skythenlandes in das Herz Asiens, nach Iran und Indien, geführt habe. Glanzvoll soll seine Herrschaft in Indien gewesen sein: „Durch seine Kraft, seinen Genius, seine Güte, sagen die heiligen Bücher des Orients, war Rama der Beherrscher des Orients und der spirituelle König Europas geworden. Die Priester, die Könige und die Völker neigten sich vor ihm wie vor einem himmlischen Wohltäter. Unter dem Zeichen des Widders verbreiteten seine Sendlinge das arische Gesetz, das die Gleichheit der Sieger und Besiegten verkündete, die Abschaffung der menschlichen Opfer und der Sklaverei, die Ehrfurcht vor der Frau am Herd, den Kultus der Ahnen und die Institution der geweihten Feuer als sichtbares Symbol des ungenannten Gottes.“22
Am Ende des Treta-Yuga wird Rama nun als Verkörperung des Gottes Vishnu auf Erden inkarniert. Seine drei Brüder, alle Söhne des Königs Dasharatha, sind Teil-Inkarnationen desselben Gottes. Rama als der älteste Sohn soll das Königreich des Vaters erben, aber es kam anders. Seine Stiefmutter Kaikeyi zettelte nämlich ein Komplott an, indem sie Dasharatha dazu brachte, Rama für 14 Jahre in die Verbannung zu schicken und das Königreich ihrem Sohn Bharata zu übergeben. So wird denn Rama auf königlichen Befehl in den Wald geschickt, um dort ein asketisches Einsiedlerleben zu führen, wohin ihm sein jüngerer Bruder Lakshmana und seine ihm anvertraute Gattin Sita folgen. Selbst als Dasharatha stirbt und Bharata, der Rechte des wahren Thronfolgers eingedenk, auf das Königtum verzichten und es Rama übergeben will, besteht dieser darauf, im Wald zu bleiben und die 14 Jahre der Verbannung dort zu verbringen, wie es ihm aufgetragen war. Unbedingter Gehorsam also – ähnlich wie Sokrates, der den Giftbecher trank, obwohl er wusste, dass er zu Unrecht verurteilt wurde. In ihrer Wald-Einsiedelei haben Rama und seine Freunde indes viel damit zu tun, die Angriffe bösartiger Dämonen (und -innen), sogenannter Rakshasas, abzuwehren. Nachdem sie eine Dämonin, Shurpanaka, besonders verärgerten, ging diese zu ihrem Bruder, dem Dämonenfürsten Ravana, der in Lanka, der Hauptstadt der Insel Ceylon, wie ein Feudalherrscher residiert. Dieser ersann eine List: nachdem einer seiner Dämonen die Gestalt eines prächtigen Hirsches angenommen und die beiden Brüder hinweggelockt hatte, kam Ravana mit seinem fliegenden Wagen vom Himmel herab, ergriff Sita und führte sie hinweg nach Lanka, wo er sie in seinem Palast einsperrte.
Damit ist der Grundkonflikt der Erzählung hergestellt – Rama muss die geraubte Sita, sein weibliches Dual, seine bessere Hälfte, wiedergewinnen; und das kann er nur, indem er den bösen Ravana besiegt. Auf der Suche nach der verlorenen Sita findet Rama einen Bundesgeossen in König Sugriva. Durch Zufall und Geschick werden die beiden zusammengeführt, und sie verbünden sich. Sugriva ist der König eines mächtigen, kriegserfahrenen und zauberkundigen Affenstammes, und als oberster Ratgeber, Großwesir und General dient ihm Hanuman, ein Affe mit ganz ungewöhnlichen Fähigkeiten. Nachdem Rama dem vom Königsthron verstoßenen Sugriva geholfen hat, seine Herrschaft wiederherzustellen, stellt dieser für Rama eine gewaltige Affenarmee auf, mit dem Ziel, die gefangene Sita zu suchen und notfalls mit Gewalt zu befreien. Es gibt also Krieg – Krieg der Affen gegen die Dämonen, ähnlich wie einst der Krieg der Götter gegen die Asuras. Und er wird, wie Homers Kampf um Troja, um einer Frau willen geführt! Aus allen Teilen der Welt ruft der mächtige Sugriva die ihm botmäßigen Affenkrieger und Affenhäuptlinge zusammen, und eine unübersehbare, vieltausendköpfige Heerschar versammelt sich vor ihm auf dem Kampfplatz:
„In diesem Augenblick verdunkelte sich das Firmament, und ein Schleier fiel über den feurigen Glanz dieses tausendstrahligen Planeten; eine Staubdecke hing plötzlich über allen Gegenden, und die Erde mit ihren Bergen und Wäldern erzitterte. Die ganze Erde war mit unzähligen Affen übersät, die Menschenkönigen glichen und scharfe Zähne hatten und gewaltige Kraft. In der Zeit eines Augenzwinkerns versammelten sich diese Vortrefflichsten unter den Affen umgeben von ihren Truppen; zu Hunderttausenden kamen sie von den Flüssen, den Bergen, vom Meer und von den Wäldern, und sie barsten vor Kraft und brüllten wie Donner. (…..) Alle Affen der Erde versammelten sich um Sugriva herum, sie sprangen und tanzten und brüllten, und diese Springer umgaben Sugriva, wie eine Wolkenmauer die Sonne. Voller Mut und voll Kraft schrien sie immer wieder Beifall und neigten ihre Köpfe dem König der Affen zum Gruß. Andere Armeeführer näherten sich dem König brauchgemäß und stellten sich mit zusammengelegten Händen neben ihn, und Sugriva stand in höchster Ergebung vor Rama, unterrichtete ihn über die Ankunft der Affen und sprach darauf zu seinen Generälen, die vor Eifer brannten: 'O ihr Affenhäuptlinge, stellt eure Truppen pflichtgemäß auf dem Berg auf, nahe den Bächen im Wald, und jeglicher zähle sie genau.'“23
Diese gewaltige Affenarmee macht sich nun auf die Suche nach Sita, zuerst erfolglos, aber dann greift der Geierkönig Sampati ein, der den Affen sagt, wo Sita verborgen ist. Die Affen marschieren daraufhin nach Süden, in Richtung Sri Lanka, aber als sie zuletzt an der Südspitze des riesigen indischen Subkontinents ankommen und dort das große tosende Meer vor sich sehen, verlieren sie gänzlich den Mut. Wie dieses gewaltige Meer überqueren? Wie den Stürmen, Meerungeheuern, Riesenfischen trotzen? Sie finden keinen Ausweg. Bis schließlich Hanuman als Retter aus der Not erscheint, der sich erbietet, über das Meer zu springen, um auf der Insel nach dem Verbleiben Sitas zu forschen. Ein solcher Luftsprung war wohl der größte, der je vollbracht wurde, aber Hanuman ist durchaus kein gewöhnlicher Affe. Als Sohn des Windgottes Pavana verfügt er über die Fähigkeit des Fliegens; auch kann er seine Körpergröße ändern, vom Zwergenwuchs bis zur Riesengröße, und außerdem jede beliebige Gestalt annehmen. In vielen Teilen Indiens wird er als ein Gott verehrt. Außer der Arzneimittellehre und der Medizin beherrscht Hanuman die Grammatik und viele andere Wissenschaften einschließlich der Poesie. Im Ramayana nimmt er zunehmend neben Rama die Stelle des Zweithelden ein, ja das ganze Unternehmen zur Befreiung Sitas ist von seinem Erfolg abhängig.
Hanumans Sprung über das Meer – er wird im Fünften Buch des Ramayana („Sundara Kanda“) in epischer Breite geschildert. Um ein Beispiel indischer Erzählkunst zu geben, soll diese Episode einmal in aller Ausführlichkeit zitiert sein. Sprungbereit steht der fluggewaltige Affengott auf dem Gipfel eines nahe am Meer aufragenden Bergmassivs, der ihm als Absprungschanze dienen soll. Er bereitet sich vor auf den gewaltigsten Sprung aller Zeiten:
„Eine riesige Gestalt nahm er an, denn er wollte das Meer überqueren, und er presste den Berg mit Händen und Füßen, dass der unbewegliche Gipfel unter seinem Gewicht erzitterte und die Blüten von den Wipfeln der Bäume herabregneten und ihn mit einer Decke von duftenden Blumen bedeckten. Unter dem gewaltigen Druck dieses Affen schoss aus dem Berg Wasser hervor wie Saft aus den Schläfen eines brüstigen Elefanten. Gepresst von diesem mächtigen Waldbewohner entließ der Berg unzählige Ströme von Gold und Silber und Korrylium aus seinen Felsen, riesige Steinblöcke lösten sich, die waren mit rotem Arsen durchsetzt, und der Berg glich einer rauchenden Kupferschmiede. (….) Und dieser Affe ließ seine Arme anschwellen wie zwei Keulen und gürtete seine Glieder; und duckte sich und spannte Nacken und Arme an und sammelte all seine Kraft und all seinen Mut. Den kommenden Weg prüfte er, und die Entfernung, die er überwinden musste, schätzte er ab; tief holte er Luft, fest presste er die Füße auf die Erde, dieser Elefant unter den Affen, und Hanuman legte die Ohren an und sprang vor (….). Und er sprang so gewaltig, dass die Zweige der Bergbäume sich schüttelten und nach allen Seiten wirbelten. In seinem pfeilschnellen Flug riss Hanuman diese Bäume mit ihren blühenden Zweigen und liebesberauschten Kiebitzen mit und schleuderte sie zum Himmel hinauf. Fortgerissen durch den Stoß seines ungeheuerlichen Sprungs folgten ihm die Bäume wie Verwandte ihrem Liebling auf eine Reise in ferne Länder ein Stück weit begleiten. (….) Mit einem Schaum bunter Blumen bedeckt glich dieser fliegende Affe einer lichtdurchglänzten dichten Wolke, und das Meer, durch seinen Sprung blütenüberhäuft, sah aus wie das Firmament beim Erscheinen der zauberischen Sterne. Beide Arme hatte er in die Luft ausgestreckt, zwei fünfköpfige Schlangen, ausgehend vom Gipfel eines Berges. Bald schien es, als ob der Affe das Meer selbst mit seinen vielfältigen Wellen, bald so, als ob er den Himmel tränke. Wie er da so dem Pfad des Windes folgte, blitzten seine Augen und glitzerten wie zwei entzündete Bergfeuer. Die Augen dieses Lohfarbenen glichen Sonne und Mond nebeneinander, und seine kupferne Nase färbte seine ganze Gestalt wie Staub die Sonne beim Untergang.“24
Hier bekommt man einmal einen Eindruck von der Erzählkunst des Ramayana, von der epischen Breite, der Farbigkeit, Plastizität, der Lust an der Ausschweifung, der Wiederholung, der arabeskenhaften Verzierung, mit der die Handlung dieses gigantischen Epos geschildert wird, das gewiss das längste Märchen aller Zeiten ist. Hanuman jedenfalls, über das Meer gesprungen, kommt am anderen Ufer an, auf Sri Lanka, dem Zauberreich des mächtigen Ravana, und dort begibt er sich unerkannt in die Hauptstadt, die er durchsucht, er trifft schließlich Sita, gefangen in einem Hain von Ashokabäumen, der er ihre baldige Befreiung prophezeit. Er lässt sich sogar von Ravanas Dämonen gefangen nehmen, entkommt ihnen aber, legt noch die Hauptstadt in Brand und kehrt zu den Seinen zurück. Nun steht dem Heereszug gegen Ravana nichts mehr entgegen. Geführt von Rama, Lakshmana, Sugriva und Hanuman zieht die Armee der Affen, wohl die größte Armee aller Zeiten, wenn wir den Worten des Erzählers glauben wollen, der Entscheidungsschlacht entgegen. Um das Meer zu überqueren, baut man unter Anleitung des Affenhäuptlings Nala aus Felsbrocken und Baumstämmen eine Brücke (Ramasetu, Sanskr. wörtl. „Ramas Brücke“), über die das Heer nach Ceylon gelangt.
Der Rest des Epos kann stark verkürzt berichtet werden. Natürlich gelingt es Rama, Lanka einzunehmen, Ravana zu töten und Sita zu befreien. Lange wogte die Entscheidungsschlacht hin und her. Endlich kann Rama mit Indras Pfeil das Herz des Dämonenfürsten durchbohren, nachdem seine Köpfe wie die der Hydra stets nachgewachsen waren (Indras Pfeil – ein Symbol für den Sonnenstrahl? Rama als göttlicher Sonnenheld?). Man glaubt schon an ein glückliches Ende, aber dann geschieht das Unglaubliche – Rama verstößt Sita wegen angeblicher Untreue. Wie kann ein Mensch, der als die siebente Inkarnation des Gottes Vishnu auf die Erde kam, derartig fehlgehen? Wie kann er sich so der Eifersucht, dem Misstrauen, dem falschen Stolz hingeben? Aber Rama weiß gar nicht, dass er ein inkarnierter Gott ist; er hält sich für einen gewöhnlichen Menschen. Da erscheint ihm der Gott Brahma und klärt ihn darüber auf, wer er tatsächlich ist: „Du hast die Welt mit drei Schritten begangen, du hast den schrecklichen Bali gefesselt und Mahendra zum König gemacht. Sita ist Lakshmi, und du bist der Gott Vishnu, Krishna und Prajapati. Um Ravana zu erschlagen, hast du dich in einen menschlichen Leib inkarniert. Den Auftrag, den wir dir gaben, hast du erfüllt, o du Vortrefflichster Pflichtenerfüller. Ravana ist gefallen, steige nun froh in den Himmel hinauf! Unwiderstehlich ist deine Macht, und deine Taten sind niemals umsonst.“25
Sita, um ihre Unschuld zu beweisen, besteigt einen Scheiterhaufen, bleibt aber unversehrt, da Gott Agni sich weigert, sie zu verbrennen. Vereint mit Rama, kehren beide in Ravanas fliegendem Prunkwagen Pushpaka nach Aryodya zurück, in die Hauptstadt ihres Reiches, wobei Rama seiner Gemahlin die Gegenden erklärt, die sie überfliegen. In Aryodya erhält Rama von seinem jüngeren Bruder Bharata das Königreich, das dieser bislang treuhänderisch regiert hatte, und wird zum König gekrönt. Von nun an regiert er 11.000 Jahre lang ein Reich des immerwährenden Glücks und Friedens, ein „Goldenes Zeitalter“, in dem es kein Leid und keinen Kummer gibt. Damit geht der Schluss wieder ganz ins Eschatologische, Heilsgeschichtliche über. Ist das Ramayana eigentlich ein Märchen? Bloß weil Riesen, Ungeheuer, Dämonen, sprechende Tiere darin vorkommen? Oder ist es Götterdichtung? Heldenerzählung? Oder vielleicht der erste Fantasyroman der Weltliteratur? Es ist all dies und noch mehr als dies. Für den frommen Hindu ist es ein „Evangelium“, das von der Menschwerdung Gottes kündet. Für uns einfach eine einmalige Kulturleistung, ein Abenteuerroman voll esoterischer Weisheit.