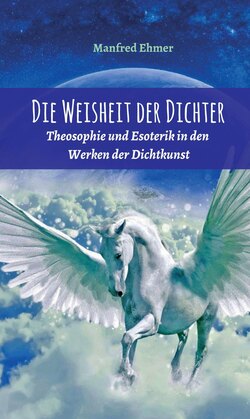Читать книгу Die Weisheit der Dichter - Manfred Ehmer - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDer Sonnengesang des
Pharao Echnaton
Seine Nachfolger nannten ihn den „Ketzerkönig“ und versuchten, seinen Namen aus der Erinnerung zu tilgen, Spätere sahen in ihm einen religiösen Reformator, den größten Ägyptens vielleicht, und einen Vorkämpfer des Monotheismus – Pharao Echnaton (1364–1347 v. Chr.), der unter dem Namen Amenophis IV. den Thron bestieg, bleibt eine der umstrittensten Figuren der uns bekannten Kulturgeschichte. In einer nur 12jährigen Regierungszeit hat er wie kein anderer eine geistige Revolution bewerkstelligt, indem er alle bisherigen Götter stürzte, ihren Kult verbot und einzig die Verehrung der als göttlich gedachten Sonnenscheibe Aton zuließ. Diese Reformation war eine „Revolution von oben“ ohne Zweifel, per Dekret erlassen und der jahrtausendealten ägyptischen Kultur künstlich aufgepfropft, ohne Rücksicht auf langandauernde Traditionen; darum erreichte die neue Religion die Volksmassen nicht und vermochte auch die mächtige Priesterschaft nicht zu entmachten: Echnaton musste scheitern, denn er spielte ein Spiel gegen die Zeit. Er war jedoch der erste für uns historisch fassbare Denker, der die gesamte Natur und Menschenwelt aus einem einzigen schöpferischen Prinzip zu erklären versuchte, wie viele Jahrhunderte nach ihm die ionischen Naturphilosophen, die – mit Thales angefangen – alles Werden aus einem Weltprinzip zu erklären versuchten.
Erklärten die Ionier die Welt aus einem Urelement, wahlweise das Wasser, die Luft, das Unendliche oder zuletzt das Feuer, so war für Echnaton einziger und absoluter Bezugspunkt eine so abstrakte Größe wie das Licht, verkörpert durch die Sonne, der er seinen berühmten Sonnengesang widmete. Eine reine Religion des Lichts war die Kunstreligion Echnatons, immateriell und unanschaulich, streng monistisch, und ohne jede Spur von Symbolik oder Metaphysik. Denn die sichtbare Sonne galt Echnaton nicht etwa als Symbolbild Gottes, sie war vielmehr Gott selbst, ohne Form und Gestalt, nur das reine Licht, wie es die glühende Scheibe am Himmel ausstrahlt. Also eine Religion ohne Bilder, ohne Götterstatuen, ohne die gewohnten vermenschlichten Göttergestalten, rein intellektuell und lichtorientiert. Dass eine solche Religion nie populär werden konnte, schon gar nicht in einem mit Mystik und Magie so tief vertrauten Land wie Ägypten, leuchtet ein. Dennoch hat Echnaton mit seiner von oben verordneten Reformation deutliche Wegmarken gesetzt und tiefere Spuren in der Kulturgeschichte Ägyptens hinterlassen als jeder andere Pharao vor ihm; er drückte einer ganzen Epoche seinen einmaligen Stempel auf und prägte eine Zeit, die noch bei uns heute als Armarna-Zeit bekannt ist.
Die Verehrung der Sonne als Gottheit geht in Ägypten in älteste Zeiten zurück. Ursprünglich ohne festen Kultort, rein am Naturphänomen der Sonne selbst ausgerichtet, wuchs im unterägyptischen On-Heliopolis der Kult des Sonnengottes Re schon früh mit dem des Hauptgottes Atum zusammen; mit dem Beginn der 5. Dynastie (2475-2345 v. Chr.), auf die Zeit der großen Pyramidenerbauer folgend, rückte Re an die Spitze aller Götter und wurde unter Umwandlung des Königsdogmas als leiblicher Vater der Könige angesehen. Eine solarkultische Theokratie hatte sich also unter dem Schutzmantel der Re-Religion herangebildet. Seit der 11. Dynastie (ab 2160 v. Chr.) nun zeigte sich die Tendenz, den mit der neuen Hauptstadt machtvoll aufgekommen neuen Reichsgott Amun mit dem Sonnengott Re gleichzusetzen, sodass Amun-Re im Neuen Reich zur wichtigsten Götterfigur werden konnte, und seine Priesterschaft sich zu einer Art „Staat im Staate“ entwickelte. In ständige Konkurrenz mit der Re-Religion trat allerdings der weitaus volkstümlichere Osiris-Kult, der in erster Linie ein reiner Jenseitskult war und das Bild des Totengerichts in den Mittelpunkt stellte.
Schon Echnatons Vorgänger zeigten die Neigung, den allmächtigen Amun-Kult von Theben zurückzudrängen und zur ursprünglichen Sonnenreligion zurückzukehren. Amenophis III., Echnatons Vater, der eine bürgerliche Frau Teje geheiratet hatte, war in religiösen Dingen ungebundener. Vor allem in späteren Jahren begann er, sich vom traditionellen Amunglauben abzuwenden und die althelio-politanische Form des Re-Kultes zu bevorzugen. Die Bezeichnung Aton für die sichtbare Sonnenscheibe taucht unter seiner Regentschaft erstmals auf, ja es gab wohl schon eine regelrechte Aton-Verehrung, die allerdings noch nicht in Konkurrenz mit den herkömmlichen Göttern trat und insofern keinen Anlass für Auseinandersetzungen bot. Ein Aton-Hymnus aus der Zeit Amenophis III. besingt den Sonnengott wie folgt: „Man hat deine Strahlen vor Augen und weiß es nicht. Selbst Gold gleicht nicht deinem Glanz. Du fährst über den Himmel und alle Menschen schauen dich, und doch ist dein Glanz vor ihnen verborgen. Preis dir, du Aton des Tages, der alle Wesen geschaffen und ihnen Lebensunterhalt geschenkt hat.“26
Es war vielleicht der Wunsch nach einer einheitlichen, universalen, völkerverbindenden Religion, jenseits aller Lokalkulte, die dieser neuen Aton-Frömmigkeit zugrunde lag, vielleicht auch die Sehnsucht nach einer persönlichen, unmittelbaren, nicht mehr durch Priester vermittelten Gotteserfahrung, die an die Stelle des bisherigen starren Priesterkultes treten sollte. An das Vorbild dieser älteren Aton-Bewegung konnte Echnaton anknüpfen. Neu ist bei ihm allerdings die Art, wie er mit aller Vergangenheit radikal bricht. Selbst seinen Namen Amenophis ( = Amon-hotep, der dem Amun gefällt) legte er ab, um sich stattdessen Achenaten zu nennen ( = Der dem Aton nützt); der Kult der vielen Götter in den Tempeln wurde verboten, die Namen der geächteten Götter mit dem Meißel aus den Statuen, Obelisken, Wandreliefs ausgetilgt – es war eine gigantische Bilderstürmerei, vergleichbar nur den Bilderverwüstungs-Orgien fanatischer Protestanten während der Reformation. Schließlich verließ er auch die alte Hauptstadt Theben und verlegte die Residenz weit nach Süden, wo aus dem unberührten sandigen Boden in kurzer Zeit eine neue Sonnenstadt emporgezogen wurde mit Namen Achet-Aton ( = Horizont des Aton); heute befindet sich in der Nähe der Ruinenstadt nur noch ein kleines Beduinendorf namens Tell el Amarna.
In den Gräbern der Vornehmen aus der Amarna-Zeit finden wir den berühmten Sonnenhymnus des Echnaton als Wandinschrift eingemeißelt. Er ist ein einmaliges Stück Dichtung aus dem Nilland, das die Jahrtausende überdauert hat; ob er auch als liturgischer Kultgesang einer Aton-Gemeinde gedient hat, mag dahingestellt bleiben. Dieser einmal angestimmte Sonnengesang verhallt nie mehr, er klingt nach im 104. Psalm der Bibel, in Franz von Assisi's Sonnengebet und in moderner Zeit in Hölderlins Hymnus an den Äther. Wie in der bildenden Kunst die Aton-Sonnenscheibe mit Strahlen dargestellt wird, die in gebende Hände auslaufen, so erscheint in diesem Hymnus die Sonne als die All-Gebende, der Mensch, Tier und Natur ihr Leben verdanken:
Strahlend steigst du auf am Rand des Himmels,
Aton, der du lebst seit Anbeginn.
Du wanderst empor und erfüllest
Die Welt mit deiner Schönheit.
Hoch glänzt du über die Lande,
Deine Strahlen umfangen, was du geschaffen.
Du bist fern, doch deine Strahlen befruchten die Krume,
und der Halm sprießt, wenn du den Boden geküsst.
Gehst du dann von uns nach Westen unter,
Breitet sich Dunkel über die Erde, als sei sie erstorben.
Es ruhen die Schlummernden in ihren Kammern.
Nähme einer die Habe unter ihrem Kopfe weg,
sie merkten es nicht. Die Welt liegt im Schweigen.
Morgens aber, wenn du wieder am Himmelsrand aufglühst,
da flieht vor dir die Finsternis.
Beide Länder freuen sich deiner Strahlen.
Alle erwachen und stehen auf,
sie waschen den Leib, sie kleiden sich,
betend heben sie die Arme,
Strahlender, zu dir empor,
und die ganze Welt verrichtet ihre Arbeit.
Alles Vieh freut sich auf der Weide,
Felder und Kräuter ergrünen,
Die Lämmer hüpfen auf ihren Füßen,
aus ihren Nestern flattern die Vögel hervor,
mit ihren Flügeln lobpreisen sie dich.
Offen sind alle Wege, da du leuchtest.
Die Schiffe befahren den Strom,
die Fische im Wasser springen vor deinem Angesicht,
deine Strahlen dringen bis in die Tiefen des Meers.
Du gibst jedem deiner Geschöpfe den Atem am Tage der Geburt
Und öffnest seinen Mund und spendest, wessen es bedarf.
Dem Küchlein in der Schale gibst du Luft,
du machst es stark, das Ei zu zerbrechen,
es läuft auf seinen Füßchen, sobald es hervorkam.
Du einziger Gott, der nicht seinesgleichen hat!
Du hast die Erde geschaffen nach deinem Herzen,
du einzig und allein.
Du schufest den Nil, der aus der Unterwelt quillt,
um das Volk am Leben zu erhalten.
Auch an den Himmel setztest du den Nil,
dass er herabflute und die Ackerkrume tränke.
Du schufest die Jahreszeiten, um deine Werke zu vollbringen,
den Winter, den kühlen,
die Sommerhitze, damit sie dich kosten.
Den fernen Himmel hast du gemacht,
um an ihm aufzugehen,
um all das zu schauen, was du allein schufest.
Alle blicken auf zu dir, Sonne des Tages!
Du lebst in meinem Herzen,
kein anderer kennt dich so,
wie dein Sohn Echnaton.
Seit du die Erde gegründet hast,
hast du sie aufgerichtet für deinen Sohn,
der aus dir selber hervorging,
den König von Ober- und Unterägypten,
den Herrn der Kronen, Echnaton, dessen Leben lang sei,
und für die königliche Gemahlin Nofretete.27
Was an diesem Hymnus auffällt, ist sein ausgeprägter Naturalismus – hier geht es nur um die physische Sonne und um nichts sonst; es fehlt jegliche Metaphysik, jede Anspielung auf etwas Höheres, Geistigeres, Wesenhaftes; die Dimension der Transzendenz ist geradezu abgeschafft worden. Und wie Echnaton nur das Licht gelten lassen wollte, aber nicht das Dunkel, so durfte es auch nur das Diesseits geben, aber kein Jenseits: die in der Kultur Ägyptens so tief verwurzelte Osiris-Religion wurde ebenso wie der traditionelle Amuns-Kult zurückgedrängt. Der krasse Realismus der Amarna-Zeit duldete nur noch das Sichtbare, und so wendete Echnaton die ursprünglich esoterische Re-Religion der alten Ägypter ins Naturalistische, ja Materialistische, so dass man in ihm fast den ersten Aufklärer und Entmythologisierer der Menschheits-Geschichte sehen kann. Eine Gestalt, die man in ihrer geistesgeschichtlichen Wirkung vielleicht mit Martin Luther oder Kant vergleichen kann, flackert in Echnaton erstmals ein Funke modernen Bewusstseins auf, aber verfrüht und ohne eine Möglichkeit der Verwirklichung.
Ebenso künstlich wie gewaltsam wollte Echnaton mit seinen von oben diktierten Reformen diesem uralten Priesterstaat Ägypten einen gewaltigen Sprung in die Moderne vorschreiben. Zu den Reformen des Echnaton gehört auch, dass er das zu seiner Zeit gesprochene Mittelägyptisch zur Schrift- und Literatursprache erhob, womit das besonders für priesterliche Zusammenhänge wichtige Altägyptisch zum reinen Relikt wurde. Alles war nun plötzlich im Aufbruch begriffen, alles im Wandel, im Fließen, in Bewegung gekommen. So auch die Darstellungen in der bildenden Kunst: anstelle des starren blockartigen Dastehens der älteren Pharaonenbildnisse werden Personen nun in Bewegung gezeigt, meist auf dem Pferdegespann stehend, oft auch in kühnen Drehungen und Stellungen anstelle der bisherigen Frontalansichten, so als wolle man die seit ungezählten Dynastien geltenden Kunstmaßstäbe mit einem Male sprengen und durch etwas ganz Neues ersetzen. Die Darstellungen des Echnaton selbst sind in ihrem Realismus von erschreckender Hässlichkeit; da fehlt jede Spur von Verklärung, Idealisierung, im Gegenteil wird die körperliche Unzulänglichkeit des Pharao fast manieristisch übersteigert.
In der neuen Sonnenstadt Achet-Aton, die rund 100.000 Einwohner gezählt haben muss, lebte Echnaton ausschließlich seinem Aton-Kult; aber das ägyptische Riesenreich, das sich über 18 Breitengrade erstreckte, zusammenzuhalten – dazu fehlte dem haltlosen Träumer die starke Hand. So konnte er es nicht hindern, dass Ägyptens Hauptfeind, die Hethiter, schon in den Zedernwäldern des Libanon standen und unerbittlich vorrückten; die Hilferufe seiner Vasallen aus den Provinzen verhallten ungehört. Über das Ende Echnatons wissen wir nichts. Litt er an einer unheilbaren Krankheit, fiel er einem Anschlag zum Opfer? Nach seinem Tod änderten sich die Verhältnisse rasch und grundlegend. Sein Schwiegersohn, der jugendliche Tutanchaton (1333-1325), verlegte den Regierungssitz recht bald nach Theben und setzte die alten Götter unverzüglich in ihre Rechte ein; das Andenken Echnatons wurde getilgt. Mit dem Tode des jungen Nachfolgers, der sich nun Tutanchamun nannte, des Gottes Amun eingedenk, erlosch die 18. Dynastie, die so glanzvoll begonnen hatte, wie eine zu früh niedergebrannte Leuchte.