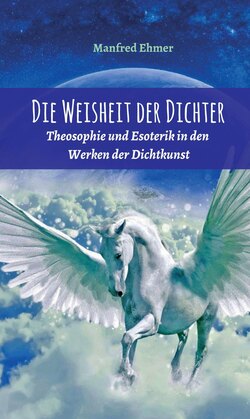Читать книгу Die Weisheit der Dichter - Manfred Ehmer - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDie Veden – Urgestein
altindischer Dichtung
Wie aus dem wohlentflammten Feuer die Funken,
Ihm gleichen Wesens, tausendfach entspringen,
So geh’n, o Teurer, aus dem Unvergänglichen
Die mannigfachen Wesen hervor
Und wieder in dasselbe ein.
Mundaka-Upanishad 2,1
Dichterkraft und Sehertum, Sprachgewalt und mystische Schau – nirgendwo liegen sie so dicht beieinander wie in der altindischen Literatur, die in den ältesten Texten der Menschheit, den Vedas, den Puranas und Brahmanas, erstmals Ausdruck gewann, um wie ein Echo in den heiligen Schriften des klassischen Indien nachzuhallen. Die altindische Dichtung, eine reine Götterhymnendichtung noch, Ausdruck einer erhabenen Menschheits-Kindheit, ist dem Wurzelboden einer frühindogermanisch-arischen Spiritualität erwachsen, die wie eine Urgesteins-Schicht allem später Dazugekommenen zugrunde liegt. Ihrem Ursprung wie ihrer geistigen Grundhaltung nach beruht die altindische Dichtung weder auf der rein magischen Vorstellungswelt der Naturvölker noch auf den eher weltflüchtigen Tendenzen der späteren Hochreligionen, sondern auf jener geistig hochstehenden, natur- und kosmosverbundenen Spiritualität, die in der Frühzeit des indischen Ariertums Gestalt annahm. Heute indes können wir uns dieses geistige Urwissen wieder neu aneignen.
Aus dem geistigen Urgestein der frühindisch-arischen Spiritualität ragen wie vier monolithische Felsblöcke die vier Haupt-Veden hervor, die mit den zeitlich jüngeren Upanishads heute noch zu den kanonischen Texten des Hinduismus zählen. Das Wort Veda leitet sich her von vidya, das Wissen, das Gesehene. Darin finden wir die indogermanische Wurzel vid, die uns auch in dem lateinischen Verb videre für sehen begegnet. Die Veden, deren Umfang den der Bibel um das Sechsfache übersteigt, verstehen sich somit als geheiligtes Wissen. Nach orthodoxer Ansicht sind sie nicht menschliches, sondern göttliches Wissen, das anfanglos und unvergänglich ist, und das von den Priestern der Vorzeit in geheiligter Schau „gesehen“ wurde. Vedisches Wissen ist also Seherwissen.
Grundlegend für das vedische Weltbild ist, wie auch Hans Joachim Störig in seiner Weltgeschichte der Philosophie schreibt, dass „die unserem Denken heute so selbstverständliche Unterscheidung von Belebtem und Unbelebtem, von Personen und Sachen, von Geistigem und Stofflichen noch nicht vorgenommen wurde. Die frühesten Götter waren Kräfte und Elemente der Natur. Himmel, Erde, Feuer, Licht, Wind, Wasser werden, ganz ähnlich wie bei anderen Völkern, als Personen gedacht, die nach Art der Menschen leben, sprechen, handeln und Schicksale erleiden.“11
Der gesamte Veda enthält vier Sanhitas, Sammlungen von Liedern und Sprüchen für den Gebrauch der Priester bei feierlichen Opferhandlungen – den Rig-Veda, den Sama-Veda, den Yajur Veda und den Atharva Veda. Der Rig-Veda zunächst ist das Buch der Götterhymnen. Seine 1028 Hymnen richten sich an die verschiedenen Naturgötter des frühindisch-arischen Pantheons: an den Feuergott Agni etwa, an den Sonnengott Surya, an den Windgott Vata, und natürlich an Indra, den Beherrscher von Blitz und Donner. Der Sama-Veda enthält Lieder und ist daher von grundlegender Bedeutung für die indische Musik. Der Yajur-Veda ist eine Sammlung von Opfersprüchen. Der Atharva-Veda mit seinen 731 Hymnen gilt als eine Sammlung von Zaubersprüchen und magischen Anrufungen; aber es sind, wie im Rig-Veda, auch Lieder zum Lobpreis von Göttern darin zu finden.
Wir haben guten Grund, den Atharva Veda gerade seiner Magie wegen zu den ältesten Teilen der Veden-Sammlung zu rechnen; heiliges Mysterienwissen erklingt aus diesen in Birkenrinde eingeritzten Hymnenliedern, die mindestens schon um 1800 v. Chr., wenn nicht gar noch früher, entstanden sein müssen. Ist doch die Magie die Urform der Religion, der Magier stets der Vorläufer des Priesters gewesen. Tatsächlich mag das Alter des Atharva-Veda gut 4000 Jahre betragen; seine Texte stammen vermutlich noch aus der Zeit, da die ostindogermanischen Stämme der Aryas, wie sie sich selber nannten – „Arier“, das heißt die „Edlen“–, in das damals noch dichtbewaldete Industal und in den Pandschab vorstießen. Der Geist jener Zeit war geprägt von einer staunenden Ehrfurcht vor der Natur. Die voralpine Landschaft an den Ufern des Indus und die schneebedeckten Berge des Himalaya im Hintergrund – das war die Umgebung, in der jene ersten „Arier“, ein schlichtes anspruchsloses Bauernvolk, das Göttlich-Numinose in der Natur erleben konnten.
Die Zeit zwischen 1000 und 750 v. Chr., gekennzeichnet durch das weitere Vordringen der Arier in die Ganges-Ebene, gilt nicht als die altvedische oder Hymnen-Zeit, sondern als die Zeit der Opfermystik. Die Kaste der Brahmanen hatte sich allmählich herausgebildet. Und der Mensch hatte sich gegenüber der Natur und den Göttern ein neues Selbstbewusstsein angemaßt: der Opfernde ist nun nicht mehr der Bittende, der sich an höhere Weltwesen wendet, sondern er ist der machtvolle Magier, der durch zwingenden Opferspruch den Göttern alles dem Menschen Zuträgliche abnötigt. Fast sieht es so aus, als stünden nicht die Götter über den Menschen, sondern umgekehrt die Menschen über den Göttern. In der Zeit zwischen 750 und 500 v. Chr., als die Arier die Urbevölkerung des zentralindischen Dekkan-Hochlandes unterwerfen, entsteht die neue Literaturgattung der Upanishaden: das Indertum hatte sich ganz auf das Gebiet der philosophischen Spekulation geworfen, wobei der alte vedische Götterglaube nur noch schemenhaft weiterlebte.
Die Poesie des Rig-Veda ist eine bereits hochentwickelte Kunstdichtung mit stark höfischem Grundzug; die Lieder sind von priesterlichen Sängern im Dienste von Fürsten geschaffen worden, die ihnen ihre Werke mit reichen Gaben – Rindern und Rossen, Gold und Edelsteinen – belohnten. Als ein Beispiel für die zutiefst naturnahe Götterlyrik der vedischen Zeit sei hier der Hymnus an die Göttin der Morgenröte wiedergegeben.
In Majestät aufstrahlt die Morgenröte,
Weißglänzend wie der Wasser Silberwogen.
Sie macht die Pfade schön und leicht zu wandeln
Und ist so mild und gut und reich an Gaben.
Ja, du bist gut, du leuchtest weit, zum Himmel
Sind deines Lichtes Strahlen aufgeflogen.
Du schmückest dich und prangst mit deinem Busen
Und strahlst voll Hoheit, Göttin Morgenröte.
Es führt dich ein Gespann mit roten Kühen,
Du Sel'ge, die du weit und breit dich ausdehnst.
Sie scheucht die Feinde, wie ein Held mit Schleudern,
Und schlägt das Dunkel wie ein Wagenkämpfer.
Bequeme Pfade hast du selbst auf Bergen
Und schreitest, selbsterleuchtend, durch die Wolken.
So bring uns, Hohe, denn auf breiten Bahnen
Gedeihn und Reichtum, Göttin Morgenröte.
Ja, bring uns doch, die du mit deinen Rindern
Das Beste führest, Reichtum nach Gefallen!
Ja, Himmelstochter, die du dich als Göttin
Beim Morgensegen noch so mild gezeigt hast!
Die Vögel haben sich bereits erhoben
Und auch die Männer, die beim Frühlicht speisen.
Doch bringst du auch dem Sterblichen viel Schönes,
Der dich daheim ehrt, Göttin Morgenröte!12
Der Atharva-Veda enthält außer dem in Prosa abgefassten Sechstel Hymnen, die zu sehr verschiedenen Zeiten entstanden sein müssen. Im Mittelpunkt steht jedoch weithin die Magie: Bannsprüche und Zauberformeln sind darin zu finden, böse Dämonen sollen abgewehrt, Krankheiten kuriert, Vorteile der verschiedensten Art wie Liebesglück, Sieg im Kampf sollen erlangt werden. Daneben kommen ansatzweise schon erste philosophische Spekulationen zum Ausdruck, noch zaghaft, fragend, suchend, erste Morgendämmerung eines noch nicht ganz zur Entfaltung gekommenen mentalen Bewusstseins. Bemerkenswert in dieser Hinsicht ist der Hymnus an den Zeitgott Kala, der sich an die Zeit, also nicht mehr an eine sinnlich in Erscheinung tretende Naturmacht oder Naturgottheit, sondern an eine Abstraktion wendet; einige Verse daraus sollen hier mitgeteilt werden:
Der Zeitgott eilt, ein Ross mit sieben Zügeln,
Er altert nie und sieht mit tausend Augen.
Die Weisesten besteigen seinen Wagen,
Und alle Wesen ihm als Räder taugen.
Mit sieben Rädern, sieben Naben fährt er,
Unsterblichkeit ist Achse seinem Wagen,
Er bringt die Dinge alle zur Erscheinung,
Als erster Gott lässt er dahin sich tragen.
Auf seinem Wagen steht ein Krug zum Spenden,
Wir sehn ihn überall, wo wir auch wohnen,
Er spendet allen Wesen. Alle sagen:
Er ist der Herr der höchsten Himmelszonen.
Zustande bringt er alles, immer hat er
Als der Allüberwinder sich erwiesen;
Als Vater ist zugleich er Sohn geworden,
Drum gibt es keinen Mächtigern als diesen.13
Der Vedismus, die älteste Religion Indiens, war eine Volksreligion mit stark polytheistischer, ja pandämonistischer Prägung, ganz der Welt zugewandt, deren Güter als im höchsten Maße begehrenswert erschienen, und mit Göttern, die dem Weltganzen in geheimnisvoller Immanenz innewohnten. Aus diesem so ganz diesseitszugewandten Vedismus erwuchs im Laufe der Zeit die Frage nach dem Einen, die Hauptfrage der indischen Religion, die ihre Antwort zuletzt in einer Einheitsmystik findet. Aus der Schar der vielen Welt-Götter, die zunächst alle gleichwertig nebeneinanderstehen, heben sich allmählich einzelne große Göttergestalten heraus; dabei entsteht wie von allein die Frage, wer denn der größte aller Götter sei. Dies ist, religionsgeschichtlich gesehen, ein erster Schritt vom Polytheismus zum Monotheismus, der aus einer religiösen Einheitsahnung erwächst, indem er die vielen göttlichen Numina zu einer einzigen, universalen Göttergestalt zusammenwachsen lässt.
Im jüngeren Rig-Veda nimmt das göttliche Eine schon ausgesprochen unpersonale Züge an; es ist ein nur in mystischer Versenkung zu erlebendes göttliches All-Eines, nicht ein personaler Schöpfergott. Das Eine, von dem das folgende Gedicht handelt, ist nicht mehr Teil der Welt, sondern besteht vor allem Gewordenen, das aus ihm überhaupt erst hervorgeht. Die immer wiederkehrende Frage: „Wer unter den Devas (Göttern) ist es, den wir mit Opferguss ehren?“ besagt, dass hier der fromme Dichter fragt, welcher von den bekannten vedischen Göttern dem einen namenlosen „Gott über allen Göttern“ am ehesten entspricht. Es geht nicht bloß darum, wer der größte unter den Göttern ist, sondern hier hat die fromme Ahnung bereits erkannt, dass alle Götter nur ein Gott sind.
Am Anfang stieg empor das goldne Glanzkind,
Es war des Daseins eingeborner Meister;
Er trug die Erde, trug den Himmel droben:
Wer ist der Gott, den wir mit Opfern ehren?
Der uns das Leben gibt, der uns die Kraft gibt,
Dess' Machtgebot die Götter all' gehorchen,
Dess' Schatten die Unsterblichkeit, der Tod sind:
Wer ist der Gott, den wir mit Opfern ehren?
Er, der in Majestät vom höchsten Throne
Der atmenden, der Schlummerwelt gebietet,
Der aller Menschen Herr und des Getieres:
Wer ist der Gott, den wir mit Opfern ehren?
Er, dessen Größe diese Schneegebirge,
Das Meer verkündet mit dem fernen Strome;
Dess' Arme sind die Himmelsregionen:
Wer ist der Gott, den wir mit Opfern ehren?
Er, der den Himmel klar, die Erde fest schuf,
Er, der die Glanzwelt, ja den Oberhimmel,
Der durch des Äthers Räume hin das Licht maß:
Wer ist der Gott, den wir mit Opfern ehren?
Zu dem empor, von seiner Macht gegründet,
Himmel und Erde blickt, im Herzen schauernd,
Er, über dem die Morgensonn' emporflammt:
Wer ist der Gott, den wir mit Opfern ehren?
Wohin ins All die mächt'gen Wasser flossen,
Den Samen legend und das Feuer zeugend,
Da sprang hervor der Götter Eines Ursein:
Wer ist der Gott, den wir mit Opfern ehren?
Der über Wolkenströme selbst hinaussah,
Die Kraft verleihen und das Feuer zeugen,
Er, der allein Gott über alle Götter:
Wer ist der Gott, den wir mit Opfern ehren?
Mög' er uns gnädig sein, der Erde Vater,
Er, der Gerechte, der den Himmel zeugte,
Der auch die Wolken schuf in Glanz und Stärke:
Wer ist der Gott, den wir mit Opfern ehren?14
Im Weltschöpfungslied des Rig-Veda tritt uns das göttliche All-Eine erstmals in mystischer Schau entgegen, nicht als persönlicher Gott, sondern als un- und überpersönliches Eines. Selbst die zahlreichen, der Schöpfung innewohnenden Götter und der ihnen zugeordnete Obergott verdanken diesem Unsagbar-Einen und Ursprünglichen ihre Entstehung. Hier beginnt erst Mystik im eigentlichen Sinne; denn das im Weltprozess tätige Eine entstammt einem Bereich nicht vorstellbarer Transzendenz. Es hat keinen Namen; es heißt einfach nur „Dieses“ (Tad), oder „Das Eine, außer dem es sonst nichts gab“. Die Chandogya-Upanishad nennt es „Eines ohne ein Zweites“, das zweitlose Eine. Der mystische Dichter dieses Liedes weist alle Spekulationen über die Weltentstehung zurück; er ist bereits zu der Erkenntnis gelangt, dass niemand wissen kann, wie alles Gewordene zustande kam, selbst die Götter und ihr Obergott nicht, denn auch diese sind später als das Eine.
Es war kein Nichtsein damals, und es war kein Sein;
Es war kein Luftraum auch, kein Himmel über ihm.
Was webte damals? Wo? Wer hielt in Schutz die Welt?
Wo war das Meer, der Abgrund unermesslich tief?
Nicht Tod war damals, auch das Leben gab es nicht;
Es gab kein Unterschied noch zwischen Tag und Nacht;
Doch Dieses atmete, auf seine Weise, ohne Hauch:
Das Eine, außer dem es sonst nichts gab.
In Dunkel war die Welt im Anfang eingehüllt;
Und alles 'dieses' war nur unkenntliche Flut.
Durch Leere war das wundersame Eine zugedeckt:
Da brachte es durch Glutes Kraft sich selbst hervor.
Da ward das Eine gleich von Liebeskraft durchwallt,
Die, aus dem Geist geboren, aller Dinge Same ist:
Das Herz erforschend, taten es die Weisen kund,
Wie alles Sein im Nichtsein seine Wurzel hat.
Und als die Denker querdurch spannten eine Schnur,
Da gab es 'Oben' plötzlich, und ein 'Unten' auch;
Und keimesmächt'ge Kräfte traten auf den Plan:
Begehren unten, oben der Gewährung Kraft.
Wer hat es ausgeforscht, und weiß es, tut es kund,
Woher die Schöpfung kam, und wie die Welt entstand?
Die Götter traten nach dem Einen erst ins Sein.
Wer also weiß, woher sie ausgegangen sind?
Woher die Schöpfung ist, und ob der Eine sie gemacht,
Das weiß, der über diese Welt die Oberaufsicht hat,
Und aus dem höchsten Himmel auf sie niederblickt:
Der weiß es wohl? Vielleicht weiß er es selber nicht.15
Wie ein Monument steht das Urgestein der altindischen Dichtung im Strom der Zeiten, alle Wechsel und Wandlungen überdauernd, einmalig in der Wucht und Größe seiner mystischen Schau, unvergleichlich im Zauber seiner lyrischen Poesie. Als Verfasser der Veden wird uns ein gewisser Vyasa genannt – ein hoher Eingeweihter zweifellos, eine bis heute nicht als historisch nachgewiesene Person, vom Dämmerlicht einer längst vergangenen Frühzeit umhüllt. Überdies scheint es fraglich, ob die Veden in ihrer Gesamtheit, mit ihrer großen Spannweite und der Vielfalt an Entwicklungsstufen, überhaupt der Feder eines einzelnen Mannes entsprungen sein können; so könnte man „Vyasa“ auch als einen Gattungs- oder Gruppennamen sehen, der auf eine ganze Schar von dichtenden Sehern der vedischen Zeit angewandt wurde, ähnlich wie im alten Griechenland Namen wie „Orpheus“ oder „Homer“ sich nicht so sehr auf einzelne Persönlichkeiten, sondern auf ganze Generationen von Dichter-Sehern beziehen können. Wie man eine ganze Literaturgattung „homerisch“ nennt, so schreibt man die altindische Dichtung als Ganzes „Vyasa“ zu.
Die indische Überlieferung kennt außer den Veden, die als übermenschlichen Ursprungs gelten, noch eine Gattung von Literatur, die auf die Autorität heiliger Menschen zurückgeht. Dazu zählen vor allem die beiden großen Epen Indiens – das Ramayana und das Mahabharata, ferner gehören hierher die Puranas, d. h. alte Erzählungen, die Legenden vermischt mit kultischen Vorschriften und religiösen Betrachtungen beinhalten. Als Verfasser des Mahabharata wird ebenfalls Vyasa genannt – auch hier wieder eine mythische Figur, da das Dichtwerk in seiner heutigen Form eine im Laufe eines Jahrtausends angewachsene Sammlung darstellt. Das Ramayana, das von dem Heiligen Valmiki verfasst sein soll (im 2. Jhrt. v. Chr.), behandelt die Sage von dem göttlichen Helden Rama, dem ein Riesenkönig seine schöne Frau Sita raubte, von seinen Fahrten und Kämpfen, um sie wiederzugewinnen, und von seinem schließlichen Sieg. Wenn die Inder das Ramayana das erste Kunstgedicht nennen, so sicher mit Recht; denn dort wird zum ersten Mal von jenen Schmuckmitteln reichhaltig Gebrauch gemacht – etwa Vergleichen, poetischen Figuren und Wortspielen –, die in der späteren indischen Poetik eine so hervorragende Bedeutung gewinnen.