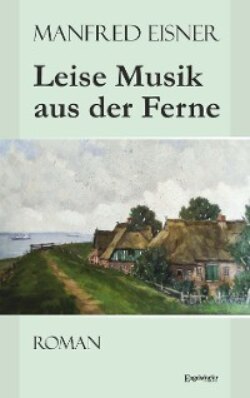Читать книгу Leise Musik aus der Ferne - Manfred Eisner - Страница 10
3. Geisterstunde
ОглавлениеLangsam bricht der Abend herein. Das Licht im Esszimmer des Herrenhauses wurde noch nicht angezündet und es ist düster.
Die Fenster lassen das Zwielicht fahl durchscheinen; es verleiht den Gegenständen im Raum den Anschein eines Friedhofes im Mondschein. Alles ist still. Die schweren Möbel werfen dunkle Schatten auf den Boden. Die verstorbenen Ahnen auf den großen Gemälden mit den vergoldeten Rahmen sehen noch viel verblichener aus. Der riesige Kristalllüster, der von der Decke herunterhängt, strahlt einen eiskalten Glanz aus, als ob er aus weißen Gerippen bestünde.
Die bequemen, mit rotem Samt bezogenen Sessel stehen um den gewaltigen Eichentisch herum, auf dem die ebenfalls rote Samtdecke mit der goldenen Borte liegt. In der Mitte der langgezogenen Anrichte thront eine marmorweiße Büste von Kaiser Wilhelm I. An der gegenüberliegenden Wand hängt der überdimensionale ovale Spiegel – ähnlich einem leblosen See, auf dem sich eine vor langer Zeit versunkene Landschaft widerspiegelt.
Minuten verstreichen. Das Licht schwindet zusehends. Stille kehrt ein. Sie wird nur durch das monotone Ticken der Standuhr unterbrochen, die unaufhörlich am Zeitvergehen strickt. Plötzlich ertönt ein dumpfes Schlagen, noch eins, ein weiteres, drei, fünf. Es ist so, als ob diese Laute aus weiter Ferne kämen, aus längst vergangenen Zeiten, und durch sie die Geister der Vergangenheit geweckt würden.
Könnten nur die Holzdecke und die dicken Balken die Stimmen der Vergangenheit hervorbringen, die einst zu ihnen emporstiegen … Vermochte der Spiegel allein die erloschenen Bilder aus jener Zeit widerzuspiegeln …
* * *
Ein Märzabend im Jahre 1910.
Der alte Oliver von Steinberg betritt das Esszimmer, hüstelt trocken, streicht über seinen mächtigen weißen Schnurrbart, der dicht über dem Mund durch das Rauchen vergilbt ist. Er kommt gerade vom Rasieren und verbreitet den leisen Duft seines Gesichtswassers. An seiner schwarzen Fliege schimmert matt eine kleine runde Perle. Er geht ein wenig gebückt, aber man merkt es ihm an, dass er sich eisern um eine gerade Haltung bemüht.
Die Söhne – Hans-Peter, Johann, Ewald und Christian – stehen rasch auf und begrüßen ihn voller Respekt.
Der mit brennenden Kerzen bestückte Lüster erhellt festlich den Raum. Auf der Anrichte leuchten neben der kaiserlichen Büste weitere Kerzen in einem silbernen Kandelaber. Der Spiegel vervielfältigt den Schein der Lichter.
Der Tisch ist für den späten Abendtee gedeckt. Der Hausherr liebt Blumen auf dem Tisch: In dessen Mitte steht eine hohe Kristallvase voller Osterglocken.
Oliver setzt sich und gibt seiner Schwester ein Handzeichen: „Nun, liebe Schwester, lass bitte den Tee auftragen.“
Tante Alexandra läutet mit der kleinen Silberglocke. Als das Lenchen mit dem Teeservice den Raum betritt, schlägt die große Uhr. Lenchen schenkt den Tee in die schönen Porzellantassen mit dem Goldrand ein. Am Kopf des Tisches blickt der Alte auf Christian und lächelt. Er ist sein Jüngster, dichtet Sonette; er hat die gleichen Augen wie seine geliebte, selige Frau.
„Na, mein Sohn, was machen denn deine Balladen?“ Für Oliver sind Balladen und Sonette das Gleiche.
Christian erwidert mit weicher Stimme: „Lieber Papa, ich dichte Sonette, keine Balladen.“
Der Alte gibt sein kurzatmiges Lachen von sich und streicht sich mit einer ihm eigenen Bewegung über den Schnurrbart. „Wer sagt es denn: ein wahrhaftiger Poet in unserer Familie.“
Die anderen lächeln.
Christian senkt verlegen die Augen. Tante Alexandra blickt liebevoll auf die jungen Neffen.
„Meine Selige dichtete ebenfalls Sonette, als sie noch ein junges Mädchen war …“ Der alte Oliver wendet seinen Blick auf das Bildnis an der Wand, auf seine geliebte Henriette, schon vierzigjährig heimgegangen. Der Maler besaß eine besonders glückliche Hand, hatte er doch den Ausdruck dieser blauen Augen, die wunderschön geformten Lippen und die gerade, noble Nase vorzüglich festgehalten.
Oliver blickt zurück auf die Söhne und fühlt sich von einer tiefen Traurigkeit ergriffen. Wenn nur seine Henriette die erwachsenen Söhne hätte erleben können … Ach, was soll’s, auch ich werde bald sterben, und wenn es einen Himmel gibt, dann werde ich sie dort wiedertreffen und zu ihr sagen: „Mein Liebling, unsere Söhne sind herangewachsen und wohlgeraten. Hans-Peter wird bald heiraten, Johann hat seine kaufmännische Lehre fast beendet. Ewald wird Wald- und Forstwirtschaft studieren, und stell dir vor, der Christian dichtet Sonette …“
Tante Alexandra ist erstaunt über das Schweigen des Bruders: „Fehlt dir etwas, lieber Bruder? Ist es etwa deine Leber?“
„Ach was, Leber!“ Hand an den Schnurrbart, Hüsteln. „Nichts, ich habe nur nachgedacht …“
Das Gespräch flackert wieder auf: die Schweinepreise, die Lokalpolitik, das zunehmende Wachstum der Gewerkschaften, die schon zwei Millionen Mitglieder zählen sollen. Draußen jagt ein Frühlingssturm die schwarzen Wolkenfetzen über das Firmament, die Fenster klirren ab und zu, wenn die heftigen Windböen dagegenprallen.
Während seine Hand über den Schnurrbart streicht und ab und zu von seinem Hüsteln unterbrochen wird, erzählt der alte Oliver von Steinberg wieder einmal die Geschichte des Kaiserbesuches in Oldenmoor.
„In diesem Raum speiste Kaiser Wilhelm I., Gott sei seiner Seele gnädig. Ich erinnere mich daran noch ganz genau, so als ob es gestern gewesen wäre. Ich war damals ein sehr kleiner Junge und habe die Bedeutung nicht begriffen … Der Papa zog seine Generalsuniform an, um den Kaiser zu empfangen. Als Seine Majestät dort durch diese Tür schritt, hatte ich ein unbeschreiblich schönes Gefühl. Die Begrüßungsworte, die ich aufsagen sollte und so oft geübt hatte, blieben mir einfach im Halse stecken. Ich kniete vor dem Kaiser nieder und küsste seine Hand. Er sah mich nur an und lächelte mir nickend zu.“
Alle schmunzeln schweigend.
* * *
Ein Sommernachmittag im Jahre 1911.
Tadeusz Rembowski, der Pole, der eine kleine Bäckerei im angrenzenden Haus betreibt, klopft an die Haustür der Familie von Steinberg und bittet um Einlass, um den „hohen Herrn“ zu sprechen.
Man führt ihn ins Esszimmer. Da steht er, unbeholfen und unruhig, blickt mit angsterfüllten Augen auf sein Spiegelbild. Er hat einen verzweifelten Ausdruck in seinen braunen Augen. Schweißperlen glänzen auf Nase und Stirn. Das gerötete Gesicht ist eine Maske voller Beklommenheit. Er wartet voller Ungeduld und mit krampfhaft verschlungenen Händen.
Schritte nähern sich. Der Bäcker dreht sich um: Der Hausherr betritt den Raum.
„Wie geht es Ihnen, Herr Rembowski?“
„Danke, Herr Oberst, danke …“
Sie geben sich die Hände.
„Nehmen Sie doch Platz.“
Tadeusz setzt sich. Unbeholfen wagt er sich kaum auf den Sessel. Er sitzt gerade, knapp auf der Vorderkante des Polsters. Oliver von Steinberg lehnt sich gemütlich in den gegenüberstehenden Sessel zurück und fragt mit gönnerhaften Stimme: „Und wie geht es Ihrer Frau Gemahlin?“
Anfänglich scheint Tadeusz Rembowski die Frage nicht verstanden zu haben. Danach, plötzlich, als ob er von einem Traum erwacht, gibt er ein „gut“ von sich, das in seinem Weinen erstickt.
Oliver von Steinberg blickt ihn verwundert an: „Aber, um Gottes willen, was haben Sie denn, Herr Rembowski?“
Der Bäcker zieht ein zerknülltes Taschentuch hervor und wischt sich die Tränen aus den Augen.
„Ist jemand gestorben?“
Tadeusz schüttelt den Kopf. Oliver steht auf und legt seine Hand auf die Schulter des Nachbarn. „Verdammt noch mal, Mann, erzählen Sie schon, was Sie derart bedrückt!“
Hüsteln, Hand an den Schnurrbart.
„Was hat man denn Ihnen angetan?“
Das Gesicht im Taschentuch verborgen, schluchzt der Bäcker: „Die Bank, die verwünschte Bank …“
„Potz Teufel! Erzählen Sie mir doch die ganze Geschichte geradeheraus, Herr Rembowski.“ Er gibt seiner Stimme einen beleidigten Unterton, den er gar nicht so meint. „Weinen Sie nicht, ein Mann darf doch nie weinen!“
Tadeusz Rembowski hebt das Gesicht. Die Tränen kullern ihm über die Wangen und tropfen auf den Kragen seines grauen Hemdes. Und dann erzählt er in seinem Kauderwelsch, dass die Bank ihm angedroht habe, einen von ihm unterschriebenen und überfälligen Wechsel zu protestieren, weil er nicht bezahlen könne. Es werde ein Unglück geschehen, seine Kreditwürdigkeit gehe verloren, niemand mehr werde in der Bäckerei Rembowski einkaufen wollen. Seine Frau werde vor Kummer an Herzversagen sterben, eine Katastrophe!
Sein Gesicht versinkt abermals im Taschentuch und er setzt sein Weinen noch lauter fort.
Der alte Oliver hüstelt und streicht sich über den Schnurrbart. Er geht im Esszimmer schweigend auf und ab, bleibt dann vor dem Stuhl Rembowskis stehen und fragt: „Wie viel müssen Sie zurückzahlen, Herr Rembowski?“
„Zwölfhundert Mark, Herr Oberst“, stammelt der Bäcker ganz leise.
Der Alte kratzt sich am Kinn, denkt noch einen Augenblick nach und sagt dann: „Könnten Sie Ihr Leben mit dreitausend Mark wieder in Ordnung bringen?“
Der Pole springt erregt auf. „Dreitausend Mark? Aber … das würde ja bedeuten … ja, das wäre ja die Rettung, ein Versprechen des Wohlhabens, eine … eine …“
Ihm versagte die Stimme. Die Hände des Bäckers sind wie zum Gebet gefaltet, danach fuchtelt er wild in der Luft herum und versucht noch etwas zu sagen, Deutsch mit Polnisch vermischt, er kann es nicht fassen! Dreitausend Mark! Die Rührung überwältigt ihn.
Der alte Oliver lächelt und legt seine Hand auf die Schulter des Nachbarn: „Also, Sie gehen jetzt ganz ruhig nach Hause, lieber Freund. Morgen früh schicke ich Ihnen die dreitausend Mark hinüber. Sie zahlen sie mir zurück, sobald Sie können. Wenn Sie es nicht können, dann eben auch nicht. Darüber werden wir nicht streiten. Danken wir dem guten Gott, dass ich in der erfreulichen Lage bin, meinem Nachbarn helfen zu können …“
Tadeusz Rembowski ist noch immer sprachlos. Oliver wiederholt sein Versprechen und führt den noch verdatterten Bäcker behutsam in Richtung Haustür.
Der Pole ist derart von seinem Glück erfüllt, dass er keine Worte findet, um seinen Dank auszusprechen. Und als er auf die Straße tritt und dann eiligen Schrittes in sein Haus gelangt, schließt Oliver langsam die Haustür, kehrt in das Esszimmer zurück und bleibt vor dem Bild seiner Henriette stehen. Er erinnert sich an die stürmische Novembernacht, in der sie verstarb.
* * *
Nun spiegeln sich im großen Spiegel des Esszimmers drei schwarz gekleidete Herren wider, die mit ernsten Gesichtern in den Sesseln sitzen. Der alte Oliver schreitet vor ihnen nachdenklich auf und ab, hüstelt gelegentlich und streicht sich wie gewöhnlich über seinen Schnurrbart.
Alle Kerzen des Lüsters brennen. Draußen weht ein eisiger Dezemberwind und wirbelt die Schneeflocken durcheinander. Nur das Brummen des Motors eines sich auf der eisigen Straße quälenden Fahrzeuges bricht gelegentlich die Stille.
Der älteste der drei ergreift das Wort: „Überlegen Sie wohl, Herr Oberst. Sie sind ein hochgeschätzter Mann und einer der beliebtesten Bürger unserer Gemeinde. Wenn Sie dieses Amt nicht annehmen, wer wird es dann tun? Unsere Partei verlangt von Ihnen dieses Opfer. Stimmen Sie doch bitte Ihrer Kandidatur zu. Die Opposition wird es gar nicht einmal wagen, gegen Sie anzutreten. Niemand wird gegen einen Herrn von Steinberg stimmen, nicht wahr, meine Herren? Jeder mag und respektiert Sie.“
Er unterbricht seine Rede, als ob er durch die Überzeugungskraft seiner schwerwiegenden Argumente selbst ermattet wäre. Er drückt verstohlen die weißen Manschetten zurück, die aus den Ärmeln seines Gehrockes auszubrechen scheinen, und blickt verlegen auf die Spitzen seiner blank geputzten schwarzen Gamaschenschuhe, an denen der Schnee feuchte Ränder hinterlassen hat. Die beiden anderen Herren sehen sich gegenseitig mit ernsten Mienen an und nicken zustimmend mit ihren ergrauten Häuptern.
Oliver sieht die drei Besucher nacheinander an, streicht sich über den Schnurrbart und antwortet mit einem verstohlenen Lächeln: „Ich habe es bereits abgelehnt, Udo Dammann.“
„Aber, Herr von Steinberg“, beharrt dieser, „unsere Stadt benötigt Ihre Dienste, Sie können und dürfen sich dieser Verantwortung doch nicht so einfach entziehen. Sie sind der geeignete Mann, um den drohenden Vormarsch der Linken in den Stadtrat zurückzudrängen.“
Oliver hüstelt trocken und bleibt bei seiner Ablehnung, die er durch ein Kopfschütteln ausdrückt.
Ein anderer Besucher beginnt langsam und mit sehr wichtigem Gehabe zu reden: „In meiner Eigenschaft als Vertret…“
Udo Dammann fällt ihm nervös ins Wort: „Gedenken Sie doch Ihres werten Herrn Vaters, dem hochwohlgeboren Herrn General Peter von Steinberg, der seinem Vaterland bis zuletzt gedient hat und sein Leben ehrenvoll bei der Schlacht von Sedan ließ.“
Der vorher unterbrochene Redner macht einen erneuten Versuch: „Wie ich bereits vorhin sagte …“
Und Udo Dammann bekräftigt: „Also, Herr von Steinberg, überdenken Sie es noch einmal.“
Es vergehen einige Minuten. Oliver von Steinberg stellt sich vor die drei Herren und spricht, während er seinen Schnurrbart zwirbelt: „Ich bedaure sehr, meine Freunde, es kann nicht sein.“ Hüsteln. „Ich habe leider keinerlei Beziehung zur Politik. Es wäre ein furchtbarer Reinfall. Für uns alle! Die von Steinbergs sind für so etwas nicht geschaffen …“
„Aber, aber!“
„… wenn wir etwas sagen möchten, dann nennen wir es auch beim Namen. Ohne den Herren zu nahe treten zu wollen, wir haben nur ein Wort. Nun denn, Sie wissen genau, dass ein so offenherziger Bürger wie ich einen miserablen Politiker abgeben würde, der am Ende dadurch auch noch seiner eigenen Partei einen nicht wiedergutzumachenden Schaden zufügen könnte.“
Dammann macht einen letzten Versuch: „Aber es geht ja nicht nur um die eigene Partei, es …“
Oliver unterbricht ihn bestimmt mit einer Geste: „Ich hoffe sehr, dass Sie mir meine Offenheit nicht übel nehmen … Ich kann wirklich nicht annehmen … Ich danke Ihnen!“
Die Kommissionsmitglieder erheben sich. Sie ziehen ihre Wintermäntel über. Drei Händedrücke. Alle gehen zur Haustür. Als die zwei ersten Besucher bereits auf der Straße sind, hält Oliver Udo Dammann am Pelzkragen seines Wintermantels zurück und flüstert ihm leise zu: „Hör zu, du Heuchler, das nächste Mal brauchst du dich mir gegenüber nicht derart zu verstellen, auch wenn du mit solch einer hochkarätigen Abordnung zu mir kommst! Mein guter, alter Freund Udo macht ein Gehabe, als ob er ein Lord im britischen Oberhaus wäre. Nicht zu glauben!“ Dabei lächelt er und hüstelt.
Dammann sagt: „Aber, aber, mein lieber Oliver!“, lächelt zurück und drückt ihm dabei beide Hände. Danach eilt er seinen vorangegangenen Begleitern auf dem mit Schnee bedeckten Gehweg hinterher.
* * *
Juni 1912.
Der alte Speisesaal glänzt für ein besonderes Fest.
Hans-Peter und seine Frau feiern mit der ganzen Familie die Taufe ihrer ersten Tochter. Die Namensgebung gab Anlass zu längeren Diskussionen. Hans-Peters Brüder waren der Meinung, dass das Mädchen den Namen seiner Großmutter tragen solle. Der Vater dagegen war von einem Roman begeistert, dessen Heldin Lady Clarissa hieß. Dieser Name gefiel ihm außerordentlich. „Meine Tochter wird Clarissa heißen!“ Oliver von Steinberg stimmte ihm zu. Und so wurde das Kind auf den Namen Clarissa getauft. Johann und Tante Alexandra waren die Taufpaten.
Jetzt feiern alle das freudige Ereignis. Der Saal ist voller Leute, die sich recht angeregt unterhalten. Onkel Suhl spielt auf seiner Flöte und wird am Klavier von Tante Alexandra begleitet.
Mit seinem Töchterchen auf dem Arm tritt der stolze Vater ein. Alle treten näher, um das Baby zu betrachten.
Clarissa öffnet die blauen, runden Äuglein, die sich, vom Licht geblendet, gleich wieder schließen. Das noch runzlige Gesicht verzieht sich mit einem Ausdruck des Missfallens. Die winzigen Händchen fuchteln in der Luft herum.
„Ist sie nicht allerliebst?“
„Ganz der Papa!“
„Ich finde, sie sieht eher ihrem Großvater ähnlich, kein Zweifel.“
Oliver von Steinberg zwirbelt stolz seinen Schnurrbart. „Typisch, die Nase der von Steinbergs.“
Gelächter.
Am Rande des Zimmers beschreibt Tadeusz Rembowski, ganz in einen steifen Kragen und in neue, offensichtlich zu enge Stiefeln eingepfercht, einem Gast die bahnbrechenden maschinellen Neuerungen, die er in seiner Bäckerei eingeführt hat.
* * *
September 1914.
Christian von Steinberg ist bei der mörderischen Schlacht an der Marne gefallen. Die Überführung des Sarges mit seinen sterblichen Resten nach Oldenmoor wurde durch den besonderen Einsatz des Vorsitzenden des Stadtrates, Udo Dammann, ermöglicht.
Die Nachricht verbreitet sich rasch. Die Freunde der Familie sammeln sich nach und nach im Hause. Der große Spiegel ist zum Zeichen der Trauer verhängt. Oliver von Steinberg ist völlig zusammengebrochen: Er kann es immer noch nicht fassen, dass der jüngste und insgeheim der bevorzugte seiner Söhne nicht mehr ist.
Der Sarg wird zunächst in der Diele des Hauses aufgebahrt, um dann, unter reger Anteilnahme der riesigen Trauergemeinde, mit militärischen Ehren in der Familiengruft der von Steinbergs beigesetzt zu werden.
Christians ältere Brüder, Hans-Peter, Johann und Ewald, erhielten zur Beerdigung Heimaturlaub. Stumm stehen sie in ihren Uniformen um ihren Vater herum: Der Älteste ist bei der Feld-Artillerie, die beiden anderen sind Infanteristen.
Der alte Oliver liest immer wieder den letzten Brief Christians, zwei Tage vor seinem Tode geschrieben:
An der französischen Front, den 13. September, 1914.
Lieber Papa,
ich hoffe sehr, dass diese Zeilen Dich bei bester Gesundheit erreichen. Nachdem die ersten euphorischen Wochen des Krieges verstrichen sind, fange ich langsam an, über den Sinn und den Unsinn dieses gegenseitigen Völkermordes nachzudenken. Wir hatten schon den Fluss Marne überquert, da haben die Franzosen eine starke Gegenoffensive entfaltet und eine riesige Bresche in unsere Front geschlagen, so dass wir den Befehl zum Rückzug erhielten. Wir haben uns hinter der Aisne eingegraben und halten hier die Stellung.
Die Franzosen – von den Engländern unterstützt – versuchen immer wieder, uns weiter zurückzudrängen. Bisher ohne Erfolg. Aber bei jedem ihrer Angriffe sowie auch bei unseren Gegenangriffen (zwei Mal versuchten wir bereits den Fluss zu überqueren, um Brückenköpfe am anderen Ufer zu bilden) bleiben Hunderte von Toten und Verwundeten auf dem Schlachtfeld liegen oder ertrinken im Fluss.
Es ist grauenvoll. Wir liegen im Schützengraben und hören das Schreien und Stöhnen der Verwundeten und Sterbenden. Es ist wie ein Albtraum!
Ich sende Dir, lieber Papa, diesen Brief mit einem verwundeten Kameraden; er hat einen Lungen-Steckschuss und wird heute nach Hause, nach Rendsburg, verschickt. Der Stabsarzt sagte mir, er wird es wahrscheinlich nicht mehr bis zu seinem Ziel schaffen. (Hoffentlich kommen diese Zeilen irgendwie in Deine Hände, ich hätte es nicht gewagt, diesen Bericht über den – wahrscheinlich zensierten – Feldpostweg zu senden).
Wie geht es meinen Brüdern? Von ihnen hörte ich nichts und bete darum, dass Gott sie beschützen möge, damit wenigstens sie heil aus diesem Inferno herauskommen.
Verzeih mir, lieber Papa, aber ich habe die Vorahnung, dass ich von diesem Jüngsten Gericht nicht mehr lebend zurückkommen werde. Sollte mir etwas zustoßen, so bitte ich Dich, meinem letzten Willen zu entsprechen und alle meine Gedichte – Balladen, wie Du immer zu sagen beliebtest – zu vernichten. Es darf keines davon je veröffentlicht werden. Vergib mir, Vater, auch der liebe Gott möge uns allen dieses begangene Unrecht vergeben.
Es umarmt Dich und alle zu Hause in Liebe
Dein Christian
Der Brief war bei der Post in Rendsburg aufgegeben worden.
* * *
April 1915.
Wieder herrscht Trauer im großen Hause, die Spiegel sind mit schwarzen Tüchern verhängt.
Der Leichnam des alten Oliver von Steinberg ist in seiner Uniform eines Obersten der Kavallerie im Salon aufgebahrt. Die Standuhr, ahnungslos, dass dies in diesem Augenblick des Schweigens vollkommen unpassend sei, schlägt dumpf drei Mal und erntet dafür die vorwurfsvollen Blicke der Trauernden. Das Lenchen eilt hinzu und hält das Pendel an.
Die Kerzen brennen. Zahlreiche Bewohner der Stadt Oldenmoor wollen von dem angesehenen Toten Abschied nehmen. In sämtlichen Räumen des Hauses drängeln sich die Kondolierenden. Tante Alexandra versucht zu weinen, sie kann es aber nicht. Hans-Peter, inzwischen zum Artillerie-Fähnrich avanciert, und Johann stehen in ihren Uniformen neben dem Sarg und blicken den Verblichenen traurig an. Ewald ist noch nicht eingetroffen.
Harald Suhl, der enge Freund der Familie, dichtet bereits in Gedanken die Inschrift für Oliver von Steinbergs Grabstein: „Er war ein guter Sohn, ein musterhafter Vater und ein treuer Freund, Wohltäter der Armen, der Ehrlichste unter den Ehrlichen. Ruhe in Frieden für alle Ewigkeit.“
Das Lenchen weint bitterlich und blickt betrübt auf den Leichnam ihres geliebten Herrn, der nie wieder zurückkehren wird.
* * *
Ein Nachmittag im November 1918.
Die Familie ist nach dem Ende des furchtbaren Krieges wieder vereint. Die drei Brüder sind nach Hause zurückgekehrt; als Letzter Ewald, der einige Monate in einem Lazarett verbringen musste, um sich von den Folgen einer zwei Wochen langen Verschüttung in einer Wehrbefestigung an der belgischen Küste zu erholen.
Alle sind froh, dass zumindest Hans-Peter, Johann und Ewald die schlimme Zeit überlebten. Hans-Peter hält die Hand seiner Frau Annette, während Clarissa still auf den Knien ihres Patenonkels sitzt und mit ihren wachen, blauen Augen munter in die Runde blickt.
Das Lenchen schenkt die Bierkrüge mit dem Gerstensaft aus Udo Dammanns Brauerei voll und alle prosten sich gegenseitig zu. Hans-Peter erhebt sich.
„Ihr Lieben! Leider Gottes war es weder unserem lieben Papa noch unserem armen Bruder Christian vergönnt, diese Stunde zu erleben und mit uns zu verbringen. Ich bitte euch, euer Glas auf das Andenken unserer lieben Toten zu heben.“ Nachdem alle seiner Aufforderung Folge geleistet haben, führt er fort: „Dieser verlorene Krieg wird für unsere Heimat und auch für uns bittere Folgen haben. Wir alle werden es zu spüren bekommen und es sehr schwer haben. Deshalb müssen wir, mehr denn je, zusammenhalten und mit vereinten Kräften die auf uns zukommenden Widrigkeiten erfolgreich meistern und überwinden.“
Eine stille Träne kullert an Tante Alexandras Gesicht herab. Geistesabwesend trocknet sie ihre Wange mit einem Taschentuch.
* * *
Die Gestalten der Vergangenheit und ihre Stimmen sind für immer der Zeit gewichen. Doch das alte Esszimmer und der Salon blieben erhalten. Und jetzt, im Zwielicht des hereinbrechenden Abends, träumen sie von den Verblichenen.