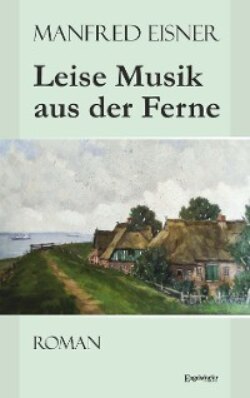Читать книгу Leise Musik aus der Ferne - Manfred Eisner - Страница 8
1. Clarissa
ОглавлениеClarissa zeichnet mit Kreide jene Landschaft auf die Tafel, die ihre Schüler später nachzeichnen sollen. Ein Häuschen mit Tür und Fenstern auf einem Hügel, daneben eine mächtige Esche. Wie bei uns zu Hause, denkt sie im gleichen Augenblick, in dem sie den mächtigen Stamm und die Äste zeichnet. Dazu einen Weg, der sich durch die Landschaft schlängelt, um sich am Horizont zu verlieren. Kreidewölkchen auf dem schwarzen Tafelhimmel, eine runde und fette Sonne mit funkelnden Strahlen, ein kleiner Teich, in dem Enten schwimmen …
Clarissa geht einige Schritte zurück, um ihr Werk zu begutachten. Das Murmeln der Stimmen hinter ihr nimmt zu und ebbt wieder ab, wie Orgelmusik. Ein Stuhl fällt um. Explosives Lachen.
„Ruhe!“, ruft die Lehrerin, indem sie sich den Schülern zuwendet. „Passt jetzt gut auf und seht euch das Bild, das ich auf die Tafel gezeichnet habe, genau an.“
Alle Augen richten sich auf das schwarze Rechteck. Ein kleiner Finger zeigt zur Decke.
„Fräulein von Steinberg!“
„Was willst du, Hannes?“
„Wie kommt es, dass das Dach von dem Haus bis in die Wolken hineingeht?“
Gelächter. Clarissa unterdrückt ein Lächeln. „Pst! Ruhe!“, ruft sie streng. Und dann fährt sie mit einer weichen Stimme fort: „Nein, Hannes. Das Dach ragt nicht in die Wolken hinein. Wenn man ein Haus von Weitem ansieht, bekommt man zwar diesen Eindruck, und auch auf Bildern und Fotografien ist es immer auf diese Weise zu sehen. Es kann ja auch gar nicht anders sein.“
Hannes gibt nicht auf. „Warum nicht?“
„Weil es nicht anders geht.“
Eine andere Hand schnellt hoch.
„Was ist, Gisela?“
„Hat das Haus nicht auch einen Schornstein?“
Clarissa lächelt. „Möchtest du, dass ich einen Schornstein hinzufüge?“
Gisela nickt eifrig mit dem Kopf.
„Also zeichnen wir eben einen Schornstein hinzu.“ Sie baut einen Schornstein aus Kreidestrichen auf das Dach.
Noch ein piepsiges Stimmchen: „Es feh’t noch was, Fräu’ein ’ehrerin!“
„Also sag schon!“
„Der Rauch.“
„Ach so. Ja, du hast recht!“ Und bald steigt Rauch aus dem Kamin in die Wolken empor. „Fehlt noch irgendetwas?“
„Es fehlt!“
„Was denn?“
„Eine Kuh.“
Lachen.
Die Lehrerin wirft einen hilflosen Blick auf ihre Schüler.
„Um Gottes willen, Wiebke! Warum willst du denn ausgerechnet eine Kuh auf diesem Bild haben?“
„Weil mir Kühe so gut gefallen.“
„Na gut. Wir zeichnen also noch deine Kuh hinein …“
Sie wendet sich wieder der Tafel zu und fängt an, die Kuh zu skizzieren. Die Schnauze, die Hörner, den Nacken, den Körper, den Schwanz …
„Da fehlt noch etwas, Fräulein von Steinberg!“
„Sag, Jochen, was fehlt?“
„Der Titt!“
Lautes Lachen, Aufruhr.
Clarissa schreit: „Ruuuhe! Jochen, benimm dich!“
Jochen senkt die Augen.
Clarissa bittet um Aufmerksamkeit. „Jetzt schaut euch bitte alle diese Landschaft genau an. Danach werde ich das Bild löschen und jeder von euch wird es in seinem Heft aus dem Gedächtnis nachzeichnen.“ Sie lässt einige Minuten verstreichen. „Achtung, ich lösche jetzt.“
Sie nimmt den Schwamm und die Landschaft aus Kreidestrichen verschwindet in einem weißen Nebel.
„So, und jetzt los, alles zeichnet!“
Sie geht an ihr Pult zurück. Vom Podium aus sieht sie auf ihre Schüler herab, und als sich die kleinen Köpfe über die Hefte beugen, hat sie den Eindruck, als ob eine Vielfalt farbiger Früchte – blond, braun, rötlich und hier und da dunkel – auf den Wellen eines Stromes schwimmen würde.
Welch eigenartiger Vergleich! Früchte! Wer weiß wohl, was einmal aus diesen Kindern wird? Wie viele große Männer und Frauen der Zukunft sitzen hier auf ihrer Schulbank, mit der Bleistiftspitze an der Zunge, eifrig bemüht, die Landschaft aufs Papier zu zaubern, die ihnen das „Fräu’ein ’ehrerin“ auf der Tafel vorgezeichnet hat?
Clarissa versinkt in ihren Gedanken. Helles Licht scheint durch die Fenster. Der Vormittag altert dahin. Ein Kalenderblatt an der Wand verkündet, dass wir heute den 20. September 1931 haben. Eine Weltkarte behauptet, dass die Erde eine Kugel mit abgeflachten Polen sei. Von den anderen Klassen dringen markante Stimmen herüber: Lehrer, die laut sprechen. Die dunkle Stimme von Herrn Möller aus der Fünften, Heikes schrille Stimmlage aus der Zweiten.
Clarissa steigt vom Podium herab und wandert mit den Händen auf dem Rücken durch die Reihen der Schulbänke. Sie gewöhnt sich jetzt langsam an die Kleinen. In den ersten Tagen war es ihr sehr mulmig zumute: Sie stand zum ersten Mal allein vor einer Schulklasse und sie hatte sogar Hemmungen, laut zu sprechen. Sie wurde rot, wenn sie sprach. Diese kleinen Gesichter – einige ernst, andere boshaft oder gehässig, andere wieder anscheinend gleichgültig oder frech und alle insgesamt irgendwie geheimnisvoll – hielten sie stets in Alarmbereitschaft. Sie befürchtete, dass irgend so ein kleiner Lümmel sie beschimpfen würde oder dass sie sich alle weigern würden, ihre Anordnungen zu befolgen.
Ihre Ängste schwanden jedoch nach und nach. Jetzt ist sie Herr der Lage – natürlich nicht immer …! Die Namen der meisten ihrer Schüler kennt sie bereits auswendig. Sie mag sie schon sehr, als ob sie ihr gehörten, ihre Brüder und Schwestern, ihre Kinder wären …
Eine schwache Stimme ist zu hören: „Fräulein von Steinberg!“
„Was ist, Beate?“
„Wenn man nicht zeichnen können …“
„Kann, Beate, kann …“
„Wenn ich nicht eine Kuh zeichnen kann, darf ich dafür eine Katze zeichnen?“
„Du darfst.“
Clarissa wandert weiter durch die Klasse. Sie verweilt vor einem Fenster. Wie verschieden ist doch eine wirkliche Landschaft von der, die man mit Kreide auf eine schwarze Tafel malen kann! Unmöglich, den ungewöhnlich blauen Septemberhimmel, die überwiegend noch grünen, aber schon leicht gelblich schimmernden Blätter der Bäume, die dunkle Marscherde, die grünen Wiesen und die Häuser aus roten Backsteinen nur schwarz-weiß wiederzugeben … Aber um bei der Wahrheit zu bleiben: Die von Malern erzeugten Bilder sind manchmal doch sehr viel schöner als die echte Natur, ist es nicht so?
Es vergehen einige Minuten. Clarissa fühlt eine Leere im Magen. Hunger? Ihr Blick wendet sich zur Uhr: halb zwölf.
In ihren Gedanken läuft ein Kurzfilm ab: die Diele im Herrenhaus, der Papa, die Mama, Tante Therese, das Esszimmer, der gedeckte Tisch, die schmackhafte frische Suppe, die das Lenchen in ihrer Küche zubereitet hat.
„Fräulein von Steinberg! Ich kann die Sonne nicht malen … sie wird nicht rund!“
Clarissa setzt sich neben Petra auf die Bank, nimmt ihr den Bleistift aus der Hand und zeichnet in deren Heft eine schöne, runde Sonne auf den Himmel aus kariertem Papier.
Der Unterricht ist für heute zu Ende. Die Schule, denkt Clarissa, gleicht einem riesigen Drachen, der durch das Maul des Hauptportals die Kinder ausspeit, die schreiend in einem Reigen aus farbigen Kleidern herausströmen. Genau wie die Tiere in den Märchen …
Der Drachen aus rotem Backstein mit den zwanzig Augen seiner Fenster wohnt auf einem Hügel. Zu seinen Füßen liegt Oldenmoor in der strahlenden Mittagssonne: Die vielen dunklen Reetdächer, vermischt mit hell- und dunkelroten Dachpfannen, kontrastieren mit dem bereits herbstgefärbten Laub der Bäume, mit den abgeernteten und längst wieder gepflügten Feldern, mit dem Grün der Tannen und Fichten. Die mit Katzenköpfen gepflasterten Straßen sehen aus wie dunkle Narben im Körper der Kleinstadt. Hoch über den Dächern ragt der mit Grünspan überzogene Kirchturm auf dem Marktplatz hervor.
Clarissa wartet auf Heike. Während des Wartens denkt sie nach. Wenn die Felder ein Meer wären – die durch die Entwässerungsfleete durchzogene Marsch besteht eher mehr aus Wasser als aus Land –, dann wäre Oldenmoor eine Insel. Eine verlorene Insel. Ein kleines Eiland mit eigenartigen, komischen Bewohnern. „Onkel“ Suhl, Hein Piepenbrink, Herrn Johansens Tanzkapelle, das Colosseum, der „Bildpalast“ – Herrn Ehlers’ Kino, das Café Petersen am Marktplatz …
Heike unterbricht Clarissas Gedankenausflug: „Wollen wir, Clarissa?“
„Ja, lass uns gehen!“
Gemeinsam gehen sie den Weg von der Schule hinunter in die Stadt. Heike, mit ihrer verbogenen Brille auf der roten, glänzenden Nase, beschwert sich unaufhörlich über ihre Klasse. Diese unruhigen, geschwätzigen, schlecht erzogenen Gören! Nicht zum Aushalten! Sie hat eine metallische Stimme, die sich anhört wie energische, rhythmische Hammerschläge. Sie spricht mit einem autoritären, belehrenden Gehabe, das manchen von denen, die immer unterrichten, so eigen ist. Stets sitzen ihre Strümpfe schief – Wollstrümpfe, dünne Beine, ausgetretene Schuhe. Trotzdem, Clarissa mag sie. Sie ist ihr die liebste ihrer Kollegen. Nicht eingebildet, gerade heraus, einfach. Und außerdem verlangt sie nicht einmal, dass man viel spricht: Sie sprudelt einfach los, und es stört sie nicht im Geringsten, wenn man ihr weder zuhört noch antwortet.
„Das Pensum ist ein Wahnsinn! Das Schuljahr ist viel zu kurz, um das alles zu schaffen!“ Sie spricht mit übertriebenem Staccato, als ob sie unsichtbare Nägel in die Luft einschlagen wolle. „Ich möchte gern denjenigen sehen, der das alles schaffen kann!“
Heike spricht weiter, ohne nach rechts oder nach links zu sehen, so als ob sie sich bei den Wolken beschweren wolle. Clarissas Gedanken wandern auf eigenen Wegen.
Die beiden Freundinnen biegen in die Deichstraße ein. Mit lautem Geratter fährt ein Automobil an ihnen vorbei. Ein Hund hebt das Bein und hinterlässt flüssige Arabesken an einem Lichtmast. Die Sonne wird von einer dicken Wolke verschluckt. Sie gehen weiter. Die blitzblanken Glasfenster der Häuser glitzern in der Sonne, die jetzt wieder vom blauen Himmel herunterscheint.
„Hast du die neuen Hüte im Modehaus Suhr gesehen?“
Clarissa schüttelt den Kopf: Sie hat nicht. Sollte etwa Heike diese komische neue Mode mögen, mit dem winzigen Kopfteil und den riesigen, weit herabhängenden Krempen, diese Hüte, die man so ganz hoch oben auf dem Scheitel trägt? Nein, nicht möglich! Heike trägt immer nur Baskenmützen. Einfach und billig.
Sie gehen jetzt schweigend nebeneinander her. In der Rathausstraße begegnen sie mehreren Passanten, die man gewohnheitsmäßig grüßt und die ebenso automatisch zurückgrüßen. Gegenüber dem Colosseum steht Frisör Johansen, der auch die Tanzkapelle leitet, vor seiner Tür und blättert in der Lokalzeitung. Sie sind an Heikes Wohnhaus angelangt.
„Tschüss!“
„Tschüss!“
Sie geben sich einen Kuss. Heike hat diese ekelige Angewohnheit, auf den Mund zu küssen. Clarissa muss sich zusammennehmen, um ihren Widerwillen zu verbergen.
In der Kaiserstraße kommt sie am Haus von Harald Suhl – „Onkel Suhl“ – vorbei, das hellbraun getünchte Gebäude mit dem spitzen Giebel, an dessen Obergeschoss der kunstvoll aus Eisen geschmiedete, grün gestrichene Balkon mit den schönen weißen Schwänen hervorragt. Und oben auf dem Dachfirst die Windfahne mit dem dürren, schwarzen Wetterhahn. Wie viele Erinnerungen sind mit diesem Hause verbunden! Als sie noch ein kleines Mädchen war, kam Clarissa eines Abends dort hin, um mit ihren Spielkameraden durch das Teleskop von Onkel Suhl zu schauen, eine von Grünspan überzogene Metallröhre. Der Alte mit seiner brüchigen Stimme gab seltsame Sprüche von sich, die niemand so recht verstand, lutschte ständig Pfefferminz-Pastillen und trug eine kleine Wollmütze auf dem kahlen Kopf.
„Kommt her, ihr dürft durch das Teleskop gucken“, lud er die Bande ein und knurrte wie ein misstrauischer, junger Hund.
Clarissa schaute durch das Okular des Rohres. Onkel Suhl erklärte alles: „Der Mond ist ein Satellit der Erde. Was du da gerade siehst, sind die Krater der erloschenen Vulkane auf der Mondoberfläche …“
Was Clarissa in Wirklichkeit sah, war irgendetwas Weißliches, Undeutliches und Undefinierbares.
„Hast du auch die Berge bemerkt?“, fragte er mit eigenartiger Stimme. „Und auch die Seleniten, die Mondmenschen?“
Clarissa hatte Angst vor Onkel Suhl. Sie bejahte, nur damit er nicht ärgerlich wurde. Aber Vetter Heiko lachte frech in das Gesicht des Alten: „Ach was! Nix ist da zu bemerken! Dein Periskop taugt nix, Onkel Suhl!“
„Du Lump!“, fuhr ihn der Alte an, in einem Ton zwischen Entrüstung und Belustigung.
Sie zuckte zusammen. Was für ein furchtloser Knabe war doch der Heiko. Er hatte tatsächlich den Mut, dem Onkel Suhl zu widersprechen …
Danach stieg die ganze Bande die dunkle Stiege hinab. Aufgescheuchte Mäuse huschten an ihnen vorbei. Auf dem Schreibtisch dieses seltsamen Alten lag ein furchterregender Totenkopf. Clarissa schloss fest ihre Augen und eilte an diesem vorbei. Ach! Dieses obere Stockwerk war doch sehr geheimnisvoll!
Während Clarissa weitergeht, wandern auch ihre Gedanken. Junge Menschen lernen, durch Studium und Bücherlesen vieles besser zu verstehen. Eigenartigerweise fühlen sie später trotzdem oft noch genau dasselbe, was sie schon als Kinder einmal empfanden. Manche Eindrücke sind auch durch den gereiften Verstand nicht zu verdrängen … So behaupten wir zum Beispiel, dass wir nicht an Geister glauben. Aber die Wahrheit ist doch, dass wir nicht ohne eine gewisse Angst ein dunkles Zimmer betreten oder an Spukhäusern oder am Kirchhof rasch vorbeieilen, ohne hinzusehen …
Das Lenchen serviert das Mittagsmahl. Sie bringt die Suppenterrine auf einem Tablett herein. Mit ihrem ergrauten Haar und ihrer weißen Küchenschürze um die volle Taille erinnert sie Clarissa an eine Reklame für Scheuermittel, die sie in einer Zeitschrift gesehen hat: „Ich putze meine Töpfe nur mit Blitzblank!“
Der Papa sitzt an seinem angestammten Platz. Er bindet sich eine Serviette um den Hals, nachdem er damit – unausbleiblich! – sorgfältig seinen Löffel geputzt hat, und hüstelt.
Die Mama hebt den Deckel der Terrine an. Dampf steigt in die Luft und verbreitet einen appetitlichen Duft. Frau Annette taucht die silberne Suppenkelle in die Schüssel. „Suppe, Hans-Peter?“
Der Gatte nickt.
„Auch du, meine Kleine?“
„Ja, bitte.“
Tante Therese mit ihren großen, rehbraunen Augen in dem gelblichen Gesicht versichert, dass sie keinen Hunger habe und lehnt dankend ab.
„Vergiss deine Lebertropfen nicht, Schwester.“
Tante Therese ist die Schwester der Mama. Seit zwölf Jahren ist sie mit Hein Piepenbrink verlobt. Die ganze Familie fragt sich: „Also, wann wird nun endlich geheiratet?“ Der Bräutigam beteuert immer wieder, dass er sofort heiraten werde, wenn man ihm endlich die versprochene Gehaltsaufbesserung auszahle; diese jedoch lässt schon sehr lange auf sich warten. Und so vergeht ein Tag nach dem anderen.
„Heute habe ich wieder mit der Bank verhandelt“, klagt Hans-Peter. „Ich kriege schon graue Haare wegen dieser verwünschten Wechsel …“
Frau Annette seufzt. Hans-Peters Gesicht verfinstert sich. Und Clarissa ahnt, dass das, was jetzt kommen wird, ja kommen muss, das, was die Frauen so fürchten: Geschäftliches!
In den Wirren der Inflation verlor der Papa das gesamte Gut mit all seinen Gebäuden, Wäldern, Ländereien und dem Vieh. Es verblieb ihnen fast gar nichts. Jetzt besitzt man nur noch dieses riesige Stadthaus, aus dem aber die Freude ausgezogen ist. In früheren Zeiten lachten alle und unterhielten sich angeregt bei den Mahlzeiten. Jetzt herrschen nur noch Mutlosigkeit und Traurigkeit und es wird lediglich vom Sparen gesprochen: weniger Fleisch, keine Butter, nicht so viel Strom zu verbrauchen, nicht so viele Kohlen zu verheizen … Gelegentlich scheint es, als ob man die Sorgen vergessen hat und es belebt sich die Unterhaltung. Wenn aber jemand das leidige Wort „Geld“ ausspricht – dann passiert es: Alle verharren mit betrübten Gesichtern.
Geld, Geld! Gibt es denn auf dieser Welt nichts Wichtigeres als Geld? Beklommen stellt sich Clarissa selbst diese Frage.
Der Papa erwähnte soeben die Bankwechsel. Niemand hat jetzt noch Appetit.
Clarissa versucht die Situation zu retten, das Gespräch in andere Bahnen zu leiten: „Heute gab ich meinen Schülern die Aufgabe, eine Landschaft mit einem Haus …“
Niemand hört ihr zu. Anscheinend hat der Papa lediglich das Wort „Haus“ wahrgenommen, weil er sofort die Tochter unterbricht, indem er bemerkt: „Wenn ich schließlich und endlich wenigstens dieses Haus retten kann, dann wäre ich schon sehr zufrieden …“
Er schiebt den Suppenteller von sich. Tante Therese zählt zwanzig Lebertropfen auf einen Suppenlöffel.
„Lene, servieren Sie jetzt bitte den Hauptgang“, sagt Frau Annette.
An der Wand hängt in einem versilberten Rahmen eine Kopie des „Letzten Abendmahls“ von Leonardo da Vinci. Brot und Wein. Clarissa wirft ihren Blick auf das Bild und vertieft sich in ihre Gedanken … Plötzlich hat sie den Eindruck, als ob Jesus sie vom Bild herab etwas spöttisch anblicke und ihr sagen wolle: „Wir zwei sind uns wohl nicht so ganz einig, nicht wahr, Clarissa?“