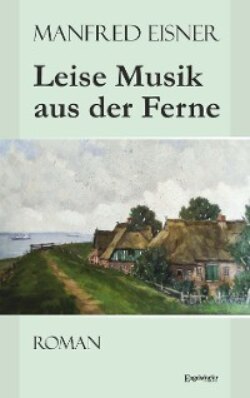Читать книгу Leise Musik aus der Ferne - Manfred Eisner - Страница 7
Wie der Zufall so spielt
ОглавлениеAn jenem kaltfeuchten und nebligen, späten Herbstnachmittag war ich in der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofes mit hochgeschlagenem Regenmantelkragen neugierig vor einem Plakat am Deutschen Schauspielhaus stehen geblieben, um mir die Übersicht des Spielplans anzusehen. Ganz plötzlich begann es heftig zu regnen und ich suchte rasch Unterschlupf in der ersten offenen Tür, die sich mir in der Nähe bot.
Die feuchte Kneipenwärme schlug sich augenblicklich auf meine Brillengläser nieder. Während ich die Brille mit dem Taschentuch reinigte, sah ich mich in dem von Rauch benebelten Lokal um. Sämtliche Tische waren besetzt und auch an der Theke herrschte reger Andrang. Lesend saß ein einsamer Gast an einem Ecktisch im Hintergrund vor einem halbvollen Bierglas. Ich trat an ihn heran und fragte, ob ich an seinem Tisch Platz nehmen dürfe. Er blickte von dem abgegriffenen, dicken Heft auf und nickte mir freundlich zu.
Ich hängte meinen nassen Regenmantel an einen Garderobenhaken und setzte mich an seinen Tisch. Bei dem schwitzenden Kellner, der gerade eilig vorbeihuschte, bestellte ich ein Alsterwasser. Danach wandte ich mich meinem Tischnachbarn zu, der sich inzwischen wieder seiner Lektüre widmete. Es war ein älterer, grauhaariger Mann. Seine leicht gebräunte Haut ließ den Südländer vermuten. Als ich ihn vorher angesprochen hatte, waren mir die dunklen Augen aufgefallen, die mich mit einem lebhaften Blick unter seinen buschigen, ebenfalls ergrauten Augenbrauen aufmerksam gemustert hatten. Er hatte ein von den Jahren gegerbtes, interessant wirkendes Gesicht und seine Stirn war von tiefen Falten zerfurcht. Diese verliefen so gleichmäßig wie mit einem Pflug auf dem Acker gezogene Gräben. Trotz der muffigen Wärme im Lokal trug er einen leger um den Hals geschlungenen roten Wollschal und einen ziemlich abgetragenen grünen Lodenjanker, unter dem ein dunkelgrüner Rollkragenpullover zum Vorschein kam.
Der Kellner brachte mir das Alsterwasser. Der Mann blickte von seiner Lektüre auf und ich prostete ihm zu. Freundlich lächelnd griff er nach seinem Bierglas und hob es mir entgegen. Hastig trank ich einen langen Schluck.
„Haben Sie großen Durst?“, fragte er mit verständnisvollem Schmunzeln. Seine Stimme war tief und männlich und klang sehr melodisch. Obwohl seine Aussprache durchaus korrekt war, hörte ich einen unverkennbar ausländischen Akzent heraus.
„Oh, ja, sogar einen riesigen!“, gab ich aufrichtig zu und stellte mein Glas auf dem Bierdeckel ab. „Leben Sie schon lange in Deutschland?“
„Schon seit fast fünf Jahren“, erwiderte er, indem er sein Heft zuklappte und es auf den Tisch legte, wohl als freundliches Zeichen dafür, dass er sich gern mit mir unterhalten wollte.
„Sie sprechen sehr gut deutsch“, stellte ich der Höflichkeit halber fest.
„Wissen Sie, ich komme aus Brasilien, aus dem Staate Rio Grande do Sul, wo es schon seit vielen Generationen eine Menge deutschstämmiger Brasilianer gibt. Ich bin dort in einer der kleineren Städte geboren und aufgewachsen, besuchte aber im Ort eine Schule, in der die deutsche Sprache als Wahlfach bis zum Abitur belegt werden konnte. Dafür hat mein Vater gesorgt, denn er hatte eine besondere Vorliebe für deutsche Komponisten und Schriftsteller. Er gab mir sogar einen deutschen, na ja, sagen wir eher, einen fast deutschen Vornamen. Da wir schon bei diesem Thema angelangt sind“, sagte er, indem er sich förmlich erhob und mir seine Hand entgegenhielt, „darf ich mich doch vorstellen: Érico Veríssimo.“
„Welch ein Zufall!“, entgegnete ich vergnügt und ergriff die dargebotene Hand. „Mein Vater hieß ebenfalls Erich.“ Ich stellte mich vor.
„Sehr angenehm, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ich weiß, hier sagt den Leuten mein Name nicht viel. Ich bin Schriftsteller, und in meiner Heimat sogar ein ziemlich bekannter“, sagte er, nicht ohne einen gewissen Stolz.
„Ach“, sagte ich, „das ist ja sehr interessant. Es ist doch für einen Schriftsteller sicherlich sehr beschwerlich, außerhalb seines heimatlichen Sprachgebietes zu wirken. In diesem Zusammenhang fällt mir gerade Stefan Zweig ein. Kurz nach der Machtergreifung durch die Nazis und dem Anschluss Österreichs zog er es vor, Deutschland zu verlassen und fand Zuflucht in Brasilien. Obwohl er dort sein wunderbares Werk ‚Brasil‘ schrieb, als Dank an Ihr Land, das ihm so gastfreundlich Asyl gewährte, konnte er die Trennung von seinem eigenen sprachlichen Umfeld nie verwinden, war voller Heimweh und nahm sich schließlich das Leben.“
„Ja, das war wirklich eine tragische Geschichte. Ich bin ihm leider nicht persönlich begegnet, weil er in Petropolis bei Rio wohnte, sehr weit weg von meiner Stadt. Allerdings war er mir als Autor schon damals bestens bekannt und ich hatte die meisten seiner Novellen und Biografien mit Begeisterung gelesen.“ Er machte eine Pause. „Da gibt es auch eine gewisse Parallelität der Ereignisse“, sagte er dann: „Sehen Sie, auch ich musste leider aus ähnlichen Gründen wie Stefan Zweig meine Heimat verlassen!“
„Wieso?“ Ich sah ihn verwundert an. „Wurden Sie etwa auch verfolgt? In Brasilien?“
„Bedauerlicherweise ja! Sicherlich wissen Sie es, mein Land leidet schon seit Jahren unter einer Militärdiktatur. Kaum jemand im Ausland kann es ahnen, wie gemein und brutal diese Schergen jeden verfolgen, der es wagt, gegen ihre Willkür aufzumucken und etwa ihre Schandtaten öffentlich beim Namen zu nennen. Wer nicht kuscht, muss hart darunter leiden! Als Schriftsteller ist man natürlich besonders gefährdet, außer man ist gewillt, sich denen unterzuordnen oder wenigstens folgsam zu schweigen. So musste ich wegen eines recht kritischen politischen Artikels fliehen, den ich in einer der wenigen damals noch erscheinenden, frei denkenden Zeitungen verfasst hatte.“
Mehrfach hatte ich bei seinen Worten zustimmend genickt. Auch mir war hinreichend bekannt, wie wenig zimperlich lateinamerikanische Diktatoren mit ihren Gegnern umzugehen pflegten.
„Glücklicherweise“, setzte er fort, „wurde ich von einem Vetter, einem Polizisten, noch gerade rechtzeitig vor meiner bevorstehenden Verhaftung gewarnt. In derselben Nacht verließ ich mein Haus und machte mich zu Fuß auf den Weg. Nach einer langen Woche, während der ich mich tagsüber versteckt hielt und nur bei Anbruch der Dunkelheit auf die Straße wagte, überschritt ich heimlich die Grenze zu Uruguay, das ja an den Staat Rio Grande do Sul angrenzt. Dort war ich in Sicherheit! Mir wäre es mit Bestimmtheit sehr übel ergangen, hätten mich diese bösen Buben erwischt!“
Wir schwiegen. Diese Schilderung hatte offensichtlich in ihm die ganze Tragödie seines Schicksals aufgewühlt, denn er schnaufte heftig und aufgeregt. Seine Augen verrieten die aufgestaute Wut und den Hass auf seine Verfolger. Als ob er einen bitteren Geschmack in seiner Kehle wegwaschen wollte, leerte er das Bierglas mit einem Schluck.
Ich tat es ihm gleich. Dann winkte ich den Ober heran und bestellte für uns beide nach.
„Und wie kamen Sie dann hierher?“, fragte ich neugierig. Sein ärgerlicher Blick wich ebenso rasch, wie er aufgekommen war.
„Für einige Monate lebte ich in Montevideo. Dort ergab sich jedoch für mich keine Möglichkeit, Fuß zu fassen. Die dortige Landessprache ist zwar Spanisch, die ich auch spreche und verstehe, da sie dem brasilianischen Portugiesisch ziemlich ähnlich ist.“ Er lächelte: „Wir nennen dort aus Spaß die bunte Mischung aus beiden Sprachen ‚Portuňol‘. Daher beherrsche ich das Kastilianische eben doch nicht gut genug, um in dem Stil, der mir eigen ist, Essays oder Romane zu schreiben. Ich schrieb also zunächst in meiner Muttersprache, fand aber in Brasilien keinen Verlag, der es nach meiner Flucht gewagt hätte, meine im Exil geschriebenen Werke zu publizieren. Anfänglich erhielt ich noch eine kleine finanzielle Unterstützung seitens meiner Familie, aber die hatte es auch ziemlich schwer und so konnte es einfach nicht weitergehen. Damals kam mir der Zufall zu Hilfe, in Form einer Begegnung mit dem Kulturattachée der Deutschen Botschaft. Dieser Herr freute sich sehr, mich kennenzulernen, denn ich war ihm als Autor bekannt. Als er mehrere Jahre an der Botschaft Ihres Landes in Brasilien gewesen war, hatte er einige meiner Bücher gelesen. Mit seiner freundlichen Unterstützung und mit Hilfe des Goethe-Instituts erhielt ich bald darauf ein Stipendium von einer privaten Stiftung für Fortbildung von Künstlern, um in Deutschland für zwei Jahre meine Sprachkenntnisse zu verbessern.“
Er machte eine kurze Pause und wir tranken aus den Gläsern, die uns der Kellner zwischenzeitlich gebracht hatte. Dann fuhr er fort: „So kam ich vor fünf Jahren nach Deutschland. Erst lebte ich in Bonn. Später, nach Beendigung des Studiums, zog ich nach Hamburg. Hier hatte man mir eine Stellung als Übersetzer für Portugiesisch angeboten. Ich kann davon eigentlich gut leben. Ganz bescheiden, keine großen Sprünge, verstehen Sie? Aber ich bin zufrieden. Ein alter Mann wie ich hat keine extravaganten Bedürfnisse mehr!“
„Schreiben Sie noch?“
„Oh, ja, leidenschaftlich gern. Und nicht nur auf Portugiesisch. Weil Sie mich gerade fragen: Sehen Sie, hier“, sagte er, indem er auf das dicke Heft auf dem Tisch deutete: „Ich habe mich sogar schon in der deutschen Sprache versucht!“
„Und was ist es, etwa ein Roman?“, fragte ich gespannt.
Veríssimo nickte lächelnd. „Ja, genau! Ein Roman. Und für mich sogar ein ganz besonderer. Aber ich weiß nicht, ob Sie das überhaupt interessieren wird.“
„Doch, doch, erzählen Sie, bitte!“, bedrängte ich ihn. Er hatte mich tatsächlich neugierig gemacht.
„Also gut. Die Originalfassung dieses Romans habe ich schon vor vielen Jahren, genauer gesagt im Jahre 1934, in Brasilien geschrieben, um an einem Literaturwettbewerb teilzunehmen. Er wurde prämiert und das Buch wurde sogar ein Erfolg.“ Er machte eine Pause und setzte nachdenklich fort: „Vielleicht wissen Sie, wie es in der Gedankenwelt des Autors einer von ihm verfassten Geschichte geht. Mit der Zeit identifiziert er sich dermaßen mit den Personen seines Werkes, dass diese für ihn an Realität gewinnen, so als ob sie in Wirklichkeit existierten. Er beschäftigt sich mit ihnen derart intensiv, bis sie seine Gedanken vollkommen beherrschen. Er kommuniziert und lebt sozusagen Tag für Tag mit ihnen. So ging es auch mir mit meiner ‚Musica ao Longe‘. Vor etwa einem Jahr kam mir zunächst die Idee, dieses Buch ins Deutsche zu übersetzen. Aber dann fand ich, dass es für den hiesigen Leser wohl kaum besonders interessant sein würde. Die damalige Zeit liegt weit zurück und der Ort und die Hintergründe der Handlung würden hierzulande kaum Anklang finden. Daher ließ ich diesen Gedanken fallen.
Dann geschah plötzlich in meiner Gedankenwelt eine eigenartige Metamorphose: Meine Hauptfiguren, Clarissa und Vasco, spukten immer heftiger in meiner Fantasie herum, und siehe da, eines Tages verwandelten sie sich in Clarissa und Heiko! Und so entstand nach und nach diese ‚Leise Musik aus der Ferne‘.“ Er blätterte in dem abgegriffenen Heft. „Aus dem kleinen Städtchen Jacarecangá im Staate Rio Grande wurde Oldenmoor, irgendwo im Nordwesten Schleswig-Holsteins zwischen Marsch und Geest. Die stolze Sippe der Albuquerques wandelte sich in die herrschaftliche Familie von Steinberg; Seu Locadio Santarem, mein liebenswerter und schalkhafter Pseudoweise, schlüpfte in die Hülle von ‚Onkel‘ Harald Suhl. Aus dem italienischen Bäckersohn ‚Pé de Cachimbo‘ Gamba wurde sein polnisches Konterfei ‚Klumpfuß‘ Rembowski. Den anderen Romanfiguren erging es ebenso.“
Er trank einen Schluck und besann sich für einen Augenblick. Dann fuhr er fort: „Die geänderten Persönlichkeiten, der Umzug aus dem fernen Brasilien in die hiesige Umgebung, eine vollkommen anders geartete Welt, und, vor allem, der rundweg ungleiche zeitlichhistorische Hintergrund, der gerade in dem Deutschland der schicksalhaften neunzehnhundertdreißiger Jahre eine so bedeutende Rolle spielt, verliehen den Figuren und deren Rollen in meinem Roman eine besondere Eigendynamik, die allerdings, wie ich recht hoffen will, dem Charme meiner ursprünglichen Geschichte keineswegs geschadet hat.“
Ich hatte ihm aufmerksam zugehört und war tief beeindruckt. „Könnte ich mir vielleicht das Buch einmal ansehen?“, fragte ich darauf.
„Ich hätte eigentlich nichts dagegen“, antwortete er mit dem ihm so eigenen Schmunzeln. „Doch leider ist meine Handschrift ziemlich unleserlich und dieses Manuskript steckt voller Korrekturen. So ergibt es wirklich keinen Sinn!“
Während der folgenden Pause sah er mich an. Dabei musste er offensichtlich die Enttäuschung, die auf meinem Gesicht geschrieben stand, bemerkt haben, denn er fügte rasch hinzu: „Wenn Sie es aber wirklich möchten, kann ich Ihnen ein wenig daraus vorlesen.“
„Das finde ich sogar noch viel besser!“, sagte ich.
Der Schriftsteller klappte sein Manuskript auf und las mit melodischer Stimme vor.