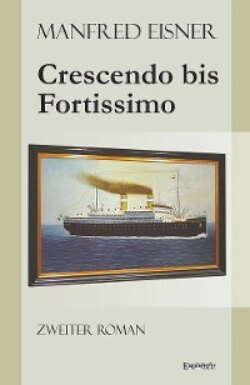Читать книгу Crescendo bis Fortissimo - Manfred Eisner - Страница 13
6. Bedrängnis
ОглавлениеClarissa sitzt in ihrem Zimmer und schreibt in ihr Tagebuch:
Gestern Abend waren wir bei den Eltern. Der Papa hat Heiko ernsthaft ins Gewissen geredet, damit er endlich seine Bibliothek von jenen politischen Büchern bereinigt, deren Besitz heute so gefährlich ist. Als der Papa noch dazu empfahl, auch die „undeutschen“ Bücher zu entfernen, wurde der Deichkater sehr zornig und es gab eine hitzige Diskussion. Ich verstehe Heiko sehr gut und muss ihm recht geben. Was bedeutet überhaupt „undeutsch“? Wie können Bücher, die von weltberühmten deutschen Schriftstellern in einer so herrlichen deutschen Sprache geschrieben wurden, als „undeutsch“ bezeichnet werden? Nur weil deren Verfasser vielleicht anders dachten und denken als diejenigen, die heute – leider – bei uns das Sagen haben? Wer gibt ihnen dieses Recht? Warum hat eigentlich das Leben so viel mit Politik zu tun? Die Antworten auf meine Fragen, wenn es sie überhaupt gibt, kommen und verschwinden im Rauschen des Windes. Ich befürchte sehr, dass sich dieser Wind eines Tages zu einem Orkan steigern wird, der über uns alle hinwegfegt.
Der Papa und auch die Mama haben schließlich Heiko grundsätzlich recht gegeben, aber ihm dennoch sehr ans Herz gelegt, an uns alle zu denken. Jetzt, nachdem unsere Hausgehilfin (Silke hat mich nach ihrem letzten BDM-Abend belehrt, dass sie jetzt nur noch so bezeichnet werden möchte, das hätte die Vorsitzende der NS-Frauenschaft so verkündet) sich derart an seinen Büchern zu schaffen gemacht habe, sei es höchste Zeit, das Richtige zu tun. Natürlich haben meine Eltern damit auch recht. Aber was ist jetzt noch das Richtige? Gegen Ende dieser Unterhaltung war der Deichkater äußerst wortkarg. Man konnte ihm ansehen, dass er sehr angestrengt darüber nachdachte, was er nun unternehmen solle.
Gerade als wir aufgestanden waren, um nach Hause zu gehen, kam Onkel Johann, eingehüllt in seine übliche Bierfahne, von seiner Stammkneipe. Trotzdem war er sehr nett zu uns und wir blieben noch ein Weilchen. Er erzählte von Friedrich Winklers Verhaftung. Es habe im Gasthof einen ziemlich heftigen Wortwechsel über dieses Thema gegeben. Als die Diskussion in Streiterei auszuarten drohte, habe der Wirt bei der Polizei angerufen. Weil Onkel Johann dies bemerkte, habe er schnell gezahlt und sei nach Hause gegangen.
Obwohl mein Patenonkel nicht ganz vom Bier ablassen kann, trinkt er jetzt nicht mehr so viel wie früher. Nachdem er schwer erkrankt war, musste er eine Abmagerungskur machen und sieht heute wieder besser aus. Er ist nicht mehr so apathisch wie früher, aber ich muss trotzdem noch jedes Mal schmunzeln, wenn er mit fast geschlossenen Augen und mit den über dem Leib gekreuzten Händen auf dem Sofa thront und so aussieht, als ob er eingeschlafen sei. Nur dann und wann öffnet er ein wenig die Augen und gibt sein seufzendes „Ach, mein lieber Gott!“ von sich.
Onkel Johann ist für mich eine tragikomische Figur. Obwohl er eine kaufmännische Lehre absolvierte, gelang es ihm nie, sich dazu zu entschließen, einer geregelten Arbeit nachzugehen. Selbst als der Papa anfing, bei Hannes Timm zu arbeiten und ihm seitdem immer wieder vorhielt, dass es auch für ihn notwendig sei, seinen Unterhalt zu verdienen, machte er keinerlei Anstalten, sich um eine Stellung zu bemühen. So liegt er nach wie vor der Familie auf der Tasche. Heiko wird jedes Mal wütend, wenn dieses Thema aufkommt. Abgesehen davon bin ich sehr glücklich darüber, dass der Papa und die Mama sich jetzt mit dem Deichkater gut verstehen, was ja beileibe nicht immer so war.
Als wir dann endlich nach Hause fuhren, war Heiko entspannt und ausgelassen. Er pfiff fröhlich vor sich hin. Ich war über seinen Frohsinn sehr verwundert. Unser ernstes Problem ist doch noch keineswegs gelöst. Als ich ihn darauf ansprach, sagte er lächelnd: „Machen Sie sich nur keine Sorgen mehr, Prinzessin, der böse Drachen ist schon so gut wie besiegt!“ Was hat er bloß wieder vor? Ich hoffe nur, dass es das Richtige ist.
Ich freue mich schon riesig auf den zweiten Weihnachtstag. Die ganze Bande wieder beisammen! Heiko rief heute Morgen vom Büro aus an und sagte mir, dass der Klumpfuß (ich muss mir endlich abgewöhnen, den Josef so zu nennen!), also dass Josef, nach eindringlichem Zureden schließlich eingewilligt hat, auch dabei zu sein. Ich bin so froh, dass wir uns alle nach so langer Zeit wieder treffen werden!
Ach, liebes Tagebuch, wie gern möchte ich Dir all die vielen Gedanken anvertrauen, die mir in diesem Augenblick durch den Kopf gehen. Leider kann dies für uns alle gefährlich werden, jetzt mehr denn je. Aber Du verstehst mich, nicht wahr?
„Frau Keller!“ Silkes Ruf kommt von der Diele.
Clarissa legt den Füller nieder und schließt eilig das Tagebuch. Sie geht rasch an die Tür.
„Was ist los, Silke?“
„Hier ist ein Junge, den ich nicht kenne. Er sagt, er möchte Sie sprechen. Seinen Namen will er aber nicht nennen.“
Clarissa geht einige Schritte vor. Als sie sieht, von wem da die Rede ist, sagt sie, indem sie ihre Aufregung zu verbergen sucht: „Ach, du bist es! Junge, bist du aber gewachsen! Es ist schon gut, Silke, es ist einer meiner früheren Schüler. Komm bitte herein, am besten gleich hier in mein Arbeitszimmer.“
Clarissa hält einem etwa zwölfjährigen, blassen und mageren Jungen in kurzen Hosen die Tür auf. Verängstigt knetet er mit beiden Händen seine Schiebermütze. Er geht an Clarissa vorbei und diese schließt die Tür, nachdem sie sich durch einen schnellen Blick in die Diele vergewissert hat, dass Silke wieder in der Küche verschwunden ist.
„Moses Kovacs, bin ich richtig?“, flüstert sie leise, während sie ihn neugierig mustert.
Der Junge schaut sie mit seinen dunklen Augen an und nickt wortlos. „Fräulein von St..., entschuldigen Sie, Frau Keller“, stammelt er verlegen.
„Wie hast du mich überhaupt gefunden?“
„Ich habe im Telefonbuch Ihren früheren Namen gesucht und die Nummer, die dort angegeben ist, angerufen. Ihre Mutter hat mir gesagt, dass Sie jetzt Keller heißen und hier wohnen. Da bin ich einfach hergekommen.“
„Und was führt dich zu mir, Moses?“, fragt Clarissa beklommen. Sie ahnt, dass der Junge all dies nur wegen einer bitteren Not auf sich genommen hat.
„Frau Keller, entschuldigen Sie bitte, dass ich zu Ihnen gekommen bin, aber ich wusste wirklich nicht mehr, was ich jetzt tun soll!“, entfährt es Moses. Eine Träne entweicht einem seiner Augen und kullert über die inzwischen von Erregung errötete Wange.
„Ist ja gut, Moses, beruhige dich. Setz dich erst einmal. Willst du etwas zu trinken haben?“
Nachdem der Junge den Kopf geschüttelt hat und sich beide gesetzt haben, fragt Clarissa: „So, und jetzt erzählst du mir in aller Ruhe, was dich bedrückt. Du brauchst vor mir keine Angst zu haben, das weißt du doch?“
„Ja, Frau Keller. Sie sind der einzige Mensch, zu dem ich noch Vertrauen habe. Deswegen bin ich ja zu Ihnen gekommen.“ Er macht eine Pause.
„Also gut, was ist los?“ Clarissas Stimme klingt weich und freundlich, um dem Jungen die Angst zu nehmen.
„Der Rektor hat mich gestern aus der Schule geworfen! Weil ich doch Jude bin!“
Die Inbrunst, mit der diese Klage an Clarissa herangetragen wird, erschüttert sie mehr als die Tatsache selbst. Sie hält einen Moment inne, um sich die richtigen Worte zurechtzulegen.
„Ja, Moses, ich weiß. Es ist sehr schlimm und auch sehr ungerecht. Aber so, wie die Dinge heute stehen, ist es kaum möglich, etwas dagegen zu tun. Haben deine Eltern nicht mit dir darüber gesprochen? Hast du von den neuen Gesetzen gegen die Juden gehört?“
Moses nickt. „Ja. Mein Vater und meine Mutter sind ganz verzweifelt. Wir wissen nicht mehr, was wir machen sollen. Die Mutter sitzt nur noch zu Hause und weint den ganzen Tag. Vater ist Schuster und hat Arbeit beim Schuhmachermeister Lorenzen. Der Meister ist sehr gut zu ihm, aber seine Frau, die Ulrike, die hackt in der letzten Zeit immer auf Vater herum. Er hat neulich gehört, wie sich die beiden seinetwegen in der Küche gestritten haben. Sie hat gesagt: ‚Wenn du den Jud’ nicht bald auf die Straße setzt, werden die Leute nicht mehr bei uns kaufen!‘ Ach, Frau Keller, ich bin so unglücklich. Was soll nur aus uns werden? Warum machen die das mit uns? Was haben wir ihnen nur getan, dass sie uns so hassen?“
„Moses, ich kann sehr gut nachfühlen, wie dir zumute sein muss. Ich kann dir aber auch nur sagen, dass es mir sehr leidtut. Die heutige Lage ist schwierig, auch für uns! Es fällt mir nicht gerade leicht, einem zwölfjährigen Jungen etwas derart Kompliziertes zu erklären. Weißt du, die meisten Erwachsenen können es auch nicht verstehen, das kannst du mir glauben.“
Clarissa macht eine Denkpause. Danach fährt sie fort:
„Vielleicht kann ich es dir so verständlich machen: Es gibt gute und böse, starke und schwache Menschen. Ist die Mehrzahl der guten Menschen stark, dann ist alles in Ordnung. Sind dagegen die Bösen stark und in der Überzahl, hingegen die Guten zu schwach, um sich deren Machenschaften zu widersetzen, dann machen die Bösen mit den Guten, was sie wollen und es kommt zu solchen Situationen, wie wir sie jetzt erleben.“
Moses sieht Clarissa mit einem Ausdruck an, der ihr verrät, dass der Junge sichtlich enttäuscht ist. Er hat doch Hilfe von ihr erwartet. Sie hat ihm bisher nichts anderes gegeben als Worte.
Clarissa fühlt Hilflosigkeit. Was soll sie, was kann sie für ihn tun? „Nun, Moses, in diesem Moment kann ich dir wirklich nicht genau sagen, was für euch das Beste ist. Haben deine Eltern schon mal darüber nachgedacht auszuwandern? In ein anderes Land zu gehen?“
„Ja, ich habe zwei oder drei Mal gehört, wie sie darüber sprachen. Mehr weiß ich nicht. Ich will aber nicht von hier weg! Warum auch? Hier habe ich doch alle meine Fr...“ An diesem Punkt unterbricht Moses den Satz. Bittere Tränen kullern jetzt aus seinen Augen. Zutiefst gedemütigt muss er an die gestrige Szene denken, als er unter den lauten Rufen seiner Klassenkameraden („Ohne Jud’ ist sehr gut! Jud’ ans Messer ist noch besser!“) vom Rektor aus der Schule geworfen wurde. Er hat in seiner Erinnerung aber auch die Gesichter derjenigen drei Freunde festgehalten, die nicht mitgeschrien, sondern nur traurig geguckt haben. Ja, Frau Keller hat schon recht: die wenigen, schwachen Guten.
„Was willst du wegen der Schule machen?“
„Rektor Schneider sagte mir, dass ich von jetzt an in die Judenschule gehen solle, da gehören meinesgleichen hin. Soviel ich weiß, soll es in Kiel eine jüdische Schule geben. Aber wie komme ich von Oldenmoor nach Kiel?“
„Nein, das geht wirklich nicht.“ Clarissa denkt einen Augenblick nach. „Weißt du, Moses, ich habe eine Idee. Jetzt gehst du erst einmal nach Hause. Ich werde heute Abend, wenn mein Mann von der Arbeit kommt, alles mit ihm besprechen. Er ist ein sehr guter Mensch und ich bin mir sicher, er wird viel Verständnis für eure Lage aufbringen. Er hat auch immer gute Einfälle, wie man aus solchen Schwierigkeiten herauskommen kann.“
Clarissa macht eine Pause. Überlege jetzt genau, sagt sie sich, was du dem Jungen sagst!
„Am besten, du gehst in zwei Tagen noch mal zu meiner Mutter – du weißt schon. Sie wird mich dann benachrichtigen und ich werde ihr wiederum sagen, was sie dir ausrichten soll, wenn du sie wieder besuchst – sagen wir, einen Tag danach. Bitte versteh das nicht falsch, aber ...“
„Ich habe genau verstanden, Frau Keller. Ich möchte Ihnen keine Schwierigkeiten verursachen. Es war nur so, ich wusste wirklich nicht mehr ...“
„Ist schon gut, mein Junge. Und sage niemandem, dass du heute hier gewesen bist. Versprichst du mir das?“
„Ja, ich verspreche es Ihnen. Auch meine Eltern wissen nicht, dass ich zu Ihnen gekommen bin.“
Clarissa begleitet den Jungen zur Haustür. Er gibt ihr die Hand und macht einen tiefen Diener. Danach verschwindet er in der nebligen Dunkelheit.
Nachdem sie die Haustür geschlossen hat, geht Clarissa in Gedanken versunken in ihr Arbeitszimmer zurück. Sie nimmt den Füller und schreibt:
Hatten wir nicht ohnehin schon genügend Sorgen? Und jetzt auch das noch! Armer Junge, arme Leute. Aber was kann ich, was können wir wirklich für sie tun? Noch dazu in einem Moment, in dem wir selbst nicht genau wissen, wie wir die eigenen Probleme lösen sollen? Außerdem: Woher den Mut nehmen, für diese Rechtlosen und Entehrten gegen den herrschenden Meinungsstrom einzutreten? Und uns damit selbst der Gefahr auszusetzen, wie diese Rechtlosen und Entehrten behandelt zu werden – ihr grausames Schicksal teilen zu müssen? Oder sollen wir lieber doch Augen, Ohren und Herzen verschließen und von alledem nichts wissen wollen? Es ist nicht unsere Schuld, wir haben nicht dazu beigetragen, dass diese Regierung an die Macht gekommen ist! Hoffentlich fällt dem Deichkater etwas Passendes ein!
Clarissas Gedanken werden durch den Ruf einer fröhlichen, vertrauten Stimme unterbrochen: „Liebe Prinzessin, dein Göttergatte ist wieder da!“
Clarissa schließt das Tagebuch sehr vorsichtig im Geheimfach ihres Schreibtisches ein, löscht das Licht und verlässt das Zimmer.
* * *
Nach dem Abendessen sitzen Clarissa und Heiko vor dem brennenden Kamin im Wohnzimmer. Clarissa hat ihr Nähzeug auf dem Schoß und versucht sich auf ihre Arbeit zu konzentrieren. Während des gesamten Essens ist es ihr nicht gelungen, die vielen quälenden Gedanken zu vertreiben.
Heiko geht an den Volksempfänger, hört den Nachrichten des Deutschlandsenders mit verkniffenem Gesicht zu und schaltet ihn danach wieder aus. Er vermisst seine Zeitung.
Danach sieht er Clarissa an, zwingt sich ein Lächeln ins Gesicht und sagt mit lauter Stimme: „Morgen früh erhalten wir Besuch, Clarissa.“
Clarissa blickt ihren Mann verwundert an: „Wer kommt denn?“
„Nun erschrick bitte nicht: Herr Ortsgruppenleiter Straßner persönlich gibt uns die Ehre!“
Trotz Heikos Vorwarnung ist Clarissa zutiefst erschrocken. „Wieso? Was soll das ...?“, ruft sie sehr aufgeregt.
Heiko setzt sich neben Clarissa auf das Sofa, nimmt ihr das Nähzeug aus der Hand und legt einen Arm über ihre Schultern. „Mein Schatz, beruhige dich. Es ist alles beileibe nicht so schlimm, wie es sich vielleicht im ersten Moment anhören mag. Im Gegenteil. Lass dir also erzählen: Das Haus, in dem wir leben, habe ich mitsamt seinem Inhalt von Onkel Suhl geerbt. Aus dieser Erbschaft stammt auch die umfangreiche Büchersammlung. Es ist meiner Aufmerksamkeit nicht entgangen, dass sich in jenem großen Bücherregal, das in meinem Arbeitszimmer steht, so manche Werke befinden, die heute nicht mehr in die Bibliothek eines anständigen deutschen Volksgenossen gehören.“ Heiko hat eine bedeutsame Miene aufgesetzt und blinzelt Clarissa mit einem Auge an.
Clarissa nickt. Obwohl sie noch nichts Genaues weiß, ahnt sie, dass Heiko mal wieder einen Ausweg gefunden hat. Etwas erleichtert, aber auch mit eifriger Neugier, unterbricht sie ihn: „Ach so! Und was ...?“
Heiko nickt ebenfalls, legt ihr einen Finger über die Lippen und fährt fort: „Nun, ich mache mir über diese Tatsache schon seit einigen Wochen ernsthafte Gedanken. Ununterbrochen überlege ich, wie man diese unangenehme Angelegenheit bereinigen könne. Und da kam mir heute ein, wie ich glaube, sehr guter Einfall.“
Um die Spannung noch zu steigern, macht Heiko wiederum eine Pause und zwinkert noch einmal mit dem Auge.
„Ich habe mich bei Herrn Straßner in der NSDAP-Ortsgruppe angemeldet. Danach habe ich ihn heute Nachmittag besucht und bat ihn um seinen Rat, wie man dieses ernste Problem lösen könne. Stell dir nur vor, wie entgegenkommend er sich zeigte. Er war äußerst erfreut über meine ehrliche Gesinnung als deutscher Volksgenosse und bot mir sogar freundlicherweise an, persönlich mit seinen Leuten in unser Haus zu kommen, um die in Frage kommende Schundliteratur auszusondern und abtransportieren zu lassen.“
Clarissa muss sich doch sehr dazu zwingen, über das, was ihr Heiko mit einem frechen, ironischen Unterton erzählt hat, nicht in schallendes Gelächter auszubrechen.
„So ist das also“, versucht sie mit einem ähnlichen Unterton Heiko nachzuahmen, „eine wahrhaft noble Hilfestellung dieses Herrn Straßner, nicht wahr?“
„Ja, eben“, pflichtet Heiko ihr bei. „Ich bat ihn auch, diese doch derart wichtige Angelegenheit nicht auf die lange Bank zu schieben, sodass wir uns schließlich darauf geeinigt haben, die Sache gleich morgen früh abzuwickeln. Sie werden gegen neun Uhr hier sein. Du solltest auch das Hausmädchen ...“
„Silke hat mich belehrt, dass man sie ab jetzt ‚Hausgehilfin‘ zu nennen habe, bitte merke dir das!“, sagt Clarissa, indem sie den gleichen Ton wie Heiko anschlägt.
Amüsiert lächelnd antwortet dieser: „So, so. Sieh mal einer an. Nun denn, teile demzufolge unserem werten Fräulein Hausgehilfin mit, dass sie sich morgen als Beistand der beiden Herren zur Verfügung zu halten habe.“
Clarissa setzt sich bei ihrem Mann auf den Schoß, gibt ihm einen Kuss auf die Nase und flüstert ihm ins Ohr: „Deichkater, diese Hausaufgabe hast du mal wieder mit Auszeichnung gelöst!“
Nachdem sie die Erleichterung eine Weile genossen hat, fällt Clarissa der Besuch ihres früheren Schülers ein. Schlagartig ist die soeben empfundene Freude merklich getrübt. Sie sieht dem Deichkater in die Augen und sagt: „Da war heute noch so ein Besucher, Heiko, von dem ich dir berichten möchte.“ Und sie erzählt ausführlich, was sie bei der Unterhaltung mit Moses Kovacs erfahren hat, welche Ohnmacht sie dabei empfand und was sie ihm schließlich für ein Versprechen gegeben hat. „Entschuldige, Heiko, dass ich derart über dich verfügt habe, ohne dich vorher überhaupt zu fragen, aber ich wusste wirklich nicht mehr weiter! Andererseits konnte ich den armen Jungen nicht einfach ohne ein Zeichen der Ermutigung ziehen lassen. Er tat mir so furchtbar leid!“
„Ist doch gut, mein Schatz! Du hast genau das Richtige getan. Wir haben ja noch ein paar Tage Zeit. Irgendetwas wird mir schon einfallen, um der Familie zu helfen. Aber bitte denke auch du immer daran, dass wir wegen unserer Kinder jeder Gefahr aus dem Weg gehen sollten. Glaube mir, was ich heute getan habe, habe ich nur für euch getan, für meine Familie! Obwohl ich mich einerseits sehr freue und mich darüber lustig mache, dass wir sie dieses Mal mit ihren eigenen Waffen geschlagen haben, kocht es in meinem Inneren vor Wut.“
„Wie gut ich dich doch verstehen kann, mein lieber Deichkater!“