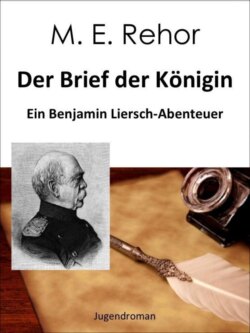Читать книгу Der Brief der Königin - Manfred Rehor - Страница 6
ОглавлениеBenjamin haut ab
Am frühen Abend kam eine Polizeistreife auf den Rummel und befragte Besucher und Schausteller. „Hör zu, was die wollen und was die Kollegen reden“, befahl Grabow. „Aber lass dich nicht dabei erwischen.“
Benjamin lungerte also in der Nähe der Polizisten herum und belauschte die Befragungen.
„Wurden von Ihnen verdächtige Personen am heutigen Morgen hier auf dem Gelände beobachtet?“, fragte ein Polizist den Herkules, der sein Kostüm aus Fellen trug und lässig eine Keule schwenkte.
„Ich weiß von keinem Gelände und Personen“, behauptete Herkules. „Und beobachten tu ich schon gar nicht.“ Er hob seine Keule und der Polizist machte, dass er weiter kam.
Alle Befragten würden leugnen, das Dienerpaar gesehen zu haben, daran zweifelte Benjamin nicht. Auch diejenigen, die wussten, dass die beiden Gesuchten zu Grabows Zelt gegangen waren. Die Schausteller hielten zusammen, solange es gegen Staat und Ordnungsmacht ging.
Benjamin ärgerte sich nicht über die abschätzigen Blicke, mit denen die Polizisten ihn bedachten. Es war zu seinem Vorteil, wenn sie ihn wegen seiner Hautfarbe für zu dumm hielten, Fragen zu beantworten. Solange er sich den Beamten nicht in den Weg stellte, würde er unbehelligt bleiben.
Später war er dabei, als Grabow vernommen wurde, und für einen Moment sah er ihn so, wie ihn die Polizisten sahen: als bulligen Kerl mit Schnapsfahne, dessen glasige Augen verständnislos aus dem geröteten Gesicht starrten.
„Heute Morgen?“, grunzte Grabow auf ihre Frage. „War ich noch gar nicht wach.“
„Also haben Sie niemanden gesehen?“
„Sag ich doch!“
Das genügte den Beamten, sie gingen weiter. Benjamin blieb in ihrer Nähe, bis sie das Gelände verließen. Anschließend nahm er seinen Mut zusammen und ging zu Rosalinde. Er wusste, sie würde von ihm eine Entscheidung erwarten, und die auszusprechen fürchtete er sich. Obwohl er sie für sich schon getroffen hatte.
„Hast du alles genau so gemacht, wie ich es gesagt habe?“, fragte Rosalinde.
„Ja“, sagte er. Dann sprudelte es aus ihm heraus: „Heute Nacht werde ich ihm das Schlafmittel geben. Dann haue ich ab.“
„Gut. Was tust du, wenn du deinen Vater gefunden hast?“
„Ich glaube, ich suche ihn gar nicht, sondern gehe gleich nach Afrika. Wenn meine Mutter dort herstammt, ist das ja mein Zuhause.“
„Du willst in die Kolonien? Da ergeht es dir schlimmer als hier.“
„Nein! Es gibt nicht nur die Kolonien. Das meiste Land dort ist noch gar nicht erforscht.“ Benjamin war nicht bereit, sich von Rosalinde seine Vorstellung von Afrika schlechtreden zu lassen. Für ihn war es das Paradies auf Erden: ein riesiges Land, in dem sich niemand um seine Hautfarbe kümmerte. Und natürlich voller Löwen, Zebras, Abenteuer und Geheimnisse.
Rosalinde fuhr ihn an: „Nichts da! Du suchst deinen Vater! Wenn du erwachsen bist, kannst du immer noch nach Afrika gehen.“
„Schon gut. Aber was ist, wenn mein Vater mich nicht bei sich haben will? Vielleicht jagt er mich fort.“
„Kann sein. Reiche Leute haben manchmal seltsame Anwandlungen.“
„Wie kommst du darauf, dass er reich ist?“
„Weil er viele Jahre lang Geld an Grabow gezahlt hat, damit der dich groß zieht. Wäre er nicht reich, hätte er dich einfach ausgesetzt oder in ein Findelheim gegeben. So etwas passiert ja alle Tage.“
Sein Vater ein reicher Mann! Auf die Idee war Benjamin noch nie gekommen. Er stellte sich seinen Vater immer als jemanden vom Rummel vor. Aber richtig reich war auf dem Rummel niemand – nicht einmal Breitmann, wenn man ihn mit den wohlhabenden Bürgern einer Stadt verglich. „Glaubst du, er war so richtig reich, mit eigenem Haus und Kutsche und allem?“, fragte er, fuhr aber ohne Rosalindes Antwort abzuwarten fort: „Das kann nicht sein. So jemand hat keinen Mischlingssohn. Der würde mich nicht einmal als Diener nehmen.“
Rosalinde stopfte Kuchen in sich hinein, deshalb verstand er ihre Antwort zunächst nicht. Es ging ihr besser an diesem Abend, das konnte Benjamin an ihrem zufriedenen Gesichtsausdruck erkennen. Außerdem war süßer Tee mit Kuchen ihr Lieblingsessen.
„Unsinn, er muss dich gern haben“, wiederholte sie deutlicher. „Auch das lässt sich daraus schließen, dass er für dich bezahlt. Zumindest hat er ein schlechtes Gewissen.“
„Du hast ziemlich viel Verstand für ein Mädchen“, lobte Benjamin.
„Und ziemlich viel Gewicht, das gleicht sich wieder aus. Denkst du an mich, wenn du bei deinem Vater bist?“
„Wenn er wirklich reich ist ...“ Benjamin stockte bei dem Gedanken an all das, was möglich wäre mit viel Geld. Es dauerte eine Weile, bis ihm auffiel, dass Rosalinde ihn wartend ansah. „Dann werde ich ihn bitten, dich in eine Klinik zu schicken, wo du ohne Nachteile abnehmen kannst“, versprach er. Er umarmte Rosalinde, so gut es ging, wischte ihr mit seinem Taschentuch eine Träne von den dicken Backen und verließ sie.
In der Abendvorstellung war Benjamin so geistesabwesend, dass es nicht nur Grabow, sondern auch dem Publikum auffiel. Die Leute murrten, als er lustlos herumtanzte. Eine Ohrfeige von Grabow nach der Vorstellung brachte Benjamin von seinem Gedanken an Reichtum und Afrika zurück in die Wirklichkeit. Trotzdem kam es in der Spätvorstellung zu vereinzelten Pfiffen, aber das war öfter so. Die Spätvorstellung fand nur in größeren Städten statt. Wie Benjamin nur zu gut wusste, erhofften sich die Zuschauer nachts eine obszöne Vorführung mit knapp bekleideten schwarzen Frauen. Grabow stand vor dem Zelt und lockte Besucher an, indem er Andeutungen in diese Richtung machte. Die meisten Zuschauer verließen das Zelt bald wieder, weil ein tanzender Negerjunge sie langweilte.
Grabow ging nach der Vorstellung weg, um sich irgendwo zu betrinken. Benjamin holte die bauchige Flasche mit dem ausländischen Etikett aus dem Versteck und ging zum Wohnwagen. Er fing an, sein Bündel zu packen, ohne zunächst selbst so recht zu wissen, was er tat.
Es gab nicht viel, was ihm gehörte. Er nahm diese Dinge nacheinander in die Hand: ein paar Kleidungsstücke, Holzspielzeug aus seiner Kindheit und die zerlesenen Reste seines einzigen Schulbuches. Das geschnitzte Schaukelpferd, das auf die Fläche einer Hand passte und viele Schrammen aufwies, war Benjamin besonders lieb. Manchmal hatte er genug von seinem Dasein als Jahrmarktsattraktion. Dann lag er stundenlang auf dem Boden, ließ dieses Pferdchen Hin und Her wippen und träumte, er sei ein tapferer Kürassier, der auf seinem stolzen Ross Heldentaten vollbringt.
Nachdem das Bündel gepackt war, sah sich Benjamin um, ob er etwas vergessen hatte. Vielleicht kam er nie wieder zurück in diesen Wohnwagen! Das war ein aufregender Gedanke und traurig zugleich. Benjamin öffnete sein Bündel noch einmal und nahm das Holzpferdchen heraus. Er stellte es zurück aufs Regal. Hier würde es bleiben, als Erinnerung an all die Jahre, die er hier verbracht hatte. Wenn er in der Fremde war, konnte er sich vorstellen, wie es hier stand und auf Grabow herunter sah oder auf die Geräusche vom Rummel lauschte.
Grabow kam erst nach Mitternacht zurück.
„Weder den Schmuck noch den verdammten Brief will jemand haben. Obwohl, da haben schon einige die Ohren gespitzt, als ich gesagt habe, er ist von einer Königin. Aber Geld will keiner dafür geben. Verdammte Bande!“ Schwankend beugte er sich über die Stahlkassette, schloss sie auf und warf die Schmuckstücke und den Brief hinein.
Benjamin beobachtete ihn unauffällig. Grabow war wütend und betrunken. Das war gut, denn so war er leichter zu übertölpeln. Als Grabow die Kassette abschloss und sich umdrehte, tat Benjamin, als versuche er, eine Flasche vor ihm zu verstecken.
„Was hast du da?“, fuhr Grabow ihn an.
Scheinbar zögernd zeigte Benjamin die bauchige Flasche vor. „Die hat ein Besucher nach der letzten Vorstellung unter seinem Stuhl stehenlassen“, behauptete er.
Grabow riss sie ihm aus der Hand. „Das ist nichts für dich. So weit kommt es noch, dass du anfängst, zu saufen.“
Er nahm einen ordentlichen Schluck, hustete und schüttelte sich. „Donnerwetter, der hat es in sich. Da kannst du mal sehen, das muss französischer Cognac sein. Der hat so einen Nachgeschmack. Ganz edel.“
Benjamin wartete mit angehaltenem Atem, ob die Mischung eine Wirkung zeigte.
„Was glotzt du so?“ Grabow setzte die Flasche noch einmal an, prustete dann aber die Flüssigkeit aus dem Mund heraus gegen die Holzwand des Wohnwagens. „Pfui, Teufel! Da ist etwas drin. Ein Pulver. Bitter.“
Er hielt die Flasche gegen das Licht der Petroleumlampe. „Ein Bodensatz. Wenn es alter Wein wäre ...“ Er unterbrach sich und starrte Benjamin an. „Moment mal. Du hast doch nicht vor, mich zu vergiften, oder? Antworte, verdammter Affe!“
Benjamin stand das schlechte Gewissen ins Gesicht geschrieben, er fühlte es. Er druckste herum: „Der Schnaps ist nicht vergiftet. Vielleicht ist im Zelt ein wenig Sand hineingeraten.“
„Wo ist meine Peitsche? Sag, was du da hineingemischt hast. Sonst werde ich die Antwort aus dir heraus prügeln. Halt!“ Grabow hielt inne und fing an zu grinsen. Er streckte Benjamin die Flasche entgegen. „Warum trinkst du diese Plörre nicht selbst aus? Dann werden wir ja sehen, ob es nur Sand ist. Los, trink!“
Benjamin nahm die Flasche. Trinken kam nicht in Frage. Sollte er sie ausschütten und versuchen, die Tür zu erreichen?
Grabow entdeckte seine Peitsche auf dem Boden unter seiner Jacke, die er dort einfach hingeworfen hatte. Er bückte sich, um sie aufzuheben.
Angst und Wut kochten in Benjamin hoch, als er die Waffe sah. Mit aller Kraft schlug er mit der Flasche auf Grabows Hinterkopf. Da Grabow nur zuckte und nicht zusammenbrach, schlug er noch ein zweites Mal zu. So hart, dass die Flasche zerbrach.
Grabow bäumte sich auf, riss ein Regal herunter, dann sackte er auf den Boden und rührte sich nicht mehr. Blut rann aus der Platzwunde auf seinem kahlen Schädel.
Schnell kniete sich Benjamin neben ihn und drehte ihn herum. Grabow war nicht tot, er atmete schwach. Er lag zwischen einigen Gegenständen, die er mit dem Regal heruntergerissen hatte. Darunter war Benjamins Holzpferd, das zerbrochen war.
Benjamin traute der Stille nicht. Er stieß seinen Ziehvater in die Seite, bereit, sich mit einem Sprung in Sicherheit zu bringen, falls der sich nur verstellte. Aber Grabow rührte sich nicht. Benjamin zog ihm vorsichtig die Kette mit dem Schlüssel über den Kopf.
Immer Grabow im Blick behaltend, öffnete Benjamin die Kassette. Briefe und Bankbelege lagen darin, dazwischen die Schmuckstücke, die von den beiden Dienstboten stammten. Außerdem das überzählige Geld, das Grabow sich von Breitmann geliehen und noch nicht zurückgegeben hatte. Den Schmuck ließ Benjamin liegen, aber er nahm das Geld. Als Bezahlung für die Arbeit der letzten Jahre, beruhigte er sein Gewissen.
Die Bankbelege wiesen eine erhebliche Summe aus, die halbjährlich an Grabow ausgezahlt wurde. Jetzt wusste Benjamin, woher sein Ziehvater das Geld hatte, das er so freigiebig verspielte und vertrank. Die Briefe überflog er nur. Sie sagten ihm nichts, bis auf einen. Er war von 1878 und kurz. Ein Absatz war angestrichen: „Bringen Sie den Jungen in ein Internat, am besten in der Schweiz. Die Kosten werde ich übernehmen.“ Daneben stand in Grabows krakeliger Schrift: „Quatsch!“
Dieser Brief war in leserlicher, schwungvoller Schrift mit „Wilhelm Riehmann“ unterzeichnet. Oben rechts stand als Absender: „Villa Riehmann, Berlin-Steglitz“.
Wilhelm Riehmann. Benjamin hatte den Namen noch nie gehört. War das sein angeblich toter Vater? Sehr wahrscheinlich, warum sollte dieser Mann sonst für angebliche Internatskosten aufkommen. Oder ging es gar nicht um ihn? Benjamin zweifelte, aber ein Blick auf Grabow genügte. Für Zweifel hatte er jetzt keine Zeit. Er musste handeln, bevor sein Ziehvater wieder zu sich kam.
Er steckte die Papiere ein und nahm noch ein paar der Bankbelege als Beweis für die Zahlungen mit. Dann schloss er die Kassette ab und hängte die Kette mit dem Schlüssel Grabow wieder um den Hals. Grabow würde ihm das nie verzeihen; weder den Schlag mit der Flasche, noch das Öffnen der Kassette. Ab jetzt gab es für Benjamin kein Zurück mehr.
Er nahm sein Bündel und verließ den Wohnwagen. Es war zwei Uhr morgens, als er sich von dem Gelände des Jahrmarkts schlich. In einer so verschlafenen Stadt wie Hannover war zu dieser Zeit niemand unterwegs. Trotzdem versicherte sich Benjamin zunächst, dass alles ruhig war. Dann erst schlüpfte er durch ein Loch im Zaun hinaus auf den Gehweg. Er war frei von Grabow, frei von den Zwängen des Rummels!
Aber nur für einen Augenblick.
Benjamin fühlte sich von kräftigen Händen gepackt, herumgewirbelt und zu Boden geworfen. Jemand kniete sich auf ihn und hielt ihm den Mund zu. Er war nicht in der Lage, sich zu wehren, so überraschend war der Angriff erfolgt.
„Wer bist du, was machst du hier mitten in der Nacht?“, zischte eine Männerstimme mit starkem Akzent in sein Ohr. Es klang nicht aggressiv, eher amüsiert.
Benjamins panische Angst legte sich: Das war nicht Grabow! Er brummte durch die Hand vor seinem Mund, die daraufhin weggenommen wurde. „Ich heiße Benjamin“, sagte er, nachdem er tief Luft geholt hatte. „Benjamin Riehmann.“ Das kam ganz selbstverständlich über seine Lippen.
Der Mann hob ihn hoch wie eine Puppe und stellte ihn auf die Beine. Sein Blick fiel auf das Bündel, das Benjamin bei sich trug. „Du willst abhauen, wie?“
„Ja. Ich habe genug vom Rummel.“
„Gut, gut. Alle Jungs hauen irgendwann mal ab. Die meisten kehren bald wieder nach Hause zurück. Nur die Starken suchen sich ihren eigenen Weg durch die Welt. Die Starken und die Dummen. Du musst vorsichtiger sein. Die Nacht ist gefährlich.“
„Jetzt weiß ich es“, sagte Benjamin. Im trüben Mondlicht sah er nun das Gesicht seines Gegenübers: Es war der Türke, der vor zwei Tagen die Kindervorstellung gestört hatte! Der Mann trug heute elegante, europäische Kleidung, aber der große Schnurrbart war unverkennbar. Zwar war der Türke kleiner als Benjamin und schmal gebaut. Aber Benjamin hatte auf dem Rummel gelernt, den Äußerlichkeiten weniger zu trauen als den Tatsachen. Er stand hier einem erfahrenen Ringer gegenüber, gegen den er chancenlos war.
„Du kennst dich also auf dem Rummel aus“, fuhr der Mann fort. „Sehr gut. Wir machen ein Geschäft: Du erzählst mir etwas über einen Budenbesitzer mit Namen Grabow und ich lasse dich laufen.“
„Grabow?“ Benjamins Gedanken rasten. Wer mitten in der Nacht etwas von seinem Ziehvater wollte, war entweder ein Gläubiger oder noch Schlimmeres.
Der Mann nahm Benjamins Bündel und schüttelte es. „Grabow handelt mit gestohlenen Sachen, hat man mir berichtet. Du hast nicht zufällig auch welche bei dir? Hört sich nicht so an. Also: Wo finde ich Grabow?“
Benjamin schwankte für einen Moment zwischen der Versuchung, den bewusstlosen Grabow dem Fremden auszuliefern, und dem Gefühl, es sei nicht anständig, einen am Boden liegenden Gegner zu verraten. „Grabow wohnt in einem der Wohnwagen hinten links, wenn Sie auf das Gelände kommen“, log er und beschrieb den Weg, damit der Mann ihn im Dunkeln finden konnte. „Sie können einfach reingehen, es ist immer offen. Was wollen Sie denn von ihm?“
„Er hat etwas, das ich brauche. Aber das geht dich nichts an. Verschwinde.“
Benjamin schnappte sein Bündel und rannte die Straße hinunter. Erst an der nächsten Ecke blieb er stehen und sah sich um. Der Mann war weg. Vielleicht war ihm etwas gestohlen worden und Grabow hatte den Hehler für die Ware gemacht. Oder es ging um den Schmuck des Dienerpaares. Konnte es sein, dass die bestohlene Prinzessin bereits jemanden beauftragt hatte, die Hehler in der Stadt zu überprüfen? Oder ging es gar um den Brief der englischen Königin? Aber ein Muselman war der letzte Mensch, der sich um ein Schriftstück aus England kümmern würde. Vermutlich waren es wieder einmal Grabows Spielschulden, die ihm Ärger einbrachten.
Nun, der Türke würde nicht bekommen, was er suchte. Der Wohnwagen, den Benjamin ihm beschrieben hatte, gehörte Herkules. Dessen Tür war nie abgeschlossen, weil kein vernünftiger Mensch es wagte, ihn nachts zu stören. Der Mann würde von Herkules eine ordentliche Tracht Prügel bekommen.
Immer auf der Hut, nicht in eine weitere Falle zu tappen, suchte sich Benjamin seinen Weg durch die nächtliche Stadt zum Bahnhof. Er musste mit dem ersten Zug verschwinden – also bevor Grabow wieder zu sich kam. Der Fahrplan wies einen frühen Zug nach Berlin aus, aber der Bahnhof war noch geschlossen. Benjamin setzte sich vor dem Gebäude auf eine Bank und wartete. Die Angst, im letzten Moment abgefangen zu werden, verhinderte, dass er einschlief.
Die Stadt erwachte und Benjamin sah im heller werdenden Dämmerlicht dabei zu. Pferde zogen Milchwagen durch die Straßen, Müllsammler mit ihren Hundekarren schlurften vorbei. Die Eisenbahner kamen zum Dienst und erschienen bald darauf in korrekten Uniformen hinter den erleuchteten Fenstern des Gebäudes. Vor dem Eingang bildete sich eine Schlange von Pendlern, die auf Einlass warteten. Dann wurde das schmiedeeiserne Gittertor geöffnet und die Menschen strömten in den Bahnhof. Benjamin folgte ihnen.
Weit kam er nicht. Auf einmal waren überall Polizisten. Besonders ältere Männer und junge Frauen wurden aufgehalten und genauer in Augenschein genommen. Aber auch sonst wurde jeder befragt, der irgendwie auffiel. Sogar Benjamin.
„Wohin?“, wurde er von einem Polizisten angeschnauzt.
Benjamin hoffte, dass das Interesse an ihm nur auf seinem Aussehen beruhte und er nicht bereits gesucht wurde. „Hamburg“, log er, weil er eben gehört hatte, dass der Zug dorthin abfahrbereit war.
„Hast du einen älteren Mann in Begleitung einer jungen Frau gesehen?“
„Kann sein. Es sind viele Leute hier“, redete sich Benjamin heraus.
„Noch eine vorlaute Antwort und ich nehme dich mit, verstanden? Verschwinde!“
Benjamin dienerte unterwürfig, um seine Erleichterung nicht zu zeigen. Schnell ging er weiter und stellte sich am Schalter an. Obwohl das Geld aus Grabows Kassette für die erste Klasse gereicht hätte, kaufte er eine Fahrkarte für die dritte nach Berlin. Man soll sich nicht über seine Klasse erheben, lautete ein Spruch, den Mamschka öfter von sich gab und den Rosalinde gerne wiederholte. Das mit der Klasse war da wohl anders gemeint, mehr politisch, aber Benjamin hielt sich trotzdem daran.
Der Waggon dritter Klasse war fast voll. Benjamin drängte sich durch, bis er einen freien Sitzplatz auf einer Holzbank fand. Seine Mitreisenden waren einfache Leute. Er hörte ihren Gesprächen zu, um sich abzulenken. Eine vielköpfige Familie hatte die Großeltern in Hannover besucht und fuhr nun nach Berlin zurück. Ein altes Ehepaar wollte den in Berlin studierenden Sohn mit seinem Besuch überraschen. Und zwei geschniegelte junge Männer in fadenscheinigen Anzügen unterhielten sich über die Möglichkeiten, in der Hauptstadt schnell zu Geld zu kommen.
Als der Schaffner die Türen schloss, beugte sich Benjamin vor und sah hinaus auf den Bahnsteig. Aber gleich zog er den Kopf wieder zurück. Dort draußen war der Türke! Seine Kleidung sah jetzt unordentlich aus und er hinkte.
Noch einmal riskierte Benjamin einen Blick. War das Zufall? Nein. Der Türke ging an den Wagen entlang und spähte durch die Fenster. Er suchte jemanden.
Ein langer Pfiff, der Zug fuhr an. Im Schritttempo rollte er aus der Bahnhofshalle heraus. Benjamin musste wissen, ob der Türke im Zug war. Er stand auf und starrte hinaus. Am Ende des Bahnsteigs stand der Mann – und sah Benjamin direkt ins Gesicht. Seine Miene war alles andere als freundlich. Benjamin verlor ihn aus den Augen, der Zug rollte ins Freie.