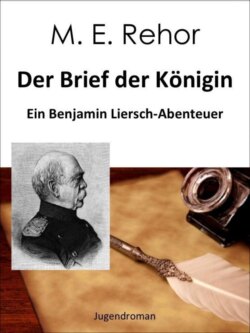Читать книгу Der Brief der Königin - Manfred Rehor - Страница 8
ОглавлениеGrabow bekommt Ärger
Als Friedrich Grabow zu sich kam, beugte sich ein Mann über ihn. Grabow fühlte sich wie geprügelt, er sah ein fremdes Gesicht vor sich, also schlug er zu.
Der Mann hatte Glück. Grabows Bewegungen waren schwach und unkoordiniert. Der Schlag traf das Kinn des Mannes nur mit geringer Wucht. Es war mehr die Überraschung, als der Schmerz, die ihn zurücktaumeln und laut aufschreien ließ: „Ja, sind Sie denn verrückt!“
Grabow versuchte, sich aufzurappeln und seinen vermeintlichen Gegner frontal anzugehen. Breitmann schob sich dazwischen und drückte ihn wieder auf das Bett zurück. „Ruhig bleiben, Friedrich, das ist der Herr Doktor! Kein Grund, dich aufzuregen.“
Hinter Breitmanns Rücken fühlte sich der Arzt sicher. Er schimpfte drauf los: „Das ist mir in meinem ganzen Berufsleben noch nicht vorgekommen. Die Polizei werde ich verständigen! Auch wenn man auf dem Jahrmarkt andere Sitten haben mag als unter zivilisierten Menschen: Es geht nicht an, einen Arzt bei der Ausübung seines Berufes zu schlagen.“
Breitmann zog ein paar Geldscheine aus der Tasche und hielt sie dem erbosten Arzt hin: „Hier, als Honorar und Schmerzensgeld. Er bittet tausend Mal um Entschuldigung.“
„Davon habe ich nichts gehört!“, ereiferte sich der Arzt. Aber das Geld steckte er ein.
„So ist er nun einmal. Hat lange in Afrika gelebt, bei den Zulus und Kaffern. Da lernt man, wehrhaft zu sein, mitten in den Urwäldern. Besuchen Sie mal seine Vorstellung, Sie bekommen Freikarten.“
„Wir sind hier nicht im Urwald. Ich muss die Polizei ...“
Ein weiterer Geldschein und das laut grunzende Aufbegehren Grabows überzeugten den Arzt, dass es zu seinem Vorteil war, nun schnell zu verschwinden. Er griff nach seiner Tasche und verließ den Wohnwagen.
„Dass ich dir die Summe mit Zins und Zinseszins in Rechnung stellen werde, ist dir wohl klar“, wandte sich Breitmann an Grabow. „Was fällt dir ein, hier den Wüterich zu spielen? Wir können froh sein, wenn überhaupt ein Arzt bereit ist, zu uns zu kommen.“
„Halt den Mund und gib mir etwas zu trinken.“ Grabow schaffte es endlich, sich aufzurichten und auf die Bettkante zu setzen.
Breitmann reichte ihm ein Glas Wasser, das Grabow beiseite stieß. „Etwas Richtiges brauche ich. Damit ich klar werde und hinter dieser verdammten schwarzen Ratte her kann.“
„Benjamin? Hat er etwas mit diesen Dingern zu tun?“ Breitmann holte einige Schmuckstücke aus der Jackentasche.
„Du verdammter Dieb! Gib den Schmuck her. Wehe, es fehlt etwas.“
„Ich habe das vom Boden aufgesammelt, damit der Arzt es nicht sieht.“ Breitmann legte den Schmuck auf den Tisch, aber dann nahm er eine Brosche und hielt sie ins Licht. „Schön“, sagte er mit einem Funkeln in den Augen. „Wird meiner Frau gefallen. Die behalte ich als Pfand, bis du deine Schulden bezahlt hast. Also auf ewig.“
„Ich habe immer alles zurück gezahlt, was ich mir von dir gepumpt habe“, protestierte Grabow.
„Stimmt. Aber wenn Benjamin weg ist, fehlt dir der größte Teil deines Einkommens. Ohne den Jungen sieht es schlecht für dich aus.“
„Ich bin auf die schwarze Ratte nicht angewiesen. Wenn ich ihn finde, bringe ich ihn um. Wer mich bestiehlt und niederschlägt, verdient es nicht besser.“
„Du bist ein Dummkopf, Grabow. Man schlachtet die Kuh nicht, die Milch gibt.“
„Das ist ein blödes Sprichwort, nach dem Geldverleiher wie du leben, nicht Menschen mit Ehrgefühl, wie ich einer bin. Verschwinde!“
„Gerne. Aber ich rate dir noch einmal, die nächsten Tage im Bett zu bleiben. Außer, du willst im Spital landen. Das wird dann wirklich teuer.“
Grabow wollte aufstehen, aber er spürte stechenden Schmerz in seinem Kopf. Ihm schwindelte schlimmer als nach einer durchzechten Nacht. Er ließ sich auf das Bett zurücksinken. „Warte mal, Breitmann. War alles nicht so gemeint. Behalte die Brosche. Nimm dir von mir aus mehr von dem Zeug. Aber gib mir dafür noch ein paar Scheine. Ich brauche Geld, um Benjamin zurückzuholen.“
„Darüber reden wir morgen.“ Breitmann verließ den Wohnwagen.
Grabow machte die Augen zu und wartete darauf, dass die schwankenden Leuchterscheinungen verschwanden, die er immer noch sah.
Nach einer Weile hörte er, wie die Tür zu seinem Wagen wieder geöffnet wurde. „Verdammt, was ist denn nun noch?“, schimpfte er.
„Sind Sie krank?“, fragte eine Stimme mit ausländischem Akzent.
Grabow öffnete die Augen und starrte in ein fremdes Gesicht mit einem riesigen Schnurrbart. Nach der Erfahrung mit dem Arzt eben gab er sich Mühe, nicht grob zu reagieren. „Wer sind Sie?“, fragte er.
Der Mann antwortete nicht. Er hatte den Schmuck auf dem Tisch entdeckt. Er nahm eine Kette in die Hand und musterte sie. Grabow fiel auf, dass der Mann dünne, weiße Handschuhe trug. Überhaupt war er elegant gekleidet, aber ein wenig neben der Mode. Grabow kannte sich nicht gut genug in solchen Dingen aus, um sagen zu können, ob der Anzug zu modern oder bereits ein wenig altmodisch war. Auf jeden Fall hatte der Besucher bei aller Eleganz etwas Unpassendes an sich. Er war Orientale, mutmaßte Grabow, Türke vielleicht. Der dünne Spazierstock, den er geziert in der Linken hielt, war ein wertvolles Stück mit einem Goldknauf in Form eines Löwenkopfes.
„Sie sollten Beweisstücke nicht einfach so herumliegen lassen. Sie sind unaufmerksam, mein Freund“, sagte der Mann und ließ die Kette mit einer lässigen Bewegung wieder auf den Tisch fallen. „Aber ich bin an etwas Wertvollerem interessiert. Konzentrieren wir uns also auf den Brief. Wo ist er?“
„Ich habe keinen Brief. Wer sind Sie und ...“
„Zusammen mit diesem Schmuck haben Sie einen Brief erworben. Ich muss ihn haben. Sagen Sie mir, wo er sich befindet!“ Der Mann sah sich suchend um.
Grabow war nicht bereit, sich in seinem eigenen Wohnwagen Befehle von einem Fremden anzuhören. Er konnte trotz seiner Schwäche der Versuchung nicht widerstehen. Er streckte die Hand aus, um den Mann am Jackett zu fassen bekommen.
Der Türke hob mit einer lässigen Bewegung seinen Stock und schlug Grabow auf die Hand. „Keine Vertraulichkeiten, bitte“, sagte er.
Grabow fluchte. Die Schmerzen in seinen Fingerknöcheln gesellten sich zu denen in seinem Kopf und zu der Erschöpfung durch die Ereignisse der Nacht.
Sein Besucher war alles andere als geduldig. Schon pfiff der Spazierstock wieder durch die Luft. Diesmal traf der Knauf das Knie. Ein greller Schmerz durchzuckte Grabow. „Zur Hölle mit Ihnen“, keuchte er, „und den Brief gleich hinterher. Ich habe ihn nicht mehr.“
Der Mann ging zur Tür und verriegelte sie von innen. Er stellte den Spazierstock in die Ecke und nestelte in seinem Jackett herum. Als er sich wieder Grabow zuwandte, hielt er ein Messer in der Hand. Eine merkwürdige Waffe mit einer schmalen, langen Klinge, die aber einen ungemein scharfen Eindruck machte. Die Spitze wies direkt auf Grabows Kehle, wenn auch noch aus einem Abstand von einem halben Meter.
„Ich habe keine Zeit, mich lange mit Ihnen aufzuhalten“, sagte der Türke. „Ich könnte Sie erschießen, aber der Krach würde Aufmerksamkeit erregen. Also muss ich die leise, schmutzige Methode anwenden. Wenn Sie schreien, steche ich Sie gleich ab.“
„Feigling, einen Wehrlosen mit dem Messer zu bedrohen“, schimpfte Grabow. Die Angst kroch in ihm hoch. Der Kerl war so vornehm und fremdartig, dass man ihm zutrauen konnte, einen Menschen abzustechen, ohne sein blasiertes Verhalten aufzugeben. Ja, das wurde Grabow jetzt immer klarer, je besser sein Gehirn funktionierte: Dies war ein Mann, der keine Kompromisse zu machen bereit war.
Aber Grabow hatte nicht vor, sich abstechen zu lassen. Sein Kampfgeist war noch nicht erloschen. Er wartete, bis sein Besucher nur noch einen Schritt vom Bett entfernt war und die Spitze der Waffe ein wenig senkte, dann ging er zum Angriff über. Da ihm nicht viel Bewegungsmöglichkeit blieb, rollte er sich einfach vom Bett, landete vor den Füßen des Mannes, stemmt sich gegen dessen Beine und brachte ihn so zu Fall.
Grabow bewegte sich zu langsam. Sein Gegner kam wieder hoch und machte mit einer aberwitzig schnellen Bewegung von seinem Messer Gebrauch – nein, er drückte die Spitze nur leicht gegen Grabows Hals.
„Genug gespielt“, sagte er. „Ich will den Brief.“
Die Klinge drückte sich langsam fester in Grabows Kehle. Der wusste, wann er verloren hatte. „Ein Junge, den ich hier beschäftigt hatte, ist damit abgehauen.“
„War das etwa vorige Nacht?“
„Ja.“
Der Mann schimpfte in einer fremden Sprache, bevor er auf Deutsch fortfuhr: „Dann habe ich noch eine Rechnung mit ihm offen. Er ist nach Berlin gefahren. Ich werde ihn finden. Das hier werde ich als Entschädigung für meine Mühen an mich nehmen.“ Er steckte sich den ganzen Schmuck in die Tasche, entriegelte die Tür und verließ den Wohnwagen.
Grabow schickte ihm einen Fluch hinterher, kam mühsam hoch und brach endgültig zusammen, kaum dass er auf seinen Beinen stand.
Benjamin wollte sofort Nachforschungen über Herrn Riehmann anstellen. Aber Jedah war eigensinnig: „Du ruhst dich aus. Basta!“
Aber Benjamin merkte schnell, dass sie noch etwas Anderes im Sinn hatte: Sie brauchte endlich wieder jemanden, der ihr zuhörte. Da er nicht müde war, setzte er sich auf die Stufen vor dem Wohnwagen und tat ihr den Gefallen. Jedah plapperte bis in den Abend hinein über ihre Erlebnisse in den vergangenen Monaten. Jede Menge Tratsch über die Welt der Jahrmärkte und Rummelplätze hatte sie zu berichten.
Später kam Muck mit den Einkäufen und Jedah hielt für eine Viertelstunde den Mund, während sie das Abendessen zubereitete. Dafür redete Muck über das ewige Thema einer Organisation der Schausteller und die Frage, warum die Menschen nicht mehr Geld auf dem Rummel ausgaben: „Sie wollen immer etwas Neues sehen. Unsereinen sind sie gewohnt. Nur noch kleine Kinder jubeln, wenn sie einen Zwerg sehen. Es reicht nicht mehr, uns hinzustellen und ein paar komische Bewegungen zu machen. Wir müssen wieder Artisten werden.“
„Hör auf zu träumen“, fuhr Jedah dazwischen. „Iss jetzt. Und dann kümmern wir uns um Benjamins Problem, das liegt näher.“
„Ich muss herausfinden, ob dieser Wilhelm Riehmann mein Vater ist“, sagte Benjamin.
„Riehmann ist kein seltener Name“, gab Muck zu bedenken. „Und die Anschrift ‚Berlin-Steglitz‘ gibt nicht viel her. Warum gehen wir nicht einfach zum reichsten Riehmann in Berlin? Schließlich muss man Geld haben, wenn man jahrelang Unterhalt zahlt.“
„Und wie willst du den finden? Eine Bank fragen?“, wollte Jedah wissen.
„Wir fragen jemanden, der alles weiß.“
„Wer soll das sein?“, fragte Benjamin.
„Ein Reporter. Er war hier, als der Jahrmarkt eröffnet wurde. Schmitt heißt er.“ Muck sprang auf. „Wir gehen sofort zu ihm.“
Jedah zog ihn wieder auf den Stuhl. „Es ist bereits dunkel.“
„Zeitungsredaktionen arbeiten auch nachts, damit morgens die neue Zeitung gedruckt werden kann. Schmitt ist bestimmt noch dort. Benjamin, komm mit!“
Muck war über seinen Einfall ganz aufgeregt und rannte auf seinen kurzen Beinen vorneweg. Er war es auch, der einem vorbeifahrenden Pferdeomnibus nachrief. Behäbig trotteten zwei kräftige Gäule vor der länglichen Kutsche, in der mehr als ein Dutzend Menschen Platz fanden. Der Kutscher hielt an und ließ die beiden aufsteigen.
„Schade, dass hier keine Pferdestraßenbahn fährt“, sagte Muck. „Auf Schienen kommt man viel schneller voran.“
„Wir hätten auch zu Fuß gehen können“, meinte Benjamin. „Schneller als ein Fußgänger ist der Pferdeomnibus auch nicht.“
„Auf langen Strecken kann ich dein Tempo nicht mithalten“, erinnerte ihn Muck.
„Weißt du überhaupt, wo die Zeitung ihre Büros hat?“
„Potsdamer Straße. Dieser Schmitt hat mir damals die Adresse genannt, falls es besondere Vorfälle auf dem Jahrmarkt gibt. Er hat eine Belohnung versprochen, wenn ich ihm Neuigkeiten exklusiv melde.“
„Kann man ihm vertrauen?“
Muck schüttelte sich vor Lachen. „Vertrauen? Er ist Reporter! Wir werden ihm eine tolle Geschichte versprechen müssen, damit morgen nicht in der Zeitung steht, dass ein afrikanischer Mischling in der Stadt ist und sich nach reichen Riehmanns erkundigt.“
„Dann sollte wir besser nicht ...“, begann Benjamin erschrocken.
„Zu spät, wir sind da. Spring runter.“
Sie gingen durch die Potsdamer Straße bis zu dem eindrucksvollen Gebäude der Zeitung. Überall brannte noch Licht hinter den Fenstern. Der Portier zog die Augenbrauen hoch und musterte misstrauisch die zwei merkwürdigen jungen Leute, die vor ihm standen. Als Muck aber nach Herrn Schmitt fragte, ließ er sie eintreten.
Ein magerer Botenjunge in Benjamins Alter führte sie zu Schmitts Büro und hieß sie davor auf den wackeligen Holzstühlen Platz nehmen. Das ganze Haus war von einem Stimmengewirr erfüllt, das Benjamin an den Rummel erinnerte. Männer gingen eilig mit Papieren in der Hand hin und her, ohne die beiden Wartenden zu beachten.
Schließlich öffnete sich die Bürotür und ein fülliger Mann mit einem freundlichen, runden Gesicht trat heraus. „Ah, die Herren vom Jahrmarkt, willkommen. Herein getreten, Platz genommen, bitte.“
Benjamin und Muck betraten einen kleinen Büroraum, der nur schummrig erleuchtet war. Es roch muffig nach alten Akten. Die offenen Schränke entlang den Wänden quollen über von Bündeln vergilbter Zeitungen und von aufgestapelten Büchern. Der Schreibtisch dagegen war leer geräumt bis auf die notwendigsten Gegenstände: Papier, Federhalter, Tintenfass, Löschblatt.
„Was habt ihr zu berichten?“, wollte Herr Schmitt wissen, nachdem sie sich gesetzt hatten.
Benjamin fühlte sich nicht wohl unter seinem stechenden Blick. Er musste sich erst räuspern, bevor er herausbrachte: „Wir wollten eigentlich nur etwas fragen.“
Schmitt zog die Augenbrauen hoch und lehnte sich zurück. „Ich bin keine Auskunftei.“
Bevor Benjamin etwas erwidern konnte, behauptete Muck großsprecherisch: „Selbstverständlich steht unsere Frage in Zusammenhang mit einer sehr interessanten Geschichte. Daraus können Sie einen tollen Artikel machen.“
„Erzähl mir die Geschichte!“ Schmitt nahm den Federhalter, tunkte ihn ein und machte sich bereit, mitzuschreiben.
„Es ist aber so, dass wir zunächst die Auskunft benötigen. Die Geschichte ergibt sich sozusagen daraus. Wir werden Sie in den nächsten Tagen noch einmal aufsuchen und alles erzählen.“
Benjamin bewunderte Muck dafür, wie glatt der lügen konnte.
Schmitt musterte die Beiden, während er die Feder behutsam in die Federschale zurücklegte. „Nun gut, ich werde in Vorleistung treten. Heraus mit der Frage.“
„Wir suchen einen Herrn Wilhelm Riehmann. Vermutlich ist er ein wohlhabender Mann und lebt in Steglitz.“
„Das ist alles? Obwohl, ihr seid merkwürdige Leute, wenn ihr solche Fragen habt. Ich erinnere mich an dich, deiner geringen Körpergröße wegen. Aber dem jungen Mann hier glaube ich bisher noch nie begegnet zu sein.“
„Muck Stolberg ist mein Name. Und das ist mein Freund Ben Grabow.“
Benjamin mochte die Kurzform seines Namens nicht, aber jetzt war nicht der Moment, Muck wieder einmal darauf hinzuweisen.
„Stolberg und Grabow.“ Schmitt schrieb sich die Namen auf. „Eure Frage ist einfach zu beantworten. Wilhelm Riehmann ist ein bekannter Industrieller, der eine Villa in Steglitz besitzt.“
„Haben Sie die genaue Anschrift?“
Schmitt suchte sie aus einem Adressbuch heraus und schrieb sie auf einen Zettel, den er Muck gab.
Benjamin griff Muck an der Hand und zog ihn zur Tür. „Vielen Dank, wir werden uns bald wieder bei Ihnen melden.“
„Nicht so eilig!“, rief Schmitt. „Habt ihr nicht wenigstens eine kleine Information für mich? Es ist zurzeit nicht viel los in Berlin. In anderen Städten geschehen wenigstens spektakuläre Verbrechen, über die man schreiben kann. Eben kam zum Beispiel eine Meldung aus Norddeutschland: Einer Prinzessin soll wertvoller Schmuck gestohlen worden sein.“
Benjamin fühlte, wie er rot wurde. Er konnte nur hoffen, dass seine dunkle Haut und die schlechte Beleuchtung dies vor dem Reporter verbargen.
„Benjamin hat nichts mit dem Schmuckdiebstahl in Hannover zu tun“, versicherte Muck hastig.
Benjamin gab ihm einen Tritt gegen das Schienbein. „Wir gehen jetzt.“
„Bist du verrückt?“, fuhr er Muck wütend an, als sie draußen waren. „Schmitt hat von Norddeutschland gesprochen und du von Hannover.“
„Es ist ihm bestimmt nicht aufgefallen“, versuchte sich Muck zu rechtfertigen. „Außerdem haben weder du noch Grabow den Schmuck gestohlen. Also, was kann euch schon passieren?“
„Grabow kann als Hehler ins Zuchthaus kommen, was nicht schlecht wäre, und ich als Mitwisser. Also denk das nächste Mal nach, bevor du etwas sagst.“
Muck schwieg beleidigt auf dem ganzen Weg zurück zu Jedahs Wohnwagen.