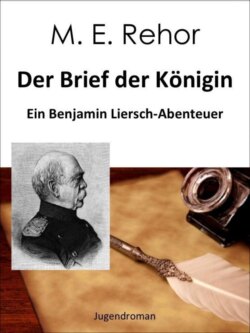Читать книгу Der Brief der Königin - Manfred Rehor - Страница 7
ОглавлениеMuck
Friedrich Grabow kam zu sich. Er litt unter hämmernden Kopfschmerzen und konnte die Lider kaum öffnen. Langsam hob er die Hand, um sich über die Augen zu fahren, und ein weiterer Schmerz durchzuckte ihn. War sein Arm gebrochen? Er versuchte, sich aufzurichten.
Eine Stimme herrschte ihn an: „Liegenbleiben! Wie soll ich dich verbinden, wenn du herumzappelst wie ein Kind?“
Grabow ließ sich zurücksinken. Allmählich klärte sich sein Blick. Breitmanns Gesicht erschien. Grabow konnte den Wurfbudenbesitzer nicht ausstehen, aber Breitmann hatte ihn schon oft verarztet. Das ging in Ordnung, das konnte er.
„Was ist passiert?“, fragte Grabow.
„Keine Ahnung. Wir haben heute Nacht Lärm und Schreie gehört. Es gab Ärger bei Herkules, ein Einbrecher war so dumm, es bei ihm zu versuchen. Herkules hätte ihn beinahe umgebracht, wir konnten ihn gerade noch davon abhalten. Wir wollten dich zu Hilfe holen und haben dich hier in einer Blutlache liegend gefunden. Dann haben wir dich in meinen Wagen gebracht, weil ich dich hier besser behandeln kann.“
Herkules interessierte Grabow nicht. Die Erinnerung an die Ereignisse der Nacht kam langsam wieder: „Benjamin. Ich hatte Streit mit diesem verdammten schwarzen Affen.“ Grabow quälte sich durch Übelkeit und Erinnerungsschatten. „Es ging um Schnaps.“
„Fängt der Junge auch schon damit an?“
„Unsinn. Er hat Gift in eine Schnapsflasche getan. Wollte mich beseitigen, das Aas. Er hat mich hinterrücks angegriffen.“
„Passiert selten, dass du nach einer Schlägerei als Opfer zurückbleibst“, sagte Breitmann. „Halt still, ich mache dir einen Kopfverband. Da ist eine Schnittwunde, vermutlich von Glassplittern. So, wie du stinkst, hat er dir mit einer Schnapsflasche den Scheitel frisch gezogen. Was bei einem Kerl mit Glatze natürlich nicht geht. Immerhin erspart es mir, dir die Haare abzuschneiden. Alles hat seine Vorteile.“
Grabow hörte gar nicht zu. „Wenn ich den erwische, bringe ich ihn um!“, knurrte er. „Wo ist er?“
„Ich habe ihn noch nicht gesehen.“
„Also abgehauen! Na, der wird seine Tracht Prügel erhalten, sobald er wiederkommt. Die letzte seines Lebens, das darfst du mir glauben.“ Grabow richtete sich stöhnend auf, nachdem Breitmann fertig war.
„Ich bringe dich hinüber in deinen Wagen. Du hast eine Gehirnerschütterung, also leg dich ins Bett. Ich werde ab und zu nach dir sehen. Du stehst erst wieder auf, wenn ich es dir sage, verstanden?“
Grabow war schwindelig, deshalb widersprach er nicht. Er ließ sich zu seinem Wohnwagen führen und dort von Breitmann ins Bett helfen.
Doch anstatt zu schlafen, blieb er mit offenen Augen liegen. Was war in diesen schwarzen Faulenzer gefahren? Wollte Benjamin ihn wirklich umbringen oder gab es einen anderen Grund für diesen heimtückischen Anschlag? Der Schmuck! Grabow tastet nach dem Schlüssel. Die Kette hing noch um seinen Hals. Stöhnend rollte er sich vom Bett und ließ sich auf den Boden fallen. Der Schmerz, der ihn durchzuckte, brachte ihn zum Brüllen. Trotzdem richtete er sich langsam auf. Die Kassette unter dem Tisch war verschlossen und unversehrt. Auf den Knien rutschte er zu ihr und öffnete sie.
Der Schmuck war noch da. Aber es fehlten Papiere und Bargeld. Auch der Brief der Königin war weg. „Dieb!“, brüllte Grabow. Die Wut ließ ihn seinen Zustand vergessen. Er sprang auf – jedenfalls wollte er es. Ohnmächtig brach er zusammen.
Der Zug aus Hannover erreichte pünktlich den Lehrter Bahnhof in Berlin. Benjamin stieg aus und sah sich um. Die Bahnhofshalle wölbte sich wie ein schwarzer Himmel über ihm. Tauben flatterten verschreckt durch den Qualm, der zwischen den Eisenträgern nach oben zog. Die Lokomotive mit den Wagen wirkte in dieser riesigen Konstruktion wie ein Spielzeug.
Unzählige Menschen schoben sich durch den Bahnhof hinaus auf den Vorplatz. Benjamin ließ sich mit der Menge treiben und gelangte auf die gegenüberliegende Straßenseite. Er war schon in Berlin gewesen, kannte aber nur einige Rummelplätze in der Stadt. Deshalb blieb er stehen und sah sich um. Zwar war die Fassade des Bahnhofsgebäudes nicht ganz so beeindruckend wie die in Hannover, aber dafür zeigte ihm die Umgebung, dass er sich in einer Großstadt befand. Droschken warteten in einer langen Reihe auf Fahrgäste. Unten im Kanal neben der Straße lagen Lastkähne am Ufer vertäut. Ihre Ladung wurde auf Pferdefuhrwerke verteilt, die dann langsam den Uferweg hinauf rollten.
Benjamin folgte der Straße Richtung Innenstadt. Wo der Kanal in die Spree mündete, überquerte er auf einer imposanten Brücke den Fluss. Neben ihm fuhren Pferdestraßenbahnen und Kutschen jeder Größe. Er sah ihnen zu, bis ein blau uniformierter Wachtmeister mit Pickelhaube auf ihn aufmerksam wurde.
Schnell sprang Benjamin auf die nächste Straßenbahn und entrichtete beim Schaffner die paar Pfennige, die eine Fahrt kostete. Trotz des Nieselregens blieb er auf der hinteren Plattform stehen und bestaunte die Umgebung.
In der breiten Prachtstraße „Unter den Linden“ sprang er von der langsam dahin zuckelnden Pferdetram ab und wanderte durch das Zentrum der Hauptstadt. Der Lärm und das Gedränge, die hier herrschten, machten ihm nichts aus; beides war er vom Rummel gewöhnt. Aber zum ersten Mal in seinem Leben war er ganz allein auf sich gestellt. Einsamkeit überlief ihn wie ein Schauer und ließ ihn für einen Moment ratlos stehenbleiben. Er musste sich zwingen, weiterzugehen, obwohl er kein Ziel hatte.
Wohlstand leuchtete aus allen Ecken, zumindest in denjenigen Straßen Berlins, durch die Benjamin mit seinem Bündel zunächst wanderte. Juwelierläden und teure Restaurants wechselten sich ab mit Hotels und vornehmen Herren-und Damenschneidern.
Er kam an einer Plakatsäule vorbei und sah sich die Angebote an. Zwischen der Werbung verschiedener Kaufhäuser und Anpreisungen einer Patent-Bartwichse prangte auch die Einladung zu einem Frühlingsfest. Sie versprach nie gesehene Wunder und sensationelle Darbietungen, darunter auch die folgende: „Ein artistischer Zwerg aus den Höhlen Norwegens präsentiert sein einmaliges Können dem hochverehrten Publikum.“ Fast hätte Benjamin Jubelschreie ausgestoßen. Das konnte nur Muck Stolberg sein! Diesen kleinwüchsigen Artisten kannte er gut. Das Datum auf dem Plakat zeigte, dass die Vorstellungen am vorhergehenden Wochenende geendet hatten, aber vielleicht war Muck noch dort. Benjamin wusste, dass sich im Sommer in Berlin Geld verdienen ließ durch Auftritte bei Vereinsfesten oder in Gartenlokalen. Deshalb blieben manche Schausteller mehrere Monate in der Stadt.
Benjamin ging weiter. Er wurde von Erwachsenen beiseite geschubst, wenn er im Weg war, oder böse angestarrt. Er dachte erst, es sei wegen seiner Hautfarbe. Aber es war nicht nur sie. Seine Kleidung stempelte ihn offenbar als Tagelöhner oder Bettler ab, der in dieser vornehmen Gegend nichts zu suchen hatte. Benjamin sah an sich herunter: Er trug eine einfache braune Hose und eine alte Leinenjacke über dem nicht sehr sauberen Hemd. Für einen Rummelplatz in der Provinz genügte das. Hier nicht.
Er fragte eine Dame nach dem Weg zu dem Jahrmarkt. Sie keifte: „Verschwinde oder ich rufe die Polizei! Verdammtes Gesindel, das einen ständig belästigt.“
Also machte Benjamin, dass er weiterkam. Auch andere Passanten schimpften, als er sie ansprach, oder gingen mit überheblichem Gesichtsausdruck einfach weiter.
Ein unrasierter junger Mann spazierte als lebende Werbefläche über den Gehsteig, mit einem Pappschild vor der Brust, auf dem für ein neueröffnetes Café geworben wurde. Er war freundlicher und beschrieb den Weg.
Zwei Stunden brauchte Benjamin, bis er den Ort des Jahrmarktes erreichte. Fachmännisch musterte er aus einigem Abstand dessen Umgebung. Das Gelände befand sich in einer einfachen, aber sauberen Wohngegend. Die Menschen hier gehörten zwar zur Arbeiterklasse, aber sie verfügten vermutlich über ausreichend Geld, um sich hin und wieder ein Vergnügen zu gönnen. Eine gute Gegend für einen Rummelplatz. Der Platz selbst war dagegen eine Enttäuschung: Ein großes, freies Grundstück, umgeben von den unverputzten Brandmauern der Wohnblöcke. Der Platz war nicht mehr als eine Lehmfläche mit braunen Wasserlachen.
In der hintersten Ecke stand ein einzelner, bunt bemalter Wohnwagen, der höher gebaut war als sonst üblich. Benjamin kannte den Wagen, er gehörte Frau Stolberg und ihrem Sohn. Er freute sich darauf, Muck und dessen Mutter wiederzusehen.
Weiter unten in der Straße, wo an beiden Seiten einer Kurve ein wenig Grün wuchs, tobten drei Jugendliche in Benjamins Alter herum. Sie schrien und schimpften über jemanden. Benjamin hielt Abstand zu ihnen. Es war ungewiss, wie sie auf einen dunkelhäutigen Altersgenossen reagieren würden, der nicht aus ihrem Kiez stammte. Doch dann hörte er eine Stimme, die er kannte: hell, quengelnd und so selbstbewusst, dass es gar nicht echt sein konnte.
„Ihr nichtsnutzigen Armleuchter, geht heim zu euren Mamas“, rief diese Stimme. „Da könnt ihr euch ausweinen.“
Benjamin ging langsam auf die Jugendlichen zu. Sie standen zwischen ein paar Büschen unter einem Baum und suchten etwas. Einer von ihnen hielt einen kräftigen Stock in der Hand.
„Verschwindet jetzt oder ich haue euch in Stücke“, drohte die helle Stimme. Sie kam aus den Büschen – oder doch von oben aus der Baumkrone?
Der Junge mit dem Stock schlug auf einen Busch ein, dass die Blätter und Äste nach allen Seiten davon flogen.
Benjamin ahnte, dass es Ärger geben würde, aber er wollte Muck nicht im Stich lassen. „Was macht ihr da?“, fragte er.
„Was geht dich das an?“, wollte der Junge mit dem Stock wissen. „Und wer bist du überhaupt?“
„Ich heiße Benjamin und bin neu in der Stadt.“
„Ich bin Hans. Halt dich raus. Wie siehst du eigentlich aus? Bist du geschminkt oder was?“
„Meine Mutter stammt aus Italien, da haben alle so eine dunkle Haut“, log Benjamin. Rosalinde hatte vielleicht nicht Unrecht mit ihrem Vorschlag, sich als Südeuropäer auszugeben.
„Ich kenne ein paar Italiener. Sie haben am Kanal gearbeitet. Die waren nicht so dunkel wie du.“
„Ganz im Süden sind die Leute so wie ich, wegen der vielen Sonne.“
Ein gackerndes Lachen kam aus dem Busch. „Süditalien, ha! Südwest-Afrika dürfte es besser treffen. Seht euch doch nur mal sein krauses Haar an, und die breite Nase. Läuft so ein anständiger Mensch herum?“
„Halt die Klappe, Muck“, sagte Benjamin zu dem Busch. „Sonst erzähle ich etwas über die Zwerge aus den Höhlen Norwegens.“
Hans stellte sich breit vor Benjamin auf: „Du kennst diesen Giftzwerg? Der hat uns Geld geklaut. Wenn du mit ihm befreundet bist, kannst du es uns ja zurückgeben.“
„Geklaut?“, rief Muck aus dem Busch. „Schadensersatz für die Kosten der Wäscherin war das, nachdem ihr mich mit Dreck beworfen habt.“
„Weil du hinter meiner Schwester hergegangen bist und dabei unanständige Lieder gesungen hast.“
„Alles längst verjährt!“
„Dann trau dich und komm raus.“ Hans schlug wieder mit dem Stock auf den Busch, erntete aber nur ein hämisches Lachen.
„Nichts da. Verschwindet und lasst mich in Ruhe.“
Hans wandte sich an Benjamin. „Du siehst wirklich aus wie einer, der aus Afrika ist. Obwohl du eher dunkel bist als schwarz. Ich wette, der Zwerg kennt dich vom Rummel. Also: Wirst du seine Schulden bezahlen?“
Ein anderer Junge mischte sich ein: „Entweder, du gibst uns das Geld oder du bekommst die Prügel. Du kannst sie ja dann an den Zwerg weitergeben, mit Zinsen.“
Die drei Jugendlichen umstellten Benjamin.
Der ließ sein Bündel fallen und machte sich bereit. Er kannte solche Situationen und fürchtete sich nicht vor Straßenjungs. Dank seiner anstrengenden Arbeit bei Grabow war er kräftiger als sie. Trotzdem versuchte er, den Streit friedlich zu schlichten. „Lasst mich in Ruhe und Muck auch. Wie ich ihn kenne, hat er keinen Pfennig in der Tasche.“
„Aber du.“
„Ich habe nichts damit zu tun.“
Zwei der Jungs sprangen auf Benjamin zu und hielten ihn links und rechts an den Armen fest. Hans bückte sich nach Benjamins Bündel. „Mal sehen, ob du Geld dabei hast.“
Benjamin versuchte sich loszumachen, schaffte es aber nicht.
Da kam Hilfe von unvermuteter Seite: Etwas raschelte in den Ästen des Baumes und ein kleiner Mensch fiel herunter, genau auf den Rücken von Hans. Wie ein Reiter klammerte sich Muck fest und riss Hans an den Haaren. Die beiden Jungs ließen Benjamin los, um ihrem Freund zu helfen. Das nutzte Benjamin, um sie mit einem kräftigen Schwung zu Boden zu werfen. Hans wälzte sich schreiend unter dem Zwerg, während Benjamin sich mit den anderen beiden herumschlug. Es stellte sich schnell heraus, dass es die Gassenjungs nicht mit zweien vom Rummel aufnehmen konnten.
Hans ergriff die Flucht, als Muck von ihm ab ließ, und seine Freunde folgten ihm. Benjamin ließ sie laufen.
„Wir kommen wieder“, schrie Hans aus sicherer Entfernung.
Muck schüttelte die Faust in seine Richtung: „Ja, gerne. Wir haben eh nichts Besseres vor, als uns mit euch zu prügeln.“
„Ärgere sie nicht noch mehr“, riet Benjamin. „Wenn sie Verstärkung mitbringen, verlieren wir.“
„Ach, was. Mit denen streite ich mich seit drei Monaten. So lange sitzen wir hier schon fest. Erst war Jedah krank, dann kam der Frühlingsmarkt, da liefen die Geschäfte ganz gut. Aber anschließend hat uns ein Gauner um unsere gesamten Einnahmen gebracht. Er kam als Prediger und hat versprochen, sich um die verlorenen Seelen der Schaustellerkinder zu kümmern. Du kennst ja solche Typen. Sind meist ganz nett, auch wenn sie einem schnell auf die Nerven gehen. Aber diesmal war es ein Trickbetrüger. Pech gehabt.“
„Und wie geht es Jedah? Ist sie wieder gesund?“
„Sie ist dick geworden und sieht aus wie eine Kanonenkugel auf Beinen, aber sonst geht es ihr gut. Und das mit dem Gewicht wird sich auch bald geben. Wir haben nämlich kein Geld mehr, um uns etwas zu Essen zu kaufen. An den Wochenenden mache ich in der Innenstadt auf Plätzen ein wenig Klamauk. Damit verdiene ich aber nur ein paar Groschen. Komm herein.“
Sie stiegen in den Wagen, der leicht schief stand, weil eines der Räder angebrochen war. Ein paar Ziegelsteine stützten die Achse. Drinnen dauerte es einen Moment, bis sich Benjamins Augen an das Halbdunkel gewöhnten. Die Einrichtung war noch so, wie er sie in Erinnerung hatte: Vorne war ein Bereich, in dem auch normalgroße Menschen sich aufhalten konnten; hinten war der Wagen in zwei Etagen aufgeteilt, die hoch genug für die Stolbergs waren. Dort befand sich unten ein gutbürgerliches Wohnzimmer mit viel Plüsch und gestickten Deckchen und Schonbezügen. Oben, hinter Vorhängen, waren zwei Schlafkammern verborgen.
In einem speziell für ihre Größe angepassten Sessel saß eine kleine, dicke Frau und strickte. „Benjamin, komm her!“, rief sie und winkte ihn zu sich. „Willkommen! Ist Grabow auch hier?“
„Nein. Der ist in Hannover geblieben.“ Benjamin setzte vor Jedah auf den Boden.
Jedah war nur halb so hoch wie normal gewachsene Menschen, aber ihre natürliche Autorität ließ ihre geringe Größe schnell vergessen. Sie musterte Benjamin aufmerksam und legte ihr Strickzeug beiseite.
„Was ist passiert, Junge?“
Jedah zu berichten, wie er Grabow niedergeschlagen und verlassen hatte, war für Benjamin wie eine Beichte. Erleichtert sah er, dass sie das alles gar nicht so schlimm fand. Anschließend nahm er die Papiere aus seinem Bündel, die belegten, dass ein Herr Riehmann aus Berlin Unterhalt für ihn an Grabow bezahlte.
„Grabow ist ein Gauner, das war mir immer klar“, sagte Jedah entrüstet. „Aber dich jahrelang so zu betrügen, das erfordert einen ganz miesen Charakter.“
„Ich frage mich, wer dieser Türke ist, der dich abgefangen hat“, warf Muck ein.
„Den wird die Prinzessin damit beauftragt haben, den Schmuck wieder zu beschaffen.“
„In England gibt es Leute, die betreiben das als Profession.“ Jedah kannte sich aus in der Welt und ließ das gerne durchblicken. „Es hat sich ein ganzes Gewerbe daraus entwickelt. Falls das so einer ist, wird der Mann nicht locker lassen. Weiß jemand, dass du zu uns wolltest?“
„Nein. Ich habe ein altes Plakat vom Frühlingsfest gesehen. Deshalb bin ich hierher gekommen.“
„Du hast nicht zufällig noch etwas Geld übrig nach der Reise?“ Jedah errötete und fügte hinzu: „Ich frage ungern, aber du weißt ja, wie das ist, wenn es kaum noch für einen Kanten Brot reicht.“
Benjamin zog das Geld heraus, das er Grabow gestohlen hatte, und gab den größten Teil davon Jedah. Es würde reichen, um die beiden Stolbergs eine Weile zu ernähren. „Schenke ich euch. Kann ich hier bleiben, bis ich meinen Vater gefunden habe?“
Muck schnappte die Scheine mit einer schnellen Bewegung aus der Hand seiner Mutter. „Klar, du könntest auch bleiben, ohne zu bezahlen. Aber dann hätten wir einen mehr, der nichts zu essen hat, und das wäre gar nicht lustig. Ich gehe einkaufen, kommst du mit?“
„Er bleibt hier“, antwortete Jedah an Benjamins Stelle. „Je weniger Leute ihn auf der Straße sehen, desto besser. Zumindest, bis wir wissen, woran wir sind.“
„Gut, gehe ich eben alleine.“
Benjamin begann, nach Jedahs Anweisungen ein paar Möbel zu verschieben, so dass auf dem Boden Platz genug für einen Menschen seiner Länge frei wurde. Dort konnte er später ein paar Decken ausbreiten, um darauf zu schlafen.
Benjamin war zufrieden: Sein erster Schritt in ein freies Leben war gelungen. Jetzt ging es für ihn darum, seinen Vater zu finden. Herrn Riehmann in Steglitz.
Jedah wackelte bedenklich mit dem Kopf. „Grabow wird auf das Geld von diesem Riehmann nicht einfach verzichten.“
„Ich muss Riehmann finden, bevor Grabow hier auftaucht“, stimmte Benjamin zu. Er wusste nur noch nicht, wie.