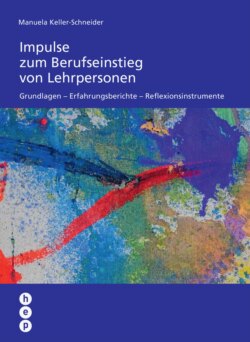Читать книгу Impulse zum Berufseinstieg von Lehrpersonen (E-Book) - Manuela Keller-Schneider - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Vorwort
ОглавлениеEndlich ist es so weit! Der Einstieg in den Beruf ist ein Ziel, auf das lange hingearbeitet wird. Praxiserfahrungen und Beurteilungen durch Ausbildnerinnen und Ausbildner unterstützen angehende Lehrpersonen in ihrer Entwicklung, doch eine Ausbildung schränkt den Gestaltungsfreiraum ein. Dass der Einstieg in die eigenverantwortliche Berufstätigkeit eine gewisse Entlastung von Fremdbestimmung und Beurteilung mit sich bringt und von der Freude begleitet wird, eigenständig handeln zu können, kommt in der folgenden Aussage zur Geltung. Gleichzeitig zeigt sich darin aber auch das Bewusstsein, nun selber verantwortlich zu sein und eigenen Erwartungen entsprechen zu müssen.
«Endlich kann ich selber bestimmen, wie ich eine Klasse unterrichten und führen möchte! – Aber nun muss ich auch selber wissen, wie ich das tun will.» (Barbara Binder, nach sieben Wochen Berufstätigkeit)
Die Freude ist jedoch auch von Ungewissheiten begleitet, denn wie sich die ‹echte› Berufstätigkeit ‹anfühlt›, zeigt sich erst dann, wenn man mitten drin ist. Eine Ausbildung legt gute Grundlagen, um in den Beruf einsteigen zu können, kann die Komplexität der Anforderungen des Berufs jedoch nur begrenzt vorwegnehmen (Keller-Schneider, 2010a).
«Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass es noch so viel Neues, mir Unbekanntes gibt.» (Nathalie Türler, nach sieben Wochen Berufstätigkeit)
Der Berufseinstieg stellt Anforderungen, die im Rahmen einer Ausbildung trotz Praktika1 nur begrenzt erfahren werden können, da die Komplexität der Anforderungen und die Dynamik ihrer Gleichzeitigkeit beim Einstieg in die eigenverantwortliche Berufstätigkeit sprunghaft ansteigen (Keller-Schneider & Hericks, 2014).
«Ich habe in der Ausbildung ja sehr viel gelernt und sehr viel gearbeitet – doch so viel wie in den letzten drei Monaten noch nie! Ich wusste nicht, dass das möglich ist und erst noch Freude bereitet.» (Nora Maag)
Unterrichten wurde in Praktika bzw. im Referendariat intensiv erprobt; Unterrichtsvorbereitungen gehen bereits leichter von der Hand (Keller-Schneider 2016a). Sich auf diese erworbenen Handlungssicherheiten zu verlassen, reicht jedoch nicht aus, denn das Lernen der Schülerinnen und Schüler muss nun auch in einer grösseren zeitlichen Reichweite verantwortet werden.
«Es genügt nicht mehr, einfach zu unterrichten, vom Stoff her zu denken und diesen für die Schülerinnen und Schüler aufzubereiten. Ich muss nun auch ihre Lernprozesse im Auge behalten, sie in ihrem Lernen begleiten und eine Arbeitskultur aufbauen, die ermöglicht, dass auch wirklich selbstständig gearbeitet werden kann. Das finde ich schon sehr herausfordernd!» (Esther Gerber, im ersten Berufsjahr, in Keller-Schneider 2016b)
Diese Stimmen illustrieren die besonderen Herausforderungen des Berufseinstiegs. Vieles kommt auf die berufseinsteigenden Lehrpersonen zu, was vorher nur begrenzt erfahren werden konnte. Die folgende Aussage macht deutlich, dass diese Phase des Einsteigens zu einem Abschluss kommt und in ein Gefühl übergeht, den Einstieg geschafft zu haben und im Beruf angekommen zu sein. Wann sich diese erste Phase schließt, ist individuell verschieden.
«Nun bin ich im Beruf angekommen – aber es war anstrengend!» (Wanda Färber)
Der Berufseinstieg stellt Herausforderungen, die von den Lehrpersonen individuell gemeistert werden müssen. Die Vielfältigkeit der Anforderungen zeigt sich verkürzt in der folgenden Aussage:
«Dass ich tausend Dinge beachten muss und dabei noch ruhig das Ganze überblicken soll, strapaziert mich arg. Wie kann ich gleichzeitig den Unterricht führen und dabei den Lernprozess jedes Kindes im Auge halten? Wie kann ich die Arbeitsatmosphäre sicherstellen, wenn noch keine Klassengemeinschaft besteht? Wie soll ich den Eltern klar und professionell gegenübertreten, wenn ich noch unsicher bin, wie ich als Lehrerin sein will? Wie kann ich im Team mitdenken und mitgestalten, wenn ich noch nicht weiss, was denn alles zur Arbeit innerhalb einer Schule gehört und welche ungeschriebenen Gesetze ich selbstverständlich beachten muss?» (Barbara Binder, in Keller-Schneider 2010a)
Der Übergang in die eigenverantwortliche Berufstätigkeit kann nicht reibungslos verlaufen, sondern muss aktiv bewältigt werden. In den Beruf einsteigende Lehrpersonen verfügen über grundlegende Fähigkeiten, um sich in der Berufsausübung weiteres Wissen und Können anzueignen. Dass der Wechsel in die eigenverantwortliche Berufstätigkeit die beruflichen Anforderungen an die Lehrperson in einen neuen Referenzrahmen stellt und Weiterlernen erfordert, gilt als gesichert. Wie dieser Übergang wahrgenommen und bewältigt wird, ist individuell verschieden – Patentrezepte gibt es nicht (Keller-Schneider, 2010b).
Das vorliegende Buch will Anregungen geben und Wege aufzeigen, wie diese Herausforderungen bearbeitet und bewältigt werden können. Da es kein ‹richtiges› Handeln gibt und Lösungen einer konkreten Anforderung von der spezifischen Situation sowie von individuellen Sichtweisen der handelnden Lehrperson geprägt werden, möchte ich Möglichkeiten aufzeigen, die weiterführende Lösungen eröffnen und Impulse geben, um das eigene Handeln reflektieren und darauf aufbauend eigene Lösungswege entwickeln zu können.
Die Entscheidung, wie eine Situation angegangen und bewältigt werden kann, wird den Lesenden nicht abgenommen. Es werden keine Tipps gegeben, die es zu befolgen gilt, sondern Impulse, die erst in der eigenverantwortlichen Präzisierung erfolgsversprechend wirken können. Basierend auf meiner Erfahrung als Lehrerbildnerin, den vielen Begegnungen mit kompetenten Berufseinsteigenden und den Befunden meiner Studien zum Berufseinstieg von Lehrpersonen möchte ich die neu in den Beruf einsteigenden Lehrpersonen stärken, die Berufsaufgabe eigenverantwortlich anzupacken und ihr individuelles Potenzial dafür zu nutzen, ihre Berufstätigkeit professionell zu gestalten.
Zur Entstehung des Buchs
Im Rahmen meiner Berufsarbeit als Supervisorin für Berufseinsteigende, als Dozentin und Mentorin von angehenden Lehrpersonen (Studierende der einphasigen Lehrerbildung in der Schweiz), in der Lehre im Rahmen der Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen sowie über Befunde aus meinen Studien zum Berufseinstieg von Lehrpersonen wurde klar, dass es berufsphasenspezifische Herausforderungen gibt, denen sich alle stellen müssen. Eine Verknüpfung von unterschiedlichen Zugängen, Sichtweisen und Vorgehen gibt hilfreiche und nachhaltige Impulse zur Bewältigung von Berufsanforderungen. Verknüpfungen können über vielfältige Wege erfolgen. In meiner Berufstätigkeit bin ich vielen sehr kompetenten Berufseinsteigenden begegnet, deren Potenzial ich in das Buch integriere und die ich unter anonymisierten Namen zu Wort kommen lasse.
Zugänge
Die Inhalte werden über drei Zugänge dargelegt. Grundlegendes, für die Berufsarbeit bedeutsames Wissen wird mit spezifischen Erfahrungen von Berufseinsteigenden konkretisiert und mit Reflexionsimpulsen angereichert, um eigene Erfahrungen daran zu spiegeln und weiterzuentwickeln.
(1) Allgemeine Zugänge und theoriebasierte Elemente werden aufgegriffen und für die spezifische Situation, in der Berufseinsteigende stehen, nutzbar gemacht. Es ist durchaus möglich und beabsichtigt, dass einzelne Inhalte aus der Ausbildung bekannt sind und damit wieder in Erinnerung gerufen werden. Ausgewählte theoretische Zugänge werden dazukommen und weitere werden nicht aufgegriffen, auch wenn diese ebenso hilfreich sein könnten.
(2) Berichte und kurze Schilderungen von neu in den Beruf einsteigenden Lehrpersonen geben Einblick in subjektive Zugänge und zeigen auf, wie diese Lehrpersonen spezifische Anforderungen bewältigt haben und welche Erfahrungen sie daraus ziehen.
(3) In einem dritten Zugang werden Reflexionsimpulse gegeben, um die eigene Situation und individuelle Erfahrungen einzubeziehen. Eine mit Leitfragen angeregte Reflexion dieser Erfahrungen soll ermöglichen, die eigene Situation unter erweiterter Perspektive zu betrachten und daraus neue Lösungen zu entwickeln.
Die drei Zugänge werden grafisch unterschiedlich gestaltet, sodass eine Orientierung bezüglich der Zugänge und Textsorten erleichtert wird. Damit soll auch ein fokussiertes Lesen ausgewählter Texte erleichtert werden.
Gliederung
Die Gliederung des Buches basiert auf Befunden der Studie «Entwicklungsaufgaben im Berufseinstieg von Lehrpersonen» (EABest) (Keller-Schneider 2010a) und folgt den Anforderungsbereichen, die empirisch in dieser Studie über den Berufseinstieg von Lehrpersonen identifiziert wurden. Die Inhalte fokussieren auf berufsphasenspezifisch wahrgenommene Herausforderungen und Lösungen.
Eine Einleitung (Kapitel 1) führt in die Thematik ein, zeigt theoretische Zugänge zur Bewältigung von Anforderungen und zur Kompetenzentwicklung allgemein und im Berufseinstieg auf. Es folgen Befunde aus der Studie «EABest» (Entwicklungsaufgaben im Berufseinstieg von Lehrpersonen, 2004–2008). Die theoriegestützte Grundlage des Buches kurz darzulegen, ist mir ein Anliegen, denn diese prägt die Auswahl der Inhalte und die Zugänge der Ausführungen – dieser Teil kann aber auch übersprungen werden. Das Buch lässt sich auch als Nachschlagewerk nutzen und auszugsweise lesen; die Teile sollten auch losgelöst vom Rest des Buches verständlich sein.
Die Herausforderungen, die berufliche Anforderungen stellen, werden in den anschliessenden Kapiteln ausgeführt. Als zentrale Aufgabe erweist sich die Auseinandersetzung mit der Berufsrolle, die im Berufseinstieg als erste Phase der eigenverantwortlichen Berufstätigkeit erneut gestaltet und in eine berufliche Identität überführt wird (Kapitel 2). Es folgen Impulse zur Thematik von Unterricht und Unterrichten (Kapitel 3), da sich auch diese Anforderungen im Berufseinstieg wandeln. Standen im Rahmen der Ausbildung das Gelingen und der reibungslose Ablauf einer Unterrichtssequenz im Vordergrund, so wird im Rahmen der Berufstätigkeit eine Ausrichtung auf die Schülerinnen und Schüler bedeutsam. Es folgen Ausführungen zur besonders herausfordernden Anforderung der adressatenbezogenen Vermittlung (Kapitel 4), d. h. zur Aufgabe, die Adressaten zu erreichen und eine individuelle Passung der Anforderungen, des Unterrichts und der Förderung zu erzielen, um die Schülerinnen und Schüler in einer längerfristigen Perspektive zu begleiten. Aufgaben der Klassenführung (Kapitel 5) sind davon geprägt, dass nun, im Rahmen der eigenverantwortlichen Berufstätigkeit, erstmals eine Lern- und Arbeitskultur aufgebaut und gefördert werden muss, die von der Lehrperson und ihren erzieherischen Zielen sowie durch ihre direkten Interventionen gelenkt und gestaltet wird. Anforderungen der Kooperation in und mit der Institution Schule folgen nach (Kapitel 6). Berufseinsteigende sind erstmals vollwertige Mitglieder eines Kollegiums und einer Schule, in die es sich einzufinden und die es mitzugestalten gilt. Anforderungen, Elternkontakte aufzubauen und zu pflegen (Kapitel 7), bilden den Abschluss. Sie stellen Herausforderungen dar, die nicht den Schulalltag direkt bestimmen, die aber über die neu zu verantwortende Aufgabe indirekten Einfluss auf die Lehrperson und den Schulalltag ausüben. Die vielfältigen und facettenreichen Zugänge zur Thematik beleuchten diese nur ausschnittweise, Vollständigkeit wird nicht angestrebt.
Dank
Bedanken möchte ich mich bei allen Lehrpersonen für die wertvollen Beiträge sowie für die interessanten Begegnungen und Gespräche, Anregungen und Fragen, aus denen gemeinsam entwickelte Lösungen entstehen konnten. Einige Lehrpersonen haben auch mit schriftlichen Dokumenten zur Arbeit beigetragen, wofür ich mich ebenfalls bedanken möchte. Erinnerungen und Erkenntnisse aus diesen Begegnungen haben mich in meiner Berufsarbeit bereichert und gehen anonymisiert in das Buch ein.
Uster, im Herbst 2018
Manuela Keller-Schneider