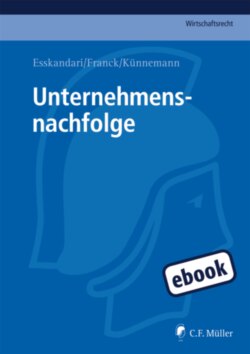Читать книгу Unternehmensnachfolge - Manzur Esskandari - Страница 53
На сайте Литреса книга снята с продажи.
i) Erhaltungskosten und Aufwendungen des Unternehmens
Оглавление194
Der Vorerbe trägt die gewöhnlichen Erhaltungskosten, § 2124 Abs. 1 BGB. Zu den gewöhnlichen Erhaltungskosten gehören bei einem Unternehmen die laufenden Betriebskosten (insbesondere Löhne, Werbungskosten, Steuern etc.).[220] Diese Regel wirkt sich für den Vorerben in zweifacher Hinsicht nachteilig aus: Zum einen muss der Vorerbe die gewöhnlichen Erhaltungskosten aus seinem neben der Vorerbschaft bestehenden Privatvermögen bestreiten; zum anderen reduzieren die Erhaltungskosten den (wie auch immer zu berechnenden, vgl. hierzu Rn. 191) bilanziellen Gewinn, der dem Vorerben als Nutzung verbleibt. Besonders nachteilig wirkt sich die Erhaltungspflicht bei Wirtschaftsgütern aus, die steuerlich abgeschrieben werden können. Die steuerliche Abschreibung führt wiederum zu einer Verminderung des bilanziellen Gewinns, auf der anderen Seite stehen die dadurch entstehenden stillen Reserven und das Wirtschaftsgut selbst dem Nacherben und nicht dem Vorerben zu. Richtigerweise sollte der Erblasser daher bestimmen, dass die laufenden Betriebskosten dem Nachlass entnommen werden dürfen.[221] Entsprechendes gilt für Erhaltungskosten, die bei einer normalen Expansion des Unternehmens anfallen.
195
§ 2124 Abs. 2 S. 1 BGB bestimmt, dass der Vorerbe über die gewöhnlichen Erhaltungskosten hinausgehende Aufwendungen aus der Erbschaft bestreiten darf, sofern er sie nach den Umständen für erforderlich halten durfte (außergewöhnliche notwendige Aufwendungen). Im unternehmerischen Bereich lässt sich darunter z.B. eine erforderliche außergewöhnliche Umstellung oder Rationalisierung des Unternehmens subsumieren. Grds. zählen auch Kosten eines Rechtsstreits zu solchen Aufwendungen, sofern der Rechtsstreit den Bestand des Unternehmens berührt. Steht ein Rechtsstreit hingegen – wie wohl regelmäßig – lediglich im Zusammenhang mit dem erstrebten Gewinn, handelt es sich um Erhaltungskosten, die der Vorerbe aus seinem Vermögen zu bestreiten hat. Zahlt der Vorerbe Aufwendungen i. S. d. § 2124 Abs. 2 S. 1 BGB aus seinem Privatvermögen, hat er gegen den Nacherben einen Erstattungsanspruch, § 2124 Abs. 2 S. 2 BGB. Nimmt der Vorerbe zur Finanzierung derartiger Aufwendungen einen Kredit auf, dann muss er die dafür anfallenden Zinsen aus seinem Privatvermögen bestreiten.[222] Der BGH vertritt darüber hinaus die Ansicht, dass der Vorerbe auch einen Teil der Tilgung tragen muss.[223] Durfte der Vorerbe die Aufwendungen nicht für erforderlich halten (z.B. eine außergewöhnliche Betriebserweiterung), so hat der Vorerbe gegen den Nacherben Anspruch auf Ersatz dieser Aufwendungen nach den Vorschriften über die Geschäftsführung ohne Auftrag, § 2125 Abs. 1 BGB. Entsprachen die Aufwendungen nicht dem wirklichen oder mutmaßlichen Willen des Nacherben und lagen sie auch nicht in Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Pflicht (§§ 683, 679 BGB), steht dem Vorerben allenfalls noch ein Bereicherungsanspruch bzw. ein Wegnahmerecht nach § 2125 Abs. 2 BGB zu.
196
Praxishinweis:
Hat der Vorerbe-Unternehmensnachfolger auch nur den geringsten Zweifel daran, ob eine von ihm geplante unternehmerische Maßnahme eine außergewöhnliche notwendige Aufwendung i. S. d. § 2124 Abs. 2 S. 1 BGB darstellt, sollte er – sofern erreichbar – die Zustimmung des Nacherben einholen. Aufwendungen, die der Vorerbe mit Einverständnis des Nacherben tätigt, darf er immer als erforderlich ansehen. Darüber hinaus ist der Vorerbe stets berechtigt, die für den Erwerb vom Erblasser etwa anfallende Erbschaftsteuer dem Nachlass zu entnehmen, § 20 Abs. 4 ErbStG. Führt diese Entnahme allerdings zu einer Überentnahme i. S. d. § 13a Abs. 5 S. 1 Nr. 3 ErbStG, kann dies zu einer Nachversteuerung des vererbten Unternehmens führen.[224]