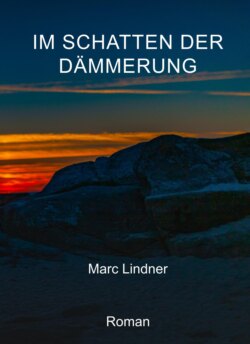Читать книгу Im Schatten der Dämmerung - Marc Lindner - Страница 11
Der Steinmetz und seine Last
ОглавлениеDie Gänge vor ihnen waren dunkel und die Finsternis ließ sich nur widerwillig von der Öllampe zurückdrängen. Der Steinmetz fühlte sich merklich unwohl. Bei jedem Schritt fürchtete er sich vor seinen eigenen Geräuschen. Obschon er sich sicher war, dass sie hier unten allein waren, wollte diese tiefsitzende Angst ihn nicht loslassen. Dabei wusste er nicht, warum er Angst hatte. Seine geliebte Familie bestand nur noch aus dem kümmerlichen Rest seiner Selbst und sein scheinbar einziger Freund war ein sogenannter Feind seines Volkes. Auch wenn er selbst ihm diese Bezeichnung niemals gegeben hätte, so änderte es nichts daran, dass diese Reise alles verändern würde. Seiner Heimat, seinem Leben musste er auf ewig den Rücken zukehren und auch wenn ihn das nicht allzu sehr schmerzte, so kam es ihm doch vor, als würde er seine tote Frau und seine Tochter verraten. Als würde er ihr Andenken schänden und sie verlassen, auch wenn er wusste, dass er die Erinnerung an sie überall hin mit sich tragen würde.
Er fühlte sich wie ein steinerner Zeuge, der wieder lernen musste, zu gehen. Jeder Schritt schmerzte, jeder Atemzug schien seine verkrampfte Brust sprengen zu wollen. Die Freiheit, der sein Begleiter entgegen schritt, war für ihn unerreichbar. Dabei wusste er nicht, ob er sie wirklich erreichen wollte. Auch wenn es lediglich ein Fristen war, so wollte er sein altes Leben nicht hinter sich lassen. Die Erinnerung, die Liebe, die er in sich trug, wollte er nicht zurücklassen und die Trauer, die diesen anhaftete, hielt ihn gefangen. Dennoch strebten seine Beine neben dem Zwerg her und dem Tageslicht entgegen. Die Freude darüber wollte sich ihm nicht zeigen und nicht einmal eine Erleichterung, dass er diesen tristen, beängstigenden Ort verlassen würde, wollte ihn erfüllen. Er war leer. Leerer noch als am Morgen, da er seine Arbeit aufnehmen sollte. Es war als wäre er die ganze Zeit geflohen und nun müsste er sich eingestehen, dass er nicht vor sich fliehen konnte, und gab es auf zu laufen. Es war wie ein ferner Traum und so ließ er sich treiben. Ziellos wie ein in den Fluss gefallener Zweig und so schwer wie ein sinkender Stein, der in tiefer Trauer zu ertrinken drohte.
„Willst du mich nicht führen, mein hochgewachsener Freund?“, meinte Almar in einem sorglosen Ton, als wisse er nicht, dass er soeben dem Tod ein weiteres Mal entronnen war und sich auf der Flucht befand.
Wie zuvor brauchte der Handwerker eine Weile bis er aus seinen Gedanken aufwachte und die Frage des Zwerges ihn erreichte. Seine übliche, verwunderte Miene, verzog sich zu einem leicht beschämten Ausdruck völliger Ratlosigkeit.
„Ehrlich gesagt sind wir zu tief in den Gängen. Hier kenne ich mich nicht aus. Tut mir leid, aber wir werden den Weg schon finden. Einfach immer bergauf.“ Mit bescheidenem Erfolg versuchte sich Tibur an einem zuversichtlichen Lächeln.
„Und ob wir den finden!“ Almar lachte belustigt. „Ich hatte nur gedacht, nachdem du gute vier Wochen lang hier jeden Tag hinuntergekommen bist, würdest du den Weg kennen.“ Der Zwerg klang belustigt über die Vorstellung wie wenig sich sein neu gewonnener Freund in seiner eigenen Heimatstätte auskannte.
„Ich kenne allerdings den Weg nur bis dorthin, wo wir uns das erste Mal begegnet waren“, sprach der Zwerg weiter, als er merkte, dass ihm Tibur nichts entgegnen wollte. „Das sollte wohl reichen, damit wir hier herausfinden“, gab sich der Zwerg völlig unbesorgt und versuchte Tibur mit seiner Unbeschwertheit anzustecken. Doch er musste alsbald merken, dass es ihm nicht gelingen wollte. Dort wo der Steinmetz weilte, war er zu fern von allem, als dass die Zuversicht des Zwerges ihn erreichen konnte.
„Das wird es wohl“, entgegnete Tibur tonlos und sein gealtertes Gesicht verzog sich zu einem gutmütigen Lächeln als wollte er dem Zwerg zeigen, dass dieser sich nicht um ihn zu sorgen brauchte.
So gerne der auflebende Zwerg es glauben wollte, so ließ er sich doch nicht von den bescheidenen Täuschungsversuchen überzeugen. Doch noch sah er keinen Weg, sich für seine Befreiung zu bedanken und seinem Freund – er war gerne bereit den an sich fremden Menschen als solchen zu bezeichnen – seine Hilfe darzubieten. So blieb ihm nichts anderes übrig, als vorerst den Weg aus diesem Tunnellabyrinth zu suchen. Er konnte sich noch an jede Windung, jede Abzweigung des Ganges erinnern, durch den die Hünen ihn in sein Verlies gebracht hatten. Nicht nur weil sie es für unnötig gehalten hatten, ihm die Augen zu verbinden, konnte er jeden Stein wiedererkennen. Viel genützt hätte es ohnehin nicht, denn er war ein Kind der Erde. Sein Leben lang hatte er unter der Erde zugebracht und immer waren es steinerne Gänge gewesen, die seine Wege umschlungen hatten. So wie einer der im Wald aufwächst sich nie in einem solchen verlaufen könnte, so tat es auch niemals ein Zwerg, wenn er sich im Schoß seiner geliebten Mutter Erde befand. Jeder Gang hatte seinen eigenen unverwechselbaren Geruch. Nicht nur die feuchte Luft, die den Duft des Steines in sich trug, verriet ihm, wo sie dran waren. Sicherlich – im Vergleich zu seiner Heimatsstätte – war der Geruch von abgestandenem Wasser an diesem Ort wahrlich einnehmend, und doch waren es andere Gerüche, die Almar leiteten. So wie die Stimmen des Waldes fast, so sprach der Stein zu ihm. Nicht mit Worten, nicht einmal wirklich hörbar und doch so, dass sich der Zwerg der Geschichte des Berges nicht entziehen konnte. Die Feuchtigkeit trug diese Gerüche nur noch deutlicher aus dem Felsen heraus. Es waren die Adern des Berges, die Almar unwiderstehlich wahrnahm. Erze, Steine, Salze und unzählige andere Elemente und Verbindungen malten ihr eigenes Bild im wachen Geist des Zwerges, der nicht blind, nicht taub und unachtsam für die Erzählungen des ihn umgebenden Felses war. Jeder Gang verriet ihm seine Geheimnisse. Nicht nur, dass er bemüht sein sollte, den Weg zu finden, so ärgerte er sich zudem mit welch Unverstand die Menschen ihre Gänge in den Felsen gebissen hatten. Er roch förmlich die blinde Wut, mit der sie gegen seine Mutter Erde vorgegangen waren. Nicht nur die vielen ächzenden Stützen waren bleibende Spuren die er deutlich lesen konnte. Die Menschen hatten sich in dem Felsen festgebissen, ohne von ihrem Willen abzuweichen, hatten sie sich durch die festen Schichten gekämpft, anstatt – so wie es die Zwerge stets taten – der Stimme des Gesteins zu lauschen und sich von ihm den Weg in die Tiefe zeigen zu lassen.
Obwohl die Gänge der Zwerge deutlich großzügiger waren – auch wenn es wegen ihrer bescheideneren Größe nicht nötig wäre –, so ließen sie dem Berg dennoch sein hartes Gestein, um die zahlreichen Gänge tragen zu können. Hier aber erkannte der Zwerg wieder einmal die Unfähigkeit der Menschen nachzugeben. Selbst wenn es zu ihrem Nutzen gewesen wäre. Aber die Menschen – wie es ihnen ihre Königin immer predigte – waren weder bereit zu teilen, noch sich anzupassen. Sie wollten herrschen. Nicht nur über ihr Reich, nein, auch über die Natur und alle Wesen, die dort lebten. Doch man konnte die Erde, die Natur vielleicht bekämpfen, wenn man denn wirklich so blind und dumm sein wollte, man könnte sie sogar in den Niedergang treiben, aber siegen könnte man nicht. Es war einfach kein Kampf, selbst wenn die Menschen es so sehen wollten. Aber es würde mit dem eigenen Untergang enden. Während der Zwerg weiter dem Pfad unter der Erde folgte, schürte sich erneut seine Wut gegen das Volk der Menschen und er wusste, dass diese sich viele Feinde machten. Mit leicht betrübter Miene beäugte er von Zeit zu Zeit den armselig neben ihm her schreitenden Menschen. Seltsam war für ihn, dass obwohl all diese Wut in ihm aufstieg, er nicht anders konnte, als Mitleid für seinen Weggefährten zu empfinden. Er fragte sich, ob er ihm alles erzählen sollte, was er wusste. Doch er entschied sich dagegen, da die Last, die Tibur mit sich schleppte, groß genug war. Vielleicht würde der Krieg, der schon bald heraufziehen würde, diesen weit weniger berühren, als Almar es sich vorstellen konnte. Denn wie hatte Tibur gesagt: Er wolle die Freiheit nicht, weil er sie nicht mehr verlieren können wollte. Das war nicht sein Krieg, auch wenn er mit jenem den Weg teilte, der ihn in sein Land bringen konnte. Almar würde seiner Königin berichten, was er zu berichten hatte. Mehr lag nicht in seiner Macht. Die Königin würde die Entscheidung treffen. Aber er ahnte bereits, wie sie lauten würde. Dieses Wissen ließ seine Schritte schwerer werden, als er es je für möglich gehalten hatte.
Tibur merkte nicht wie die zahllosen ineinander mündenden Gänge sie beide fortwährend höher trugen. Er schritt so selbstverständlich, so teilnahmslos neben dem Zwerg her, wie in den Tagen zuvor hinter den Wächtern. Seine Gedanken waren aber noch mehr aufgewühlt und ungeordnet. Er wusste, dass er hier herauswollte, schließlich hatte er seit Tagen und Wochen den Moment herbeigesehnt, da er nicht mehr hier hinunter musste, und doch war er für jeden Schritt dankbar, den er noch in dieser abgeschiedenen Dunkelheit weilen konnte. Nur das flackernde Licht, das sie mit sich trugen und die scheinbar unbeschwerten Worte des Zwerges begleiteten ihn. Es schien als könnte der Zwerg – nun da er zu sprechen angefangen hatte – nicht mehr schweigen.
Aber Tibur störte es wenig. Es hatte etwas Beruhigendes an sich. Der Zwerg bedrängte ihn nicht, forderte nicht seine Aufmerksamkeit, sondern begleitete ihn mit seinen Worten, seiner kräftigen, dunklen Stimme. Was dieser sagte, bekam der Handwerker nicht mit, und doch verdrängte es die Kälte des Ortes. Ja, es verbannte auf seltsame Weise gar die lähmende Angst. Obwohl der Zwerg in Tiburs Welt zwischen der Wirklichkeit, dem Traum und Wahn nicht einzutreten vermochte, wirkte die wohlklingende Stimme wie ein Anker, an dem sich Tibur festhielt. Der Zwerg weilte am Rande von Tiburs Wahrnehmung und wartete darauf, dass Tibur sich hervorwagte. Almar erschuf mit seinen Worten einen beruhigenden Gesang. Es war für Tibur fern und doch berührte es ihn, so wie ein warmer Abendwind, der über eine auskühlende Ebene streicht. Bei Tibur schwand das erste Mal das Gefühl zu frieren. Er war auf einer langen Reise, das wusste er, und die Musik des Zwerges wurde zu seinem Herzschlag, der ihn in dieser Welt festhielt.
„Wie können die eigentlich ein ganzes Gefängnis unbewacht lassen, diese Narren“, ärgerte sich der Zwerg, da ihm dies alles zu sonderbar vorkam, als dass er sich damit anfreunden konnte. „Wieso waren die Tore in so einem schlechten Zustand? Keines war mehr zu und fast alle waren halb verrostet oder ließen sich gar nicht schließen.“ Der Zwerg regte sich immer mehr auf, denn es machte ihm Angst. Es war zu einfach.
Tibur sah verwundert zu seinem kleineren Freund hinunter. „Freu dich doch.“ Tibur teilte Almars Sorgen nicht.
„Glaub mir, das tue ich auch, aber irgendetwas stimmt hier nicht. Das stinkt gewaltig!“
„Das ist ein uraltes Gefängnis, in dem du warst. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wann überhaupt jemals einer dort eingesperrt war“, versuchte sich Tibur an einer Erklärung. Doch zu seinem Verdruss verlangte der rätselnde Blick des Zwerges weitere Erläuterungen.
Tibur ließ ein resignierendes Stöhnen erklingen. „Schon der vorige Stadtherr hat ein neues Tunnelsystem anlegen lassen. Tief unter dem Palast befindet sich ein grausiges Gefängnis. Es soll nur einen einzigen Ausgang haben und dort befindet sich eine zwanzig Meter tiefe Leiter, die immer herausgezogen wird. Der Stadtherr wollte wohl seine Wachen einsparen. Diese Tunnel werden, wenn überhaupt, als Lager genutzt.“
„Aber warum bin ich nicht dorthin gebracht wurden?“, wurde der Zwerg noch verärgerter.
„Vielleicht wollte Thanatos oder der Stadtherr nicht, dass die Menschen wissen, dass ein Zwerg in unserer Stadt ist. Er sagt, ihr wäret ein blutrünstiges Gesindel. Und vielleicht ist das einfach nur eine Lüge.“
„Und ob das eine Lüge ist!“ Der Zwerg brüllte verbittert und vergaß, dass sie sich in unsicheren Gängen befanden und jeden Augenblick entdeckt werden konnten.
Tibur sah zu dem Zwerg herab und schüttelte verwirrt seinen zerstreuten Kopf. Er hatte vergessen, in welcher Gesellschaft er sich befand. Seine Gedanken waren weit abgeschweift und er hatte es seiner Zunge überlassen, die Worte zu wählen. „Verzeih, natürlich weiß ich es nun besser. Aber die anderen nicht. Wahrscheinlich wollten sie, dass es so bleibt. Denn nur so wird er seinen Krieg gegen euch führen können.“
„Du sprichst als habest du ihm schon vorher nicht geglaubt?“ Almar nahm Tibur die schlecht gewählte Formulierung schon nicht mehr übel.
„Wie soll ich einen hassen, den ich nicht kenne? Wie jemanden fürchten, den ich niemals sehe? Da habe ich weit mehr Angst vor diesem König. Seine Gier nach Macht scheint unersättlich. Seine makellosen Auftritte machen mir Angst. Er hat so viele die ihm blind folgen und für meinen Geschmack sind zu viele Magier unterwegs, die allerorts ihre Magie ausprobieren. Er kontrolliert ausreichend Land und doch lässt er seine Stadthalter wildern, als wären wir alle nur Vieh. Wahrscheinlich will er nur die Reichtümer der Zwerge. Als würden eure goldenen Hallen uns ernähren können.“ Tibur schüttelte entmutigt den Kopf. Nein, das war nicht sein Krieg und auch nicht derjenige derer, die für ihr Überleben hart arbeiteten.
„Auch, wenn unsere Arme nicht so weit reichen, wie die eurigen, so werden unsere Waffen euch dennoch hart zusetzen“, meinte der Zwerg grimmig.
„Aus dir spricht der Zorn, mein Freund. Aber bedenke, dass nicht alle Menschen diesen Krieg wollen, nicht einmal diesen König.“
„Aber warum tötet ihr ihn dann nicht?“, versuchte sich Almar an den Gedanken zu gewöhnen einen König zu verraten.
„Alleine ist es unmöglich, und einem Aufstand würden nur wenige folgen. Zu oft wurden diese grausam niedergeschlagen. Für die Sicherheit des Reiches hieß es dann.“
„Aber im Verborgenen könntet ihr doch Verbündete suchen“, meinte Almar, der den König der Menschen am liebsten sogleich tot sehen wollte.
„Wenn man nicht weiß, wer seine Feinde sind, dann kann man sich bei seinen Freunden auch nicht sicher sein“, meinte Tibur traurig.
Der Zwerg sah zu Tibur auf und musste erkennen, dass er abermals überrascht war, über das, was er zu erkennen glaubte.
„Kann es sein, dass du nicht immer nur ein Steinmetz warst?“, fragte er mit trocken gewordenem Mund und leiser Stimme.
„Steinmetz ist mein Beruf, aber nicht immer war ein Meißel in meiner Hand.“ Der Handwerker wollte die Frage nicht recht beantworten.
Sein kleiner Freund akzeptierte dessen Entscheidung und fragte nicht weiter. Seine Gedanken aber blieben nicht stumm.