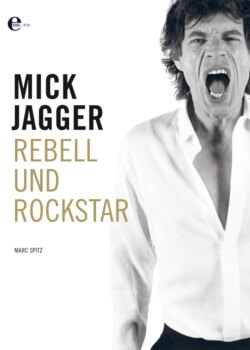Читать книгу Mick Jagger - Marc Spitz - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
DEN
BLUES
PREDIGEN KAPITEL 2
ОглавлениеNach und nach wurden die Dartforder Jungs richtige Londoner. Weil er verlässlich und umsichtig war, durfte Mick hin und wieder das Familienauto benutzen. Dann nahm er Keith, Dick Taylor, Bob Beckwith und die jeweils aktuelle Freundin mit in die City oder zu Blues-Konzerten nach Manchester. Das zufällige Wiedersehen mit Keith war ein ungemein einschneidendes Erlebnis gewesen, und in ihrer Begeisterung für R’n’B beflügelten sie sich gegenseitig. »Es war großartig, noch jemanden kennenzulernen, der diese Leidenschaft teilte«, so Dick Taylor. »Gemeinsam ist man stark.« Doch mit den modisch gekleideten, schicken Jazzern, die die Londoner Clubszene beherrschten, konnten sie nicht mithalten. Sie sahen eben aus wie typische Studenten und wirkten ein bisschen ungepflegt mit ihren pickligen Gesichtern und den ausgewaschenen Sweatshirts. Mick und Keith inspirierten sich gegenseitig, wodurch sie ein enormes Selbstvertrauen erlangten. Sie rissen einander mit, begeisterten sich für neue Ideen und schließlich war in ihnen die Einsicht greift, dass sie Dartford verlassen mussten.
Alexis Korner hatte wirklich Stil. Der Gitarrist mit den griechisch-österreichischen Wurzeln fiel auf mit seinem Spitzbärtchen, der adretten Garderobe, seiner etwas antiquierten Ausdrucksweise und seinem unermüdlichen Engagement für den Blues. Zusammen mit dem Londoner Musiker Cyril Davies tingelte er durch die Jazzlokale der britischen Hauptstadt, um so viele Menschen wie möglich für die andere bedeutende Musikrichtung aus Amerika zu begeistern. Davies spielte Mundharmonika, bis sein rundliches Gesicht dunkelrot anlief. Weil sie Ende der 50er-Jahre zusammen mit Muddy Waters bei der von ihnen selbst initiierten »Blues Night« im Roundhouse Pub aufgetreten waren, hatte sich das ungewöhnliche Duo 1961 längst als Vermittler dieser neuen Musik einen Namen gemacht.
© Huton-Deutsch Collection/Corbis
Mick und Keith öffnen ihre allererste Fanpost, 1963.
Der zentrale Treffpunkt für junge Bluesfans war damals der Ealing Club. Little Boy Blue and the Blue Boys hatten ihm bereits auf einem ihrer Ausflüge nach London und rauf in den Norden einen Besuch abgestattet. Inzwischen waren sie jedes Wochenende dort und schon bald wagten sie davon zu träumen, einmal selbst auf der kleinen Bühne aufzutreten. Jeden Samstag sahen sie dort Korner und Davies mit ihrer Band Blues Incorporated. Mick, der selbst gerne Mundharmonika spielen wollte, konzentrierte sich von seinem Platz im stickigen Zuschauerraum aus oft ausschließlich auf Davies. »Da waren all diese Musikfreaks, die irgendeine Anlaufstelle brauchten, ein ganzer Haufen Anoraks«, erinnerte er sich. »Das Publikum bestand in der Hauptsache aus Typen – die meisten davon waren ziemlich grässlich. Mädchen musstest du mit der Lupe suchen.«
Keiner dieser jungen Briten durfte hoffen, auch nur entfernt an Muddy Waters heranzureichen, dennoch gab sich der aus Cheltenham stammende Elmo Lewis alias Brian Jones die größte Mühe. Kurz nachdem Mick und Keith regelmäßig im baufälligen und schlecht belüfteten Ealing Club verkehrten, lernten sie Jones und dessen Freund Ian Stewart kennen – so konservativ wie Letzterer gekleidet war, wirkte der damals gerade 25-Jährige viel älter als er war. Genau wie Mick und Keith war auch Brian als Teenager zum leidenschaftlichen Bluesfan geworden. Aber während Mick in Dartford noch Liegestütze machte und Keith am Art College vor sich hindümpelte, war Jones – anders als es sein flachsblondes Haar, sein bleicher Teint und seine engelsgleichen Gesichtszüge vermuten ließen – schon als echter nachtaktiver Hoochie Coochie Man unterwegs, der überdies bereits Vater von drei unehelichen Kindern war. Im Ealing Club, wo sein musikalisches Talent gewürdigt wurde, war er mittlerweile eine feste Größe. Regelmäßig stand der Gitarrist mit Blues Incorporated auf der Bühne. Mick und Keith konnten davon in ihren alten Sweatshirts und Cordjacketts damals nur träumen. Hin und wieder erhielten sie die Chance, ein oder zwei Songs zu spielen, während Korner und Davies eine Pause machten, aber Jones war im Vergleich dazu ein gestandener Musiker. In den Augen der beiden war er ein Held; sie beneideten ihn um sein Talent, seine Haltung und seinen Stil und sie strebten danach, es ihm gleichzutun.
Als Mick begann, sein Hobby richtig ernst zu nehmen, lieh er sich von seinen Eltern Geld, um für Little Boy Blue besseres Equipment zu kaufen. Wo sie nun schon einmal einen Fuß in der Tür hatten, wollten sie sich auch Anerkennung verdienen. Ihnen war bewusst, dass sie sich richtig ins Zeug legen mussten, um von den echten Fans ernstgenommen zu werden. 1962 bestand die Szene aus gerade einmal zweihundert Mann, aber diese zweihundert waren sehr wählerisch, und so kam es, dass sich Mick bald ebenso gründlich mit Little Walter und Sonny Boy Williamson auseinandersetzte wie mit Marx, Engels und Keynes.
»Die Stones und ihresgleichen wähnten sich auf einer Mission«, schreibt George Melly in seinem Buch Revolt Into Style. »Sie wollten den Blues predigen und sie wollten ihn leben. Doch worum ging es beim Blues überhaupt?« Genau das war die Frage, die sie Abend für Abend bei Bier und Fish and Chips diskutierten. Diese leicht zu beeindruckenden jungen Mods, die nichts besaßen außer ihren Instrumenten, ein paar Importplatten, ein bisschen Bargeld und einem vor allem in sexueller Hinsicht allmählich größer werdenden Erfahrungsschatz, analysierten die Form, die Mode und die politischen Aspekte des Großstadt- und Südstaaten-Blues, ohne fremden fachlichen Beistand – allein ihre rigorosen Normvorstellungen hielten die Gespräche in Gang. »Wir nahmen das ernst, sehr ernst«, sagte Jagger. »Wenn wir diskutierten, waren wir wie Studenten, die leidenschaftlich Argumente austauschen und ihren Standpunkt vertreten.«
Doch schon in dieser Anfangsphase zeigte sich, dass die strengen Regeln eher theoretisch als praktisch relevant waren, da bereits vieles miteinander vermischt wurde. Trotz ihres neu erlangten Selbstvertrauens wagten es Mick und Keith nicht, ihre durchaus toleranten Ansichten zu offenbaren. Denn von Bluespuristen wie Ian Stewart oder Brian Jones wurde Rock’n’Roll nicht ernst genommen. Diese Kreise, die der reinen Lehre anhingen, konnten mit Rock’n’Roll nichts anfangen, sie empfanden ihn als Zumutung. Mick und Keith jedoch mochten beides. Und genau das machte sie insgeheim überlegen und verhalf den Rolling Stones letzten Endes, als die Rockmusik durchstartete, bis ganz nach oben zu kommen.
Micks Stimme klingt nie so natürlich soulig oder »schwarz« wie etwa die von Steve Winwood, der aus Birmingham stammt. Während Winwood sagenhaft authentisch klingt, hört man Mick immer an, wie er sich anstrengt, was seine Phrasierung allerdings ungemein interessant macht. In Anbetracht seines Talents, andere nachzuahmen, wäre es für Mick leicht gewesen, sich diesen geschmeidigen Minstrel-Show-Bariton anzueignen, der an schwarze Südstaaten-Farmer erinnert. Es gibt da einen Moment in dem Konzertfilm Gimme Shelter, wo er genau das unter Beweis stellt. Er singt eine Zeile aus Fred McDowells »You Gotta Move« (das die Stones auf Sticky Fingers coverten) so: »Yo got teemove.« Bei den Studioaufnahmen hört man so etwas nur sehr selten. Eine Ausnahme bildet die Coverversion des Willie-Dixon-Songs »I Want to Be Loved«, das als B-Seite der ersten Stones-Single herauskam; hier singt Mick zum Beispiel »wants« statt »want«. Doch die meiste Zeit über war Mick auf der Suche nach einer Synthese aus dem archetypischen Soulman, dem urbanen Bluessänger, den Hipstern, die sie bewunderten, und dem britischen Äquivalent zu alledem – dem einheimischen Cockney. Wie Frank Sinatra oder Billie Holiday hat Mick ein perfektes Rhythmusgefühl. Er ahnt, in welche Richtung die Band steuert, und zieht in seinem eigenen Tempo mit, ohne dabei jemals aus dem Takt zu kommen. Weniger talentierte Sänger als er müssten jedes Wort in Windeseile förmlich ausspucken, wollten sie es ihm gleichtun. Mick hingegen artikuliert deutlich jeden einzelnen Konsonanten. Er lässt ein gezischtes »Yes« wie ein »Yeah« klingen. Sein Gesang strahlt eine große Gelassenheit aus und wirkt selbst dann noch beeindruckend ruhig, wenn der Text eigentlich Wut oder Frust heraufbeschwört. Natürlich drückt das auch eine gewisse Ironie aus. Wer weiß, welche Einflüsse sich sonst noch in seiner Art zu singen niederschlugen. Er suchte überall nach Inspiration. »Er ist ein Schwamm«, schrieb Keith viele Jahre später in seiner Autobiografie. Das ist ein recht zweifelhaftes Kompliment eines entnervten Bandkollegen, der sich an all die Male erinnert, an denen Mick nach einem Diskoabend noch bei ihm reinschaute, weil er irgendeinen neuen Stil aufgesogen und eine Idee für einen Stones-Song hatte. Der ältere Keith winkte in solchen Momenten ab, doch der Teenager wird von Micks Talent, absolut alles in sich aufzunehmen, um es in veredelter Form zu einem Teil des eigenen Stils zu machen, durchaus profitiert haben. Jenseits der Dartforder Schulhöfe und Wohnsiedlungen konnte sich Mick neu erfinden. Jeden Tag lernte er neue Leute kennen – junge Männer und Frauen, Studenten an der LSE –, und in deren Augen konnte er so sein, wie er sein wollte. Manchmal sprach er mit einem harten Cockney-Akzent, den er meisterhaft beherrschte und der wunderbar auf seinen Gesang abfärbte. So könnte er auf Songs wie »Little Red Rooster«, »King Bee« und »Mona« nicht britischer klingen, obschon hier auch eine echte Bluesstimme mitschwingt. Bei der Frage nach der Authentizität geht es letztlich darum, ob man überzeugen kann, wenn man sich auf die Bühne stellt und verkündet: »Das bin ich.« Und dieses »ich« war ein Sammelsurium, eine Mixtur, manchmal ein Kuddelmuddel, gelegentlich auch eine Offenbarung.
Hinsichtlich seines Äußeren kultivierte Mick bald einen etwas verwegeneren Look, eine Art urbanen, studentischen Boheme-Stil, auf den gewiss auch die bewusste Selbstdarstellung der beiden Kunststudenten Keith und Dick nicht ohne Einfluss war. Er hörte auf, sich regelmäßig zu baden, ließ sich die Haare wachsen, fing an zu rauchen – vielleicht in der Hoffnung, dadurch eine etwas tiefere Stimme zu bekommen – und hing, wenn er nicht an der Uni war, in abgetragenen Pullovern, engen Jeans und Stiefeln in Soho herum. Um ernst genommen zu werden, musste man den Anschein erwecken, allzeit über tiefsinnige Fragen zu grübeln, doch insgeheim war Mick immer noch ein ungemein witziger Kerl, der auch mit seinen lustigen Parodien für reichlich Spaß sorgte.
Als sich die Möglichkeit ergab, zusammen mit Brian am Edith Grove 102 in ein kleines möbliertes Apartment mit fließend kaltem Wasser zu ziehen, nahm zunächst Mick und später auch Keith die Gelegenheit wahr. Die LSE konnte Mick, der sich gerade auf die Abschlussprüfungen seines ersten Studienjahres vorbereitete, von der Wohnung aus zu Fuß erreichen. Während die winzige Unterkunft allerdings kaum genug Ruhe zum ungestörten Lernen bot, wurde sie bald zu einer Art Ideenschmiede. Jones brachte einen Plattenspieler und ein Radio mit in die WG, und zusammen mit einem weiteren Mitbewohner – ein dürrer Revoluzzer und Bluesfan namens James Phelge – diskutierten und tranken die drei Musiker, bis sie auf einer der Matratzen zusammensackten, die sie auf dem Boden ausgebreitet hatten. Keith zufolge gab es dabei »keine festgelegte Ordnung«. Es war eine Kommune. Zum Zeitpunkt ihres Einzugs im Winter 1962 litt England unter der heftigsten Kältewelle seit zwei Jahrzehnten, und so rückten die zukünftigen Stones oft eng zusammen, um einander zu wärmen. Ein gekochtes Ei oder eine Flasche Cola gab es nur selten; in der Regel ernährte sich die frühe Stones-WG von Kartoffeln. Sie entwickelte sogar einen eigenen Slang. Wenn irgendwas annehmbar war, nannten sie es »Guvnor«, etwas das spießig war, hieß »Ernie«. Es war ein ideales Umfeld für einen jungen, aufstrebenden Künstler, doch Mick musste ständig zwischen der Welt der »Guvnors« und jener der »Ernies« hin und her pendeln. Dafür kam er aber auch raus. Keith und Brian schienen die WG praktisch nie zu verlassen. Mick verbrachte regelmäßig mehrere Stunden auf dem LSE-Campus und fuhr häufig nach Dartford, um eine warme Mahlzeit zu bekommen und saubere Wäsche abzuholen.
Brian Jones versank letzten Endes zwar in einem fortwährenden Rauschzustand, der ihn zum Schluss völlig apathisch werden ließ, doch im Alter von einundzwanzig Jahren war er der Ambitionierteste der späteren Stones. Er war fest entschlossen, eine eigene Band zu gründen und alle Jazz- und Rockfans der Welt in leidenschaftliche Bluesliebhaber zu verwandeln. Zusammen mit Mick und Keith, Dick Taylor am Bass, Ian Stewart am Klavier und wechselnden Drummern – darunter Tony Chapman und der spätere Kinks-Schlagzeuger Mick Avory – probte er wann immer möglich im nahegelegenen Bricklayers Pub. Mit knurrenden Mägen hofften sie alle auf eine Chance, um aus den Erfahrungen, die sie in zweihundert Stunden gemeinsamen Frierens um einen Plattenspieler herum gesammelt hatten, endlich etwas machen zu können. »Brauchen wir Bläser? Brauchen wir Backgroundsänger? Könnten es auch schwarze Backgroundsänger sein? Wie hat er das bloß gemacht? Komm her, ich zeig’s dir. Ja, genau das ist es.« Nebenbei verkehrte Mick die ganze Zeit über auch mit zukünftigen Nobelpreisträgern, anarchistischen Autoren und Parlamentsmitgliedern.
© Philip Townsend/Retna
Die Anti-Beatles vor einem Pub, 1963.
Jeden Montagmorgen nach einem langen Clubwochenende machte sich Mick auf zu seinen Vorlesungen, und wenn er zurückkam, fand er Keith, Brian und Jimmy Phelge genauso vor, wie er sie verlassen hatte: bei der Analyse der Blues- und Popsongs, die sie gerade hörten – und das taten sie mit demselben Eifer, den Mick kurz zuvor noch bei seinen Kommilitonen beobachtet hatte. »Wir schmissen ein paar Singles auf den Plattenteller, legten uns daneben und kommentierten, was wir hörten. Es waren immer wieder dieselben Songs, darunter ›Donna‹ von Ritchie Valens, Jerry Lee Lewis’ ›Ballad of Billy Joe‹, Ketty Lesters ›Love Letters‹, Arthur Alexanders ›You Better Move On‹ und Jimmy Reeds ›Goin’ by the River‹«, schreibt Phelge in seiner Autobiografie Nankering with the Stones. »An manchen Tagen kehrte Mick nicht vor Mitternacht in die Wohnung zurück. Wenn er dann reinkam, fiel er sofort ins Bett; den Abend hatte er wahrscheinlich mit ein paar Kommilitonen von der LSE verbracht. An anderen Tagen kam er überhaupt nicht wieder, ich vermute, dass er dann seine Familie in Dartfort besuchte«, so Phelge. Joe, Eva und Chris blieben die unappetitlichen Details über das Leben am Edith Grove erspart. In gewisser Weise wurde die Welt der »Ernies« für Mick zum Rettungsanker, der ihm jene Distanz verschaffte, die ihm half, die dunklen Jahre der Stones unbeschadet zu überstehen. Mit der Zeit gelang es ihm mit beeindruckender Leichtigkeit, bei Bedarf in einem bestimmten Umfeld voll und ganz aufzugehen, sich aber, falls nötig, ebenso leicht wieder daraus zurückzuziehen. Den anderen, insbesondere Brian und Keith, die in dieser Hinsicht weniger Talent und Interesse zeigten, sollten ihre Angewohnheiten zum Verhängnis werden.
Neben ihren samstäglichen Auftritten im Ealing Club, spielten Korner und Davies bald auch donnerstags abends im Marquee, einem weiteren Treffpunkt der Jazzszene in Soho, der sich in den 60ern zu einem Sprungbrett für Beatmusiker entwickelte. Mit diesem festen Donnerstagstermin kollidierte eines Tages das Angebot an Blues Incorporated, in einer Folge der BBC-Sendung Jazz Club aufzutreten. Aus Angst, den Besitzer des Clubs zu verärgern und das Engagement zu verlieren, bat Korner Brian Jones, zusammen mit seiner Band ersatzweise für ihn und Davies einzuspringen. Zu diesem Anlass musste für die gerade noch im Entstehen begriffene Formation umgehend ein Name gefunden werden. Brian schlug The Rollin’ Stones vor – in Anlehnung an den gleichnamigen Song von Muddy Waters. Doch nicht nur die Namensgebung musste rasch erfolgen – schnelle Entscheidungen waren damals an der Tagesordnung.
The Rollin’ Stones – bestehend aus Mick, Keith, Brian, Ian Stewart, Dick Taylor und Mick Avory – standen am Abend des 12. Juli 1962 im Marquee zum ersten Mal auf der Bühne. Und von da an spielten sie munter weiter, ob gut bezahlt oder freiwillig auf eine Gage verzichtend, vor leeren Clubs oder vollen Häusern. Einen Samstagabendgig konnte Mick mit seinem Studium noch mühelos in Einklang bringen. Doch je öfter sie auftraten, desto empfänglicher wurde das Publikum für die Energie und das Flair, das die Bewohner der Edith-Grove-Kommune verbreiteten. Sie verkörperten den Inbegriff von Männerfreundschaft und einer liberalen Einstellung zur Sexualität, etwas, das viele ansprach und sich gut verkaufen ließ. Sie hatten eine faszinierende Ausstrahlung und beherrschten die Bühnen kleiner Clubs wie das Scene und das Ricky Tick ebenso wie die Veranstaltungsräume von Pubs wie das Red Lion. Die Band wurde immer sicherer, und während sie die Songs von anderen Musikern wieder und wieder spielten, wurden sie allmählich zu ihren eigenen.
Immer öfter sprach man über die Band, bis sie eines Tages von Giorgio Gomelsky, einem Bluesfan aus Georgia, für einen Bluesabend im Station Hotel in Richmond (das Gomelsky Crawdaddy Club nannte) engagiert wurden. Und genau hier mauserten sich die Stones – die sich inzwischen nicht mehr »Rollin’« sondern »Rolling Stones« nannten – zu einer besonderen Attraktion für eine immer größer werdende Gruppe aufstrebender, junger Londoner. Eine eigene Spielstätte wie diese war der Schlüssel; wie in ihrer Wohngemeinschaft am Edith Grove konnten sie hier ausgiebig ihre Musik analysieren, am Programm feilen und das Konzept ihrer Bühnenshow perfektionieren. »Eines Abends, als sich die Band so richtig verausgabt hatte, gab ich meinem Assistenten Hamish Grimes ein Zeichen«, erinnert sich Gomelsky. »Er sollte auf einen Tisch steigen, wo ihn jeder sehen konnte, und die Arme über dem Kopf schwenken. Innerhalb weniger Sekunden machte ihm die Menge das nach. Dies war möglicherweise das entscheidende Ereignis in der Entwicklung der Band, die gerade ihre Fähigkeit ausbildete, eine Verbindung zwischen Bühne und Zuschauerraum zu schaffen, eins zu werden mit dem Publikum und etwas in Gang zu setzen, das einem Stammesritual ähnelt. Fast wie ein ›Treffen der Erweckungsbewegung im tiefen Süden‹, wie Patrick Doncaster wenige Wochen später im Daily Mirror schrieb. So etwas hatte im behäbigen und zugeknöpften London des Jahres 1963 noch niemand gesehen. Es war aufregend und zukunftsweisend. Es deutete darauf hin, dass eine einschneidende soziokulturelle Wende bevorstand.«
Im Frühjahr 1963, wenige Monate vor Micks zwanzigstem Geburtstag, waren es die Rolling Stones, und nicht Blues Incorporated, die Band ihres Mentors, die die Londoner Bluesrockszene beherrschten. Im Winter 62 hatten sie es sogar geschafft, Korners Drummer abzuwerben. Es war Ian Stewarts Beharrlichkeit zu verdanken, dass sie den lange Monate unnachgiebigen Charlie Watts, der über ein enormes Talent verfügte und eine außerordentliche Coolness ausstrahlte, letztendlich für sich gewinnen konnten. Watts spielte einen jazzigen Backbeat, während sein regloses Gesicht an das eines in Stein gemeißelten Adlers erinnerte. Ungefähr zu der Zeit, als Watts als fester Drummer bei den Stones einstieg, kam auch Bill Wyman hinzu, um Dick Taylor zu ersetzen, der wieder zur Schule ging. Wyman, der verheiratet und einige Jahre älter war als Keith, Brian, Mick und Charlie, gehörte eher zur Welt der »Ernies«. Er hatte noch seinen Militärdienst geleistet, bevor die Wehrpflicht abgeschafft worden war. Keith Altham zufolge war er »der Einzige von ihnen, der tatsächlich aus der Arbeiterklasse stammte«. Auch Bill stand auf Blues, vor allem aber besaß er einen leistungsstarken Watkins-Verstärker, von dem die Stones besonders angetan waren. Außerdem stellte sich schnell heraus, dass er und Watts musikalisch auf derselben Wellenlänge lagen und fantastisch harmonierten. Und so hatten die Stones innerhalb kürzester Zeit die heißeste Rhythmusgruppe zusammengestellt, die die Szene damals zu bieten hatte. Die beiden sorgten für ein solides Fundament und machten richtig Dampf.
»Jedem, der die Stones in Richmond sah, war sofort klar, dass das eine total coole Band war«, sagt Peter Asher heute, damals eine Hälfte des Pop-Duos Peter and Gordon und der Bruder von Paul McCartneys Freundin Jane Asher. »Jede Woche kamen mehr Leute zu ihren Auftritten. Man hatte das Gefühl, dass sich da irgendwas zusammenbraut. Brian und Mick, die damals große Konkurrenten waren, stachen besonders hervor. Brian war einfach fabelhaft. Er hatte diese große, grüne Gretsch und reizte das Vibrato voll aus.« Brian spielte zu dieser Zeit auch die meisten Mundharmonika-Soli in ihrem kurzen Set mit Coverversionen von Bluessongs, die hauptsächlich von Bo Diddley und Chuck Berry stammten. Doch Mick hatte noch einen Trumpf im Ärmel, mit dem es ihm gelang, die meiste Aufmerksamkeit auf sich zu lenken – mehr vielleicht, als er damals vertragen konnte: Um diese Zeit herum begann seine insgesamt drei Jahre währende Beziehung zu der damals achtzehnjährigen Chrissie Shrimpton, die ihn nach einem Auftritt angesprochen und forsch einen Kuss gefordert hatte.
Solche Vorfälle häuften sich zwar damals und wurden von Mal zu Mal alltäglicher, doch Shrimpton unterschied sich von den anderen Rolling-Stones-Fans. Sie kam aus einer gut situierten Familie und hatte eine berühmte Schwester.
© Globe Photos Inc.
Mick mit seiner ersten festen Freundin Chrissie Shrimpton, 1966.
Chrissie Shrimptons ältere Schwester Jean, damals besser bekannt unter dem Spitznamen »The Shrimp«, hatte als das Gesicht des neuen Londons bereits international einige Bekanntheit erlangt. Sie ging eine Zeit lang mit dem Filmstar Terence Stamp aus und war mit dem Fotografen David Bailey liiert. Jean war Baileys Muse; ihr hübsches Gesicht mit der wohlgeformten Nase, den sinnlichen Lippen, dem makellosen Kinn und den großen Augen war in Modezeitschriften und auf Werbeplakaten überall auf der Welt präsent. Chrissie war nicht mit derselben ebenmäßigen Schönheit gesegnet wie ihre Schwester. Ebenso wie Mick hatte sie volle Lippen. Ihr Pony war etwas zu lang, und ihr langes Haar bändigte sie oft mit breiten Haarbändern. Durch ihren typischen Blick, in dem nicht eine Spur Begeisterung für irgendetwas zu sehen war, wirkte sie immerzu unbeteiligt. Unter all den Fotos, die ich von ihr gesehen habe – es mögen um die hundert gewesen sein –, gab es nur eines, auf dem sie lächelte. Chrissie war enorm reizbar und genoss es, sich mit Mick oder jedem anderen, über den sie sich aufregte, zu streiten. Nichtsdestotrotz: Sie war eine Shrimpton, und gegen Ende des Jahres 1963 bedeutete eine Beziehung mit ihr soviel wie in die höchsten Pop-Kreise einzuheiraten. Wer die neue Lieblingsband der Shrimpton-Girls war, sprach sich damals schnell herum. »Er ist großartig«, so, erinnert sich David Bailey, schwärmte Chrissie Shrimpton ihm gegenüber von Mick. »Er wird erfolgreicher sein als die Beatles.« Mick und Chrissie waren damals noch so jung, dass man ihnen kaum unterstellen kann, ihre Beziehung hätte vor allem auf beiderseitigem Kalkül basiert. Doch klar ist, dass dank ihr schließlich Mick und nicht Brian zum Star der Band avancierte. Er wurde berühmt und Chrissie Shrimpton genoss es. Als Freundin eines aufstrebenden Rock’n’Rollers hatte Chrissie gewiss das Gefühl, etwas Besonderes zu sein, gerade wenn man bedenkt, dass sie ständig mit ihrer schönen und berühmten Schwester verglichen wurde. Dennoch schien das Verhältnis zwischen Mick und Chrissie nicht sonderlich innig gewesen zu sein. Augenzeugen berichten von etlichen Streitereien, sowohl im privaten Rahmen als auch in der Öffentlichkeit. Chrissie ist zweifellos mit dem namenlosen »Girl« in vielen frühen Stones-Songs gemeint, wie beispielsweise in »Stupid Girl«. Gleichwohl war Micks Liaison mit ihr eine entscheidende Beziehung zu einer entscheidenden Zeit.
© Dezo Hoffmann/Rex USA
Mick mit frühen Jagger-Moves im Crawdaddy Club, wo die Rolling Stones ihr erstes Engagement hatten, 1963.
Eines Abends tauchten die Beatles höchstpersönlich im Crawdaddy Club auf, während die nervösen Stones mit Vollgas durch Bo Diddleys »Roadrunner« jagten. Zwar waren sie damals noch nicht die internationalen Superstars, als die wir sie heute kennen, dennoch galten die Beatles zu dieser Zeit bereits als größte neue englische Rockband, während die Stones mit ihren Auftritten gerade einmal genug Geld einnahmen, um die sechzehn Pfund aufzubringen, die sie jede Woche für ihre Wohnung am Edith Grove locker machen mussten (wo sich Chrissie übrigens selten blicken ließ). Sie durften schon einmal einen Blick auf echte Rockstars riskieren, doch sie selbst waren immer noch kleine gammelige Studenten (oder ehemalige Studenten), die wie Tiere zusammenhausten.
Es war wohl Andrew Loog Oldham, der Kontakt zu den Beatles hatte und mit gerade einmal neunzehn Jahren schon eine schillernde Figur in der Musikindustrie war, der Mick dazu brachte, den Weg als professioneller Musiker nun auch konsequent weiter zu verfolgen. Oldham war ein Überredungskünstler. »Er war ein Filou: sehr jung, sehr cool, extrem gut aussehend«, so Pete Asher. »Er war ein Macher. Keine Frage, er hat mich absolut beeindruckt. Wenn man ihn einmal in Aktion erlebt hatte, [wusste man einfach, dass es dieser Typ] zu was bringen würde.« Oldham quatschte sie nach ihrer Show am 28. April 1963 an, und innerhalb nur eines Monats nahmen die Rolling Stones in den Londoner Olympic Studios – jenem großen Studio, in dem sie bald ihre größten Klassiker einspielen sollten – ihre Debütsingle auf: eine flotte Coverversion von Chuck Berrys wenig gespieltem »Come On« und eine gemächliche Fassung des weiter oben bereits erwähnten »I Want to Be Loved«. »Alles ging sehr fix«, erinnerte sich Mick einmal. »Aber damals musste man schnell sein, weil einfach so viel passierte und man in der Flut der Ereignisse untergehen konnte.«
Oldham machte der jungen Band Mut, dennoch konnte ihnen niemand garantieren, dass sie außerhalb der Londoner Clubszene Erfolg haben würden. Brian war geradezu besessen davon, erfolgreich zu sein. Und Keith brauchte einfach die Band, um weiterzukommen. Ihm stand durchaus nicht der Sinn danach, sich für die Zeit, in der er nicht Gitarre spielte, irgendeinen Bürojob zu suchen, bei dem er das am Sidcup Art College erworbene Wissen anwenden konnte. Er hatte schon ein paar nicht eben positive Erfahrungen in verschiedenen Londoner Werbeagenturen gesammelt, war allerdings bald zu seinen Platten und seiner Gitarre in die Wohnung am Edith Grove zurückgekehrt. Er fand es dort wesentlich angenehmer, als sich in irgendeinem Büro über die Wünsche irgendwelcher Kunden den Kopf zerbrechen zu müssen.
Mick war von all der Aufmerksamkeit, die ihm zuteil wurde, und den Prophezeiungen, dass er bald ein großer Star sein würde, eher beunruhigt. Die Entscheidung, sein durch ein Stipendium voll finanziertes Studium an der London School of Economics abzubrechen und damit den Plänen und Wünschen seiner Eltern nicht Folge zu leisten, muss ungeheuer schwer gewesen sein. Zwei Dinge mögen ihm die Entscheidung letztlich etwas erleichtert haben. Man muss sich zunächst bewusst machen, dass Rockstars damals noch nicht auf langjährige Karrieren zurückblicken konnten wie Schauspieler, Autoren oder bildende Künstler. Der Rock’n’Roll steckte damals noch in den Kinderschuhen und wurde von vielen als vorübergehende Mode angesehen. Wenn es allerdings eine Band gab, der man es damals zutraute, mehr als eine kurzfristige Modeerscheinung zu sein, dann waren es die Beatles. Und Oldhams Kontakt zu dieser Band war sehr gut und trug bereits Früchte. Da sie keine selbst komponierten Songs hatten, die sie als Singles hätten herausbringen können, fragten Oldham und die Stones bei John Lennon und Paul McCartney nach, ob sie irgendetwas Brauchbares für sie in petto hätten. Und tatsächlich arbeitete McCartney gerade an einer bluesigen Nummer mit dem Titel »I Wanna Be Your Man«, die perfekt zu passen schien. Gerüchten zufolge sollen er und Lennon sich in eine Ecke irgendeines Nachtclubs verkrochen haben, um die Nummer fertig zu schreiben; der Band und ihrem Manager spielten sie sie anschließend in voller Länge vor. Der wohl bekannteste Kommentar zu dieser Nummer (abgegeben von Mick höchstpersönlich in der Beatles-TV-Parodie The Rutles: All You Need is Cash von 1978, über die wir später noch mehr erfahren werden) lässt vermuten, dass es sich, gemessen am allgemeinen Niveau der Beatles, um Ausschussware handelte (gesungen wird die Version, die die Beatles später selbst einspielten, bezeichnenderweise von Ringo Starr). Dieser Song war für die Stones, die wie die meisten anderen Gruppen damals eine reine Coverband waren, dennoch mehr als gut genug. »I Wanna Be Your Man« ist in der Tat eine eher mittelmäßige Nummer, doch ihre wilde Interpretation verschaffte den Stones im November 63 ihren ersten Top-Ten-Hit. Und so taten Mick und Keith im Herbst desselben Jahres mit einem von Oldham arrangierten Dreijahresvertrag mit Decca Records in der Tasche und ihrer ersten erfolgreichen Single in den Geschäften einen weiteren Schritt in eine glorreiche Zukunft. Außerdem zogen sie von dem Schmuddelapartment am Edith Grove in eine ansprechendere Unterkunft in West Hampstead, während sich Brian Jones bei der Familie seiner damaligen Freundin Linda Lawrence einquartierte. Und am 22. Oktober 1963, nach fast zwei Jahren ernsthaften Studiums, erklärte Mick seinen Dozenten und seinen Eltern, dass er sein Studium zugunsten der sich selten bietenden Gelegenheit, Musiker zu werden, an den Nagel hängen würde. Seine Professoren an der LSE boten ihm an, sich im kommenden Jahr erneut einzuschreiben, falls er dies wünschen sollte. Dies erleichterte Mick die Entscheidung sehr, denn ihm war klar, dass er auf jeden Fall zurückkehren würde, falls sein Rock’n’Roll-Experiment fehlschlagen sollte.
Joe und Eva Jagger reagierten weitaus weniger verständnisvoll auf die Entscheidung ihres Sohnes. »Es war sehr, sehr schwierig«, erklärte Mick Jahre später, »denn es war klar, dass meine Eltern nicht wollten, dass ich das tat. Mein Vater war wütend, extrem wütend.« Seine Eltern waren sehr besorgt und stritten mit ihm, doch die Zeiten, in denen Mick bequem zwischen den Stühlen der »Guvnors« und der »Ernies« sitzen konnte, waren zweifellos vorbei. Mick musste sich für eine Seite entscheiden und er setzte alles, was er hatte, auf sein eigenes Talent und das seiner Blueskumpels.
»Nehmen wir einmal an, es hätte nicht geklappt«, sagte Brian Jones später. »Wir hätten alles in unserer Macht stehende getan, das Beste aus unseren Fähigkeiten zu machen, und wir hätten später – wenn wir alle irgendeinem Bürojob nachgegangen wären, eine Familie und ein nettes Häuschen in der Vorstadt gehabt hätten – nichts bedauern müssen. Aber wenn wir es gar nicht erst versucht hätten, hätten wir uns womöglich bis ans Ende unserer Tage in den Arsch getreten, denn wir hätten nie gewusst, wie gut wir hätten sein können. Und uns war einfach klar, dass ein Leben, in dem man ständig reuevoll zurückblickt auf das, was hätte sein können, nichts für uns war.«