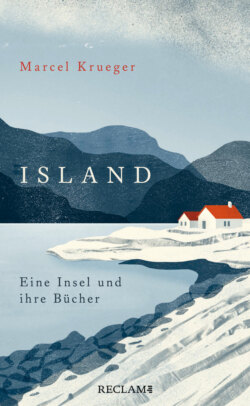Читать книгу Island - Marcel Krueger - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Landnahme
ОглавлениеWieder liegt ein Boot vor der Küste Islands. Doch diesmal ist es kein Curragh mit Lederrumpf, sondern ein Drachenboot aus Holz. Der Drachenkopf jedoch fehlt, und stattdessen hängt ein Schild am Mast, das Zeichen für eine friedliche Fahrt. Vier Männer, gekleidet in rau gesponnene Wolle und Fell, stehen an der Reling, jeweils zwei halten einen fein geschnitzten Holzpfeiler über das Wasser. Hinter ihnen sitzen weitere Männer und Frauen auf ihren Seekisten an den Rudern und schauen auf den in feinere Stoffe gekleideten Mann am Steuer, eine große Gestalt mit vielen Goldringen an den Armen. Er wiederum blickt auf die Frau im grünen Kleid neben sich. Sie betrachtet die nahe Insel, den Dampf, der aus den Felsen in der Bucht aufsteigt und nickt. Der Mann dreht sich zu den vier Männern an der Reling und hebt die Hand. Die beiden Holzsäulen gleiten rumpelnd über Bord, doch es bleibt still auf dem Drachenboot, als die Hölzer langsam mit der Brandung auf die Insel zutreiben.
Auch bei der Besiedlung Islands durch die Nordmänner und -frauen spielen Bücher eine bedeutende Rolle. Zwei sind besonders wichtig: das Íslendigabók (Buch der Isländer) und das Landnámabók (Buch der Landnahme). Beide stammen wahrscheinlich vom ersten Historiker der Insel. Für die Isländer sind sie identitätsstiftend: Hier finden sich die Namen und Genealogien der Oberschichtfamilien, die von Norwegen aus die Insel besiedelten und deren Nachkommen bis heute auf der Insel leben.
Islands erster Historiker Ari Þorgilsson inn fróði wurde in eine adelige Familie auf der Snæfellsnes-Halbinsel geboren, als Urenkel von Guðrún Ósvífsdóttir (10./11. Jahrhundert), der Heldin der Laxdœla-Saga (s. Kap. 4). Im Alter von sieben Jahren kam er nach Haukadalur im Südwesten der Insel zu dem Skalden Hallr Þórarinsson, bei dem er eine geistliche Ausbildung erhielt. Von dort zog er später nach Staður auf die Südseite der Snæfellsnes-Halbinsel, wo er zum Priester geweiht wurde und für den Rest seines Lebens seine akribischen Forschungen betrieb. Mit seinen Werken hat er wesentlich dazu beigetragen, dass die isländische Frühgeschichte der Nachwelt überliefert werden konnte. Er inspirierte auch viele nachfolgende isländische Autoren wie den Universalgelehrten Snorri Sturluson (s. Kap. 3), der an sein Wirken anknüpfte und seine Geschichte der norwegischen Könige Heimskringla (Weltkreis)Ari widmete.
Das Íslendigabók ist die älteste schriftliche Quelle erzählender Prosa in ganz Skandinavien und wurde 1125 von Ari auf Isländisch geschrieben. Das Buch erzählt die Geschichte Islands von der Landnahme durch norwegische Siedler von 874 bis 1118, mit einem Schwerpunkt auf der Entwicklung der Kirche und des Althings (Alþingi), Parlament und gesetzgebende Versammlung der Ortsvorsteher oder Goden (goði). Die Originalfassung von Aris Buch existiert nicht mehr: Die älteste erhaltene Version des Textes wurde von dem Priester Jón Erlendsson für den Bischof von Skálholt im 17. Jahrhundert erstellt und aus einem angeblich von Ari selbst revidierten Manuskript aus dem 12. Jahrhundert kopiert, das allerdings bald darauf verloren ging.
Heute ist das Íslendingabók übrigens auch der Name einer modernen DNA-Datenbank der isländischen Firma deCODE genetics, die mit Hilfe des originalen Íslendingabók, Kirchenregistern und anderen Quellen versucht, ein genealogisches Verzeichnis aller Isländer zu erstellen, die jemals gelebt haben. Die Íslendinga-App ist eine Dating-App, in der Isländer bei einem Date ihre Stammbäume miteinander vergleichen können, um sicherzustellen, nicht versehentlich mit einem Cousin oder einer Cousine anzubandeln.
Ein Kommentar im Landnámabók deutet darauf hin, dass Ari möglicherweise auch bei der Zusammenstellung dieses Werks mitgewirkt hat, zusammen mit dem Gelehrten Kolskeggur Ásbjarnarson. Das Landnámabók wurde im 11. Jahrhundert verfasst und listet 400 skandinavische Siedler auf, die sich auf Island zwischen 870 und 930 niederließen. Der Hauptteil des Buchs ist eine Genealogie der Siedler aus Norwegen sowie eine geografische Gliederung ihrer Ländereien. So werden die territorialen Grenzen der jeweiligen Siedlungen verzeichnet, Kurzbiografien der ansässigen Siedler dargeboten und deren Nachkommen bis ins 11. Jahrhundert aufgeführt. Auch die Originalversion des Landnámabók blieb nicht erhalten. Die älteste Version ist das Sturlubók (Buch des Sturla) des Schriftstellers und Skalden Sturla Þórðarson (1214–1284), entstanden vermutlich zwischen 1275 und 1280.
Die Wikinger – Eine Begriffserklärung
Als Wikinger gelten heute Teile der nordischen Völker des Nord- und Ostseeraumes aus der Gegend des heutigen Dänemark und Norwegens, die während der sogenannten Wikingerzeit (um 790–1070 n. Chr.) als Siedler, Seeräuber und Plünderer in ganz Europa anzutreffen waren – von Island bis Konstantinopel. Der Begriff Wikinger bezeichnet allerdings nur einen kleinen Teil der skandinavischen Bevölkerung, und zwar diejenigen jungen Männer und Frauen, die aufbrachen, um Reichtum in Übersee zu finden und diesen, oft zum Vorteil der eigenen Siedlung, mit nach Hause brachten. Diese Fahrten waren entweder private Plünderungsunternehmen von Wikingern eines Ortes, oder aber man schloss sich zu organisierten Verbänden und Heeren zusammen, um mehr Ertrag zu erzielen. Aber die Fahrten waren nicht immer notwendig mit Raub verbunden, sondern Wikinger dienten dabei auch als Vorauskommandos ungeplanter Siedlungsbewegungen. Nachdem sie erfolgreich auf Beutezug gegangen waren, brachten sie bei der nächsten Fahrt häufig die ganze Familie mit und blieben einfach vor Ort. In fruchtbareren Regionen, in denen sie durch ihre überlegenen Militärtechnologien wie dem Drachenboot leicht die lokalen Herrscher besiegen und Tribut von ihnen fordern konnten, ließen sie sich dauerhaft nieder. Zum Beispiel in Irland, wo sie die Städte Dublin und Waterford gründeten, auf den Färöer-Inseln oder im Nordosten Englands, wo das Danelag genannte Siedlungsgebiet für 50 Jahre komplett unter ihrer Kontrolle stand – dort benannten sie die Stadt Eoforwic in Jórvík um, einen Namen, den die Stadt bis heute behalten hat: York.
Wikinger ist also keine ethnische Bezeichnung, was auch bedeutet, dass im Zuge der Landnahme Island nicht ausschließlich von Wikingern besiedelt wurde. Und auch nach der Besiedlung gingen junge Männer und Frauen von hier aus auf víking, zum Beispiel die Saga-Helden Egill Skallagrímsson und Grettir der Starke (s. Kap. 4).
Aber ob nun Wikinger oder nicht, das Landnámabók und das Íslendigabók zeichnen ein deutliches Bild von der Besiedlung Islands und den Protagonisten, die bis heute ihr Unwesen in der Literatur und der Popkultur treiben. Einer der ersten Entdecker Islands war Mitte des 9. Jahrhunderts ein Mann namens Naddoddur. Als Flüchtling hatte er auf den Färöer-Inseln eine neue Heimat gefunden und kam eher aus Zufall als durch eine gezielte Entdeckungsfahrt nach Island. Er verirrte sich auf dem Weg von Festlandskandinavien zu den Färöern um etwa 860 n. Chr. in einem Unwetter und landete im heutigen Reyðarfjörður in Ostisland. Naddoddur und seine Mannschaft landeten an, bestiegen einen Berg und hielten nach Menschen Ausschau, doch das Gebiet schien unbewohnt. Als sie wieder in See stachen, um zu den Färöern zu gelangen, begann es heftig zu schneien. Also taufte Naddoddur das Land Snæland, Schneeland.
Einige Zeit danach kam der aus Schweden stammende Garðarr Svavarsson auf ähnliche Weise zur fremden Insel am Rande des Nordmeeres. Ein großer Sturm im Pentland Firth, der Meerenge zwischen dem schottischen Festland und den Orkney-Inseln, drückte sein Schiff nach Norden, bis er die östliche Küste Islands erreichte. Um sich besser zu orientieren, segelte er weiter und stellte fest, dass es sich um eine große Insel handelte. Dieser erste Umrundungsversuch kostete so viel Zeit, dass er überwintern musste. Den Ort seines Winterlagers in Nordisland nannte er Húsavík, Hausbucht, einen Namen, den die Gegend bis heute trägt, und benannte die ganze Insel weltmännisch einfach nach sich selbst, »Garðarsholmur«. Während des Winterlagers entliefen ein Mitglied seiner Schiffsbesatzung namens Náttfari und zwei namentlich nicht bekannte Sklaven und siedelten nach der Abfahrt von Garðarr in einem Tal in der Nähe des Winterlagers. Doch weil diese Siedlung zufällig entstand oder weil Náttfari nicht adelig genug war, wurde er von Ari und den anderen Chronisten nicht als der offizielle erste Siedler angesehen.
Diese Ehre gebührte dem nächsten Ankömmling, dem norwegischen Wikinger Flóki Vilgerðarson, der aus Thule endgültig Island machte. Er ist auch bekannt als Hrafna-Flóki, Raben-Flóki, aufgrund der Tatsache, dass er, entweder als Anhänger Odins oder weil Tauben gerade Mangelware waren, Raben auf seinem Boot mit sich führte und diese in regelmäßigen Abständen fliegen ließ. Wenn sie nicht zum Boot zurückkehrten, wusste er, dass Land nahe war. Hrafna-Flóki und seine Familie ließen sich für einen Winter in Barðaströnd in den südlichen Westfjorden nieder, aber sein Unternehmen stand unter keinem guten Stern: Seine Tochter ertrank auf dem Weg, und in einem katastrophalen Winter verhungerten die mitgebrachten Schafe aus Heumangel. Im Frühjahr erklomm Flóki dann einen Berg nahe seinem Hof, sah von dort einen mit Eis überzogenen Fjord und gab dem Land seinen heutigen Namen: Ísland. Flóki kehrte mit seinen Leuten wieder nach Norwegen zurück, segelte aber ein paar Jahre später wieder nach Island und ließ sich dauerhaft nieder.
Raben-Flóki ist übrigens auch die Inspiration für die Figur des Bootsbauers und Odin-Priesters Flóki in der Fernsehserie Vikings, die der kanadische Fernsehsender History Television produziert. Genau wie sein Namensgeber führt dieser in der Serie eine Reihe von Siedlern nach Island, die sich hier aber sehr schnell im Stil der isländischen Sagas in Familienfehden gegenseitig abschlachten. Der historische Flóki scheint also ein besseres Händchen bei der Auswahl seiner Mitreisenden gehabt zu haben.
Die ersten ständigen Siedler nach Flóki waren der norwegische Häuptling Ingólfur Arnarson (849–910) und seine Frau Hallveig Fróðadóttir, die um 870 vor Island eintrafen. So ist im Íslendigabók zu lesen:
Ingolf hieß er, ein Norweger, von dem in glaubhafter Weise gesagt wird, dass er zum ersten Male von Norwegen nach Island schiffte […], aber zum zweiten Male einige Winter später; er siedelte im Süden der Insel in Reykjavík; Ingolfshöfdi, ostwärts von Minthakseyre, heißt der Ort, wo er zuerst ans Land kam, aber Ingolfsfell, westwärts von der Ölflussau, das er sich nachher aneignete.
Aufgrund von Streitigkeiten um seinen Hof in Norwegen hatte Ingólfur beschlossen, mit seiner Familie auf die von Floki entdeckte Insel auszuwandern. Bei der Überfahrt brachte er bereits das Holz für seinen zukünftigen Hof mit, ebenso die sogenannten Hochsitzpfeiler seiner ehemaligen Halle in Norwegen. Vor der Küste Islands warfen Ingólfur und seine Männer diese Pfeiler nach damaligem Brauch ins Wasser, um an der Stelle, an der sie an Land gespült wurden, einen neuen Hof zu errichten. Zunächst überwinterte Ingólfur aber mit seinen Leuten auf einer kleinen Insel im Südosten Islands, die bis heute den Namen Ingólfshöfði trägt.
Sein Blutsbruder Hjörleifur Hróðmarsson (845–?), der zusammen mit Ingólfur nach Island gekommen war, hatte vor der Reise eine Reihe von irischen Sklaven eingefangen. Hjörleifur siedelte an der Südküste Islands (in der Nähe des heutigen Ortes Vík), wurde aber kurz darauf von zwei seiner Sklaven erschlagen. Die Sklaven flüchteten per Boot nach Westen zu einer Inselgruppe, von Ingólfur verfolgt. Er überfiel sie aus dem Hinterhalt auf der größten der Inseln, der heutigen Insel Heimaey. Die meisten tötete er, einige wenige konnten auf die umgebenden Klippen entkommen. Die Vestmannaeyjar oder Westmännerinseln, die heute einzige bewohnte Inselgruppe Islands, ist nach diesen irischen Sklaven benannt.
Nachdem Ingólfur Rache an den Mördern genommen hatte, verließ er im Frühjahr Ingólfshöfði und kam nach einer Reise über Land zu einer Bucht mit heißen Quellen, wo er seine Hochsitzpfeiler angeschwemmt vorfand und sich aufgrund dieses guten Omens hier endgültig niederließ. Er nannte den Ort Reykjavík (›Rauchbucht‹). In der Rauchbucht wacht Ingólfur noch immer über seine Siedlung: Auf dem Hügel Arnarhóll im Stadtzentrum von Reykjavík steht eine von dem Künstler Einar Jónsson (1874–1954) geschaffene Statue Ingólfurs, die einen identischen Gegenpart in Rivedal in Norwegen hat, dem Ort, von dem er ursprünglich zu seiner Reise aufbrach.
Der Buhmann der ersten Siedler Islands (oder vielmehr der Chroniken und Sagas) ist Harald I. Schönhaar, manchmal auch Haarschön (Haraldr hinn hárfagri, 852–933), der erste König, der einen großen Teil des mittelalterlichen Norwegens unter sich vereinigte. Die Besiedlung Islands wurde, so die Saga-Autoren, hauptsächlich durch die Tyrannei und Kämpfe Haralds verursacht, der sich die anderen norwegischen Fürsten gewaltsam untertan machte. So standen die Fürsten und ihre Untertanen also vor der Wahl, entweder die Herrschaft Haralds als Lehnsherr anzunehmen oder auszuwandern. Ende des 9. Jahrhunderts gewann Harald die Oberhand und verfolgte diejenigen Norweger, die sich ihm nicht beugen wollten, bis zu den schottischen Inseln. Laut der Quellen sind viele Siedler entweder direkt aus Norwegen oder, zusammen mit hauptsächlich weiblichen Sklaven aus Irland und England, von den Britischen Inseln vor Haralds Macht nach Island geflohen. Auch im Landnámabók wird die Tyrannei Haralds I. als wichtigste Ursache der Besiedlung genannt (obwohl Ari auch zwei Siedler erwähnt, die Freunde Haralds I. waren).
Im Endeffekt war es vermutlich nicht Harald I. allein, der für die Besiedlung Islands verantwortlich war, und nicht alle Siedler waren Freiheitskämpfer auf der Flucht vor Tyrannei. Die Landnahme war ebenso Teil der Siedlungsbewegungen der Wikingerzeit, und Island wurde durch die Besiedlung ein weiterer Teil einer internationalen Kultur, die sich von Skandinavien und Norddeutschland bis ins heutige Russland und auf die Britischen Inseln erstreckte. Die Expansionsbewegungen dieser Kultur führten im 9. Jahrhundert von England, Schottland und den Färöer-Inseln aus nach Norden, sie endeten nicht in Island, sondern zogen sich weiter nach Grönland und Nordamerika. Ein weiterer Grund ist eine Bevölkerungszunahme in Skandinavien in dieser Zeit, die vermehrt dazu führte, dass Menschen sich nach ersten positiven Berichten über freies Siedlungsland in Island auf den Weg dorthin machten. Das Klima, das zu jener Zeit wahrscheinlich deutlich wärmer als in späteren Jahrhunderten war, tat sein Übriges: Die fruchtbaren Ebenen an den Küsten eigneten sich vor allem zur Viehzucht mit Schafen und Pferden, das Meer und die Flüsse waren voll von Fischen, und die Erdwärme und die Thermalquellen sorgten für fließend heißes Wasser.
Egal ob sie nun Flüchtlinge vor Harald I. Schönhaar oder nur abenteuerlustige Wikinger waren: Mit dem Jahr 874 begann also die Zeit der sogenannten Landnahme, landnám, und sie dauerte bis etwa 930 an, als die besten und fruchtbarsten Siedlungsplätze der Insel vergeben waren. Bis heute ist die genaue Zahl der Siedler in jener Zeit nicht bekannt: Wissenschaftliche Schätzungen schwanken zwischen 20 000 und 60 000 Menschen. Eine im 11. Jahrhundert durchgeführte Zählung der Goden ergab 4560 freie Bauern, die Anzahl der Familienangehörigen und Sklaven jedoch ist nicht bekannt.