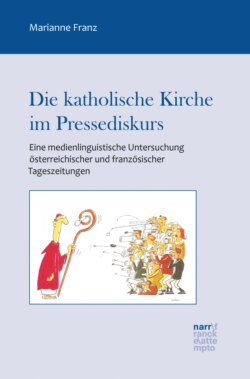Читать книгу Die katholische Kirche im Pressediskurs - Marianne Franz - Страница 46
5.1 DiskurstheorieDiskurstheorie nach Foucault
ОглавлениеUm besser nachvollziehen zu können, was bzw. welche Weltanschauung und Gesellschaftstheorie mit dem Terminus „Diskurs“ mitschwingt, ist zumindest ein kurzer Blick auf Foucaults DiskurstheorieDiskurstheorie notwendig. Foucaults Anliegen war es, das Zustandekommen gesellschaftlichen Wissens zu rekonstruieren. Er wollte „eruieren, warum und wie bestimmte Denkschemata eine Epoche prägen und die Perspektive bestimmen können, unter der die Menschen die Welt zu einem bestimmten Zeitpunkt und in einem bestimmten Raum sehen“ (Heinemann 2005: 23). Die Organisation von Gesellschaften wird nach Foucault wesentlich durch die sogenannten Diskurse geleistet, indem diese „Weltbilder, Gesellschaftsdeutungen und sozial wirksame Klassifikationen [hervorbringen]“ (Diaz-Bone 2005: 539). Was Foucault exakt unter dem Terminus „Diskurs“ versteht, hat er nie eindeutig und endgültig definiert. Heinemann (2005: 24) versucht eine solche Definition von „Diskurs“ nach Foucault zu formulieren: „Diskurse sind Bündel komplexer Beziehungen zwischen Aussagen und gesellschaftlichen Prozessen und Normen; dadurch zugleich aber auch Instrumente gesellschaftlicher Praktiken und damit der Machtausübung.“ Ein Diskurs ist also „eine Menge von Aussagen, die einem gleichen Formationssystem zugehören“ (Foucault, zitiert nach Zimmermann 2010: 37). Unter Formationssystem ist eine Art Aussagengeflecht zu einem bestimmten Themenkomplex zu verstehen; z.B. bilden verschiedenste Aussagen zum Thema „Rassismus“ (oder in der vorliegenden Arbeit zum Thema „katholische Kirche“) ein Aussagengeflecht, einen Diskurs.
Aussagen und gesellschaftliche Prozesse beeinflussen sich also gegenseitig; so reproduzieren Aussagen nicht nur, sondern bringen auch Wissen hervor. Dadurch üben sie Wirkung bzw. Macht aus – insbesondere wenn sie Handlungen nach sich ziehen (vgl. Diaz-Bone 2005: 540), denn sie bestimmen „letztlich – mehr oder minder unbewusst – das Denken der Subjekte und die ‚Ordnung der Dinge‘ (Foucault 1974)“ (Heinemann 2005: 23).
Diskurse sind jedoch nicht in der Absicht einzelner Akteure entstanden, sondern sie sind das Resultat geschichtlicher Entwicklungen und „anonyme[r] und überindividuelle[r] Prozesse“ (Diaz-Bone 2005: 540). Wichtig ist, so Heinemann (2005: 23), dass Aussagen nach Foucault nie für sich stehen, sondern in einen Aussagenkomplex, in einen Diskurs, „in ein assoziatives Feld“ eingebettet sind. „Erst von der Ganzheit des Diskurses her erhalten die Einzelaussagen ihre eigentliche Bedeutung […].“ DiskursanalysenDiskursanalyse versuchen als eine Form von Inhaltsanalysen diese Bedeutungen der Aussagen bzw. Texte von eben dieser Ganzheit des Diskurses her zu erschließen.
„DiskursanalysenDiskursanalyse versuchen zunächst Diskurse als kollektive Praxisformen und Wissensordnungen […] zu identifizieren und deren innere Organisation zu rekonstruieren. Danach wird der Fokus erweitert und nach den Wechselwirkungen zwischen Diskursen einerseits und nicht-diskursiven sozialen Vorgängen (institutionellen Prozeduren, Handlungsroutinen, Techniken) andererseits gefragt.“ (Diaz-Bone 2005: 539)
„Die“ DiskursanalyseDiskursanalyse gibt es jedoch nicht. Foucault, der selbst eher Theoretiker war, hat nie eine einheitliche Methode der Diskursanalyse erstellt; jedoch sind in der Foucaultschen Rezeptionsgeschichte, vor allem in den Sozialwissenschaften, verschiedene Arten der Diskursanalyse entworfen worden.1 Hier gehe ich aufgrund der Ausrichtung der vorliegenden Arbeit jedoch nur auf die linguistisch orientierten Diskursanalysen ein.