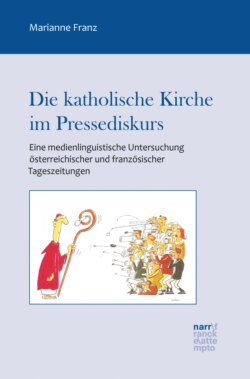Читать книгу Die katholische Kirche im Pressediskurs - Marianne Franz - Страница 48
5.3 Kritische DiskursanalyseDiskursanalyse nach Jäger
ОглавлениеObwohl Jäger Sprachwissenschaftler ist und seine in den 1990ern entworfene und seither weiterentwickelte Methode der KDA wohl als Weiterentwicklung von der Textanalyse zur DiskursanalyseDiskursanalyse gesehen werden kann, verortet er sie nicht als linguistische, sondern als inter- oder auch transdisziplinäre Methode.1 Die KDA ist für ihn „ein Projekt qualitativer Sozial- und Kulturforschung, das sich auch einer Reihe sprachwissenschaftlicher Instrumente bedient“. In ihrer Interdisziplinarität geht sie „bewusst über die Diskurslinguistik hinaus, die sich allein oder doch fast allein auf linguistische Begrifflichkeiten und Verfahren beschränken möchte“ (Jäger/Zimmermann 2010: 5). Jäger grenzt sich hier von einem Verständnis der Diskurslinguistik ab, wie sie Warnke und Spitzmüller vertreten: Die Diskurslinguistik, „sofern sie sich auf eine einzige Disziplin reduziert, verkennt in manchen Ausarbeitungen die Möglichkeiten inter- und transdisziplinärer Kooperation“ (Jäger 2010b: 43f.).
Jäger, der sich als Sprachwissenschaftler immer schon für den „Zusammenhang von Gesellschaft, Individuum und Sprache“ interessiert hat, scheint an linguistische Grenzen gestoßen zu sein, die sich die Linguistik selbst gesetzt hat, denn „zusammen mit den Inhalten wird […] im Grunde zugleich alles Gesellschaftliche aus der Linguistik vertrieben“ (Jäger 2009: 12). Er kritisiert an der Linguistik im Allgemeinen
„eine Beschränkung der Linguistik auf sich selbst, eine technokratische Verkürzung, die Linguisten daraus meinen ableiten zu müssen, daß in allen Wissenschaften und in jedem Alltag Inhalte vorkommen, für die die Linguistik, der Linguist/die Linguistin nicht kompetent seien“ (2009: 13).
Nach Jäger gilt es diese Position in der Linguistik zu überwinden. Ihm geht es „letzten Endes um die Entwicklung eines integrierten theoretischen und methodologischen kulturwissenschaftlichen Ansatzes für Gesellschaftstheorie und Gesellschaftsanalyse“ (Jäger 2009: 25). Dass seine Kritische DiskursanalyseDiskursanalyse, auch wenn er sie sozial- und kulturwissenschaftlich verortet, dennoch in stark linguistischer Tradition steht, zeigt aber z.B. auch, dass Jäger sie an anderer Stelle als „sprach- und sozialwissenschaftlichen Ansatz“ beschreibt, mit dem er die Soziolinguistik ablösen möchte (vgl. Jäger 2009: 51).
Für die Entwicklung seiner Methode hat Jäger sich einerseits von Michel Foucault, vor allem in der Rezeption durch Jürgen Link, andererseits von Alexei Nikolajewitsch Leontjews Tätigkeitstheorie inspirieren lassen. Leontjews Theorie, die „zwischen Subjekt- und Objektwelt unterscheidet“ und die Tätigkeit als vermittelnde Instanz zwischen diesen Ebenen erkennt (Jäger 2009: 111), hilft Jäger, die Verbindung zwischen Subjekt und Diskurs, zwischen Individuum und Gesellschaft zu erklären und auch ein der DiskursanalyseDiskursanalyse angemessenes Textverständnis zu entwickeln (vgl. 2009: 21f.).2 Subjekte bilden sich abhängig von soziohistorischen Bedingungen und sind Produkt menschlicher Tätigkeit; sie konstituieren sich „im und durch den Diskurs“ (2009: 21). Diskurse sind ebenfalls Produkte menschlicher Tätigkeit. Texte sind Diskursfragmente und
„[…] im Sinne der Tätigkeitstheorie Ergebnisse der Denktätigkeit von Individuen. Ihre Produktion beruht auf sozialisatorisch angeeignetem Wissen, den jeweiligen Motiven der sprachlich Handelnden und den verfügbaren Ressourcen der Versprachlichung und sprachlichen Entäußerung“ (Keller 2004: 32).
Während Texte von (in Diskurse „verstrickten“) Individuen geschaffen werden, sind Diskurse überindividuell, d.h. „von der Gesamtheit aller Individuen gemacht“ (Jäger 2009: 148). Jäger definiert sie als „Verläufe oder Flüsse von sozialen Wissensvorräten durch die Zeit“ (2009: 158), als „strukturiert“ und „geregelt“, „konventionalisiert bzw. sozial verfestigt“ (2009: 129). Das über Diskurse transportierte Wissen gilt als richtig und wahr, wobei Wahrheit nicht „diskurs-extern vorgegeben“, sondern ein „diskursiver Effekt“ ist bzw. „historisch-diskursiv erzeugt“ (2009: 129). Diskurse spiegeln „gesellschaftliche Wirklichkeit nicht einfach [wider], sondern [sie führen] gegenüber der Wirklichkeit ein ‚Eigenleben‘ […], obwohl sie Wirklichkeit prägen und gestalten, ja gesellschaftliche Wirklichkeit zuerst ermöglichen“. Anders gesagt: Diskurse sind „vollgültige Materialitäten“ (2006: 87).
„Diskurse üben Macht aus, da sie Wissen transportieren, das kollektives und individuelles Bewußtsein speist. Dieses zustande kommende Wissen ist die Grundlage für individuelles und kollektives Handeln und die Gestaltung von Wirklichkeit.“ (Jäger 2006: 89)
Die verschiedenen Diskurse eines gesellschaftlichen Gesamtdiskurses sind miteinander vernetzt und bilden ein „diskursives Gewimmel“, das die DiskursanalyseDiskursanalyse unter anderem mithilfe verschiedener Analysekategorien zu entflechten versucht (Jäger/Zimmermann 2010: 15f.):
Spezialdiskurs: Wissenschaftsdiskurs – im Gegensatz zum Interdiskurs (alle nichtwissenschaftlichen Diskurse) (vgl. Jäger 2009: 159);Diskursfragment
Diskursfragment: Text(-teil) zu einem bestimmten Thema (vgl. Jäger 2009: 159); in dieser Arbeit z.B. ein Artikel zum Thema „katholische Kirche“ oder genauer zum Thema „Afrikareise des Papstes“;
Diskursstrang:Diskursstrang gebildet aus mehreren Diskursfragmenten zum selben Thema; in dieser Arbeit werden mehrere Diskursstränge behandelt: z.B. Diskursstrang über die Aufhebung der Exkommunikation der Pius-Bruderschaft, über die Afrikareise des Papstes, über den Kindesmissbrauch durch Kirchenvertreter; Diskursstränge sind miteinander verschränkt, d.h. sie beeinflussen und stützen sich gegenseitig; das gilt für alle Diskursstränge (auch thematisch nicht verwandte) (vgl. Jäger 2009: 160f.); alle Diskursstränge einer Gesellschaft ergeben zusammen den gesamtgesellschaftlichen Diskurs (vgl. Jäger 2009: 166);
Diskursives Ereignis: Ereignisse, „die medial groß herausgestellt werden und als solche […] die Richtung und die Qualität des DiskursstrangsDiskursstrang, zu dem sie gehören, mehr oder minder stark beeinflussen“; es wird sich zeigen, ob in der vorliegenden Untersuchung diskursive EreignisseDiskursives Ereignis festzustellen sind;
Diskursebene:Diskursebene soziale Orte, von denen aus gesprochen wird, wie Wissenschaft, Politik, Medien, Alltag usw. (vgl. Jäger 2009: 163); in dieser Arbeit wird die Diskursebene der Medien, genauer: der Tageszeitungen untersucht;
Diskursposition:Diskursposition „spezifischer politischer Standort einer Person oder eines Mediums“ (vgl. Jäger 2009: 164).
Nach Jäger ist das „allgemeine Ziel der DiskursanalyseDiskursanalyse“, „ganze Diskursstränge (und/oder Verschränkungen mehrerer Diskursstränge) historisch und gegenwartsbezogen zu analysieren und zu kritisieren“. Da es aufgrund des Umfangs eines DiskursstrangsDiskursstrang und des damit verbundenen hohen Arbeitsaufwandes unmöglich ist, alle Diskursfragmente genau zu untersuchen, rät Jäger zu einer Zweigliederung der Analyse. Nach einer groberen Struktur- bzw. Überblicksanalyse eines Diskursstrangs wird eine Feinanalyse eines typischen Diskursfragments daraus vorgenommen (vgl. Jäger 2009: 192f.). Die Überblicksanalyse besteht im Wesentlichen in der (1) Ermittlung des diskursiven Kontextes, (2) in der allgemeinen Charakterisierung der Zeitung, der die Diskursfragmente entnommen sind und (3) in der Aufschlüsselung der Diskursfragmente bzw. Artikel nach Themen und TextsortenPressetextsorten sowie in der Ermittlung der DiskurspositionDiskursposition der Zeitung in Hinblick auf die jeweilige Thematik (vgl. Jäger 2009: 195f.). Für die Feinanalyse sollen typische Artikel mithilfe bestimmter Kriterien ausgewählt werden. So sollen die typischen Artikel z.B. die Diskursposition der Zeitung enthalten, dem thematischen Schwerpunkt der Zeitung hinsichtlich des betroffenen Diskursstrangs, dem Berichtstil und den formalen Besonderheiten der Darstellung entsprechen (Genaueres siehe Jäger 2009: 193). Die Feinanalyse selbst besteht aus folgenden Analyseschritten:
1. „Institutioneller Rahmen: Jedes Diskursfragment steht in einem institutionellen Kontext. Dazu gehören MediumMedium, Rubrik, Autor, eventuelle Ereignisse, denen sich das Fragment zuordnen läßt, bestimmte Anlässe für den betreffenden Artikel etc.
2. Text-‚Oberfläche‘: Graphische Gestaltung (Photos, Graphiken, Überschriften, Zwischenüberschriften), Sinneinheiten (wobei die graphischen Markierungen einen ersten Anhaltspunkt bieten [sic!], angesprochene Themen.
3. Sprachlich-rhetorische Mittel (sprachliche Mikro-Analyse: z.B. Argumentationsstrategien, Logik und Komposition, Implikate und Anspielungen, Kollektivsymbolik/Bildlichkeit, Redewendungen und Sprichwörter, Wortschatz, Stil, Akteure, Referenzbezüge etc).
Inhaltlich-ideologische Aussagen: Menschenbild, Gesellschaftsverständnis, Technikverständnis, Zukunftsvorstellung u.ä.
4. Interpretation: Nach den unter 1. bis 4. aufgeführten Vorarbeiten kann die systematische Darstellung (Analyse und Interpretation) des gewählten Diskursfragments erfolgen, wobei die verschiedenen Elemente der Materialaufbereitung aufeinander bezogen werden müssen.“ (Jäger 2009: 175; in Originalrechtschreibung)3
Auf der Basis der Struktur- und Feinanalyse wird abschließend eine Gesamtinterpretation des Diskursstranges vorgenommen (vgl. Jäger 2009: 193).
Jäger hat seine Vorgehensweise in zahlreichen Veröffentlichungen immer wieder sehr transparent, leser- und benutzerfreundlich erörtert. Wenn die gewählte Untersuchungsmethode der vorliegenden Arbeit Jägers Kritischer Diskursanalyse auch nicht 1:1 folgt, so ist sie dennoch wesentlich von ihr beeinflusst. Jägers Analyseraster wird mit einigen Anpassungen übernommen (siehe Abschnitt 13.2).
Obwohl ich mir bewusst bin, dass diese Methode aufgrund ihrer politischen Ausrichtung, aber auch aufgrund der Beachtung der Textinhalte innerhalb der Linguistik umstritten ist und Jäger sie selbst (vielleicht auch deshalb) nicht als sprachwissenschaftliche Methode im eigentlichen Sinn deklariert, hat mich vor allem ihr Analyseverfahren überzeugt. Der Aufbau der einführenden Kapitel zeigt bereits, dass auch die vorliegende Arbeit keine puristisch linguistische ist. In Abschnitt 2 war die Rede davon, dass heute die wissenschaftlichen Fachgrenzen verschwimmen, weil von den Gegenständen, von der Forschungsfrage ausgehend transdisziplinäre Methoden entwickelt werden müssen. Meine Forschungsfrage macht es notwendig, aus verschiedensten Forschungstraditionen und Wissenschaftsdisziplinen zu schöpfen, um ihr gerecht werden zu können. Nichtsdestoweniger erhebt die Arbeit den Anspruch medienlinguistisch zu sein, da der Schwerpunkt der vorgenommenen Analyse auf dem Sprachgebrauch in den Medien liegt. Ich kann daher gut mit Jäger sympathisieren, der, selbst Sprachwissenschaftler, mit seiner entwickelten Methode über die „Grenzen der Disziplin der Linguistik“ hinausgeht, indem er sie mit verschiedenen sozialwissenschaftlichen Theorien und Instrumenten verbindet (Jäger 2009: 158). Das Ziel meiner Arbeit liegt zwar nicht in einer politischen Gesellschaftskritik, die sich darin zeigt, „Vorschläge zur Vermeidung herrschender Missstände zu entwickeln“, wofür Jäger die Kritische DiskursanalyseDiskursanalyse in der Lage sieht (vgl. Jäger/Zimmermann 2010: 22). Dennoch steht sie medialen Prozessen durchaus kritisch gegenüber, was sich bereits an den Hypothesen ablesen lässt. Gardt (2007), der die Ursache der KontroverseKontroverse zwischen Kritischer Diskursanalyse und Diskurslinguistik in der Dichotomie der erklärenden und der beschreibenden Sprachwissenschaft (nach Chomsky) sieht, befürchtet, dass die linguistische Diskursanalyse „zu einer bloßen Hilfswissenschaft für andere Disziplinen“ wird, wenn die Sprache nicht der eigentliche Untersuchungsgegenstand ist. Die Lösung besteht nach Gardt im Verständnis der Diskursanalyse als Sprachkritik, da sie dadurch ihre „linguistische Identität“ wahren könne (2007: 40f.).
„Eine Aufwertung einer linguistisch fundierten Sprachkritik zu einem integralen Bestandteil der Sprachwissenschaft wird in jüngster Zeit ohnehin gefordert. Wenn Sprachwissenschaftler durch das kritische Kommentieren öffentlichen Sprachgebrauchs tatsächlich stärker in der Gesellschaft präsent sein wollen, sind damit auch jene Vertreter der DiskursanalyseDiskursanalyse angesprochen, deren Arbeiten solche gesellschafts- und ideologiekritischenIdeologie (s. a. Welt- und Wertvorstellungen) Züge tragen.“ (Gardt 2007: 41)
Auch Warnke, Meinhof und Reisigl sehen im Jahr 2012 die Diskurslinguistik stärker integrativ. „[Deskriptive] Zugänge und kritische Verfahren“ seien „als interdependent [zu verstehen]“; beide bedingen sich insofern gegenseitig, als „jede so genannte deskriptive Linguistik […] bis zu einem gewissen Grad auch explikativ und argumentativ“ ist (2012: 381). „Umgekehrt muss eine sich als kritisch verstehende Diskursanalyse an deskriptiver Präzision interessiert sein, sollen ihre Analysen als empirisch geerdete Untersuchungen ernst genommen werden“ (Reisigl 2011, zitiert nach Warnke/Meinhof/Reisigl 2012: 382).
„Die Einbettung von Sprachkritik in eine Kritische DiskursanalyseDiskursanalyse scheint [Jäger selbst] durchaus wünschenswert und auch leicht zu machen“, wie er sich in einem InterviewInterview mit Diaz-Bone äußert – obwohl er sich eine „Weiterentwicklung in Richtung Diskurskritik (und damit Gesellschaftskritik)“ wünschen würde (Diaz-Bone 2006, Absatz 53). Die Anwendung seiner Kritischen Diskursanalyse in dieser Arbeit, die sprachkritisch die Berichterstattung der Tagespresse über die Kirche beleuchtet, indem sie den Einsatz verschiedener sprachlicher Mittel in Pressetextsorten untersucht, scheint mir also durchaus legitim.