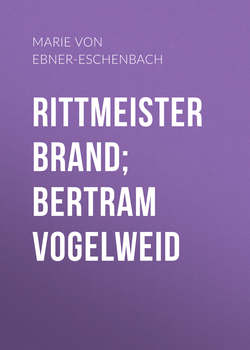Читать книгу Rittmeister Brand; Bertram Vogelweid - Marie von Ebner-Eschenbach - Страница 6
Rittmeister Brand
VI
ОглавлениеGenau am ersten Jahrestage ihrer Vermählung erschien Magdalena Peters bei Dietrich Brand und brachte ohne viel Umstände die Bitte vor, er möge, im Fall daß es ein Bub werden sollte, sich gütigst herbeilassen, ihn aus der Taufe zu heben. Die Erfüllung ihres Wunsches wurde ihr sogleich und mit großem, feierlichem Ernste zugesagt. Brand holte sofort die genaueren Erkundigungen über die Pflichten ein, die er mit der Taufpathenschaft auf sich nahm. Er gedachte sie pünktlich zu erfüllen und erhielt Gelegenheit dazu, denn es wurde ein Bub, ein niedlicher Peter junior.
Sein Vater übergoß ihn mit Thränen der Rührung, das Kindlein nieste, und Dietrich selbst, sehr bewegt durch den ihm völlig fremdartigen Anblick eines neugeborenen Menschen, führte Peter von der Wiege fort und sagte:
»Blamire Dich nicht vor Weib und Kind.«
Brands Fürsorge wuchs mit ihrem Gegenstande. Er schrieb sich Eigentumsrechte über das Knäblein zu und forderte, daß ohne Unterlaß an ihm erzogen werde.
Frau Magdalene verlor endlich die Geduld. »Dein Rittmeister«, sagte sie zu ihrem Manne, »wie der’s treibt. Bald wird Niemand mehr wissen, bin ich die Mutter, oder ist er’s!«
Peter hatte Mühe, sie mit der Versicherung zu beschwichtigen, darüber könne kein gescheidter Mensch im Zweifel sein.
Das Interesse, das der Rittmeister für den kleinen Peter gefaßt hatte, breitete sich allmählich auch auf andere Kinder aus. Man muß doch vergleichen, den Blick schärfen, Erfahrungen sammeln. Dietrich, der bisher ziemlich gleichgültig an Allem vorüber gegangen war, was nicht im Alter der Militärpflicht stand, begann nun, dem Kindervolke seine Aufmerksamkeit zu schenken. Es traf sich, daß er mit kleinen Schulbesuchern, Knaben und Mädchen, die mit ihm im selben Hause wohnten und denen er täglich auf der Treppe begegnete, einen Gruß tauschte. Zu dem Gruße kam bald eine Ansprache, und aus der entwickelten sich nach und nach förmliche Konversationen, die man nicht schon unterm Thor abbrechen wollte. Nicht selten geschah’s, daß Brand dem oder jenem jugendlichen Geschöpfe das Geleite gab bis zur Schule.
Er hatte sich zuerst an die Kinder der Armen gewendet und ihr Vertrauen, und bis zu einem gewissen Grade, das ihrer Eltern errungen. Dann schritt er an verfeinerte Gesellschaftskreise heran, machte auch da Glück und war bald wieder in seinem Elemente, konnte wieder erziehen. Er übte auch Gastfreundschaft. An jedem Samstag-Nachmittag wimmelte es von Jugend in seiner Wohnung; die verschiedensten Stände waren da durch auserlesene Exemplare vertreten. Entsprechende Kost für Kopf und Herz lieferte der Hausherr, das Ehepaar Peters sorgte für den Magen; Überladung, in irgend einer Weise, kam nicht vor. Glücklich, gesund, von frischem Eifer zur Bravheit beseelt, kehrten die Kinder heim.
Im Frühling des zweiten Jahres nach der Geburt Klein-Peters’ frühstückte Brand an jedem schönen Morgen, statt zu Hause, im Stadtpark und ging dann in den Kinderpark hinüber, wo sein Täufling im Korbwägelchen unweigerlich bis zehn Uhr zu schlafen hatte.
Dabei schenkte Brand aber auch fremden Kindern seine Aufmerksamkeit, sah ihren Spielen zu, ermunterte die Schüchternen, ging den Ungeschickten zur Hand, beschützte die Unterdrückten und hatte eine beneidenswerte Art, die Übermüthigen und Tyrannischen zurecht zu weisen. Durch eine kurze Bemerkung, einen Blick verstand er zu bändigen, ohne zu empören und zu erbittern.
Eines Tages war Dietrich vom Stadtpark auch noch in den Volksgarten gegangen. Er nahm dort Platz auf einer Bank mit der Aussicht auf das Grillparzer-Denkmal und freute sich, daß es wieder Frühling war, daß die Natur in erneuter Jugendherrlichkeit blühte und daß die Menschen ihrer pflegten, mit so viel Sorgfalt und Geschmack, wie es hier geschah in diesem kleinen irdischen Paradiese. Er freute sich auch, daß sie in all’ die Schönheit Schönes hingestellt haben, das edle Denkmal, das unsern Dichter veranschaulicht mit ergreifender Wahrheit, und die Werke seines Schöpfergeistes im beseelten Steine vor uns aufleben läßt.
Brand lächelte vor sich hin. Er gedachte der Äußerung, die eine seiner Cousinen jüngst gethan hatte: »Heirathe doch, es ist noch gerade Zeit. Du hast Kinder so gern, und eigene sind noch etwas ganz Anderes als fremde, und eine angenehme Häuslichkeit ist auch nicht zu verschmähen.«
Häuslichkeit, eigene Kinder – als ob ein Mensch ihrer bedürfe, der gewöhnt ist, sich überall häuslich einzurichten; dem alles Gute und Schöne in der Welt gehört, weil er es lieben und bewundern kann. Die glauben nur das zu besitzen, was sie an sich gerissen haben, das sind die ewig Unersättlichen und ewig Entbehrenden.
In seiner Nachbarschaft hatten sich drei fein aussehende Damen auf eine Bank niedergelassen; offenbar Gouvernanten in sehr wohlhabenden Häusern. Es waren zwei ältliche Engländerinnen, die in guter Laune und schlechtem Französisch ein eifriges Gespräch mit einer jungen – ihr tadelloser Accent verrieth’s – Pariserin führten. Ihre drei Zöglinge, nicht Kinder mehr und noch nicht Backfische, pendelten auf dem Wege zwischen ihren Bändigerinnen und Brand hin und her.
Er konnte Einiges hören von ihrer laut und ungenirt geführten Konversation:
»Du, Aurora,« sagte das muntere Ding am linken Flügel, das in Blau gekleidet, blond, frisch und ein wenig untersetzt war, zu der in der Mitte Schreitenden, »Deine Stiefeletten sind hübscher als die meinen, aber ich habe einen hübscheren Fuß.«
»Und ich habe eine hübschere Taille,« fiel das Fräulein zur Rechten ein. »Die Deine ist ja viel zu lang.« Sie prangte havannafarbig, und man konnte schwerlich eine zierlichere Gestalt sehen.
Allerdings durfte sich die zwischen den Beiden wandelnde, eckige und blasse Aurora an persönlichen Vorzügen mit ihnen nicht vergleichen. Dafür aber schlug ihre Toilette die der Freundinnen völlig. Allerersten Ranges waren der hellgraue Stoff und die Mache des Kleides, und der Hut mit seiner breiten, genial aufgestülpten Krempe und feinem Federngewoge. Wenn eine Harpye ihn aufgesetzt hätte, Jedermann würde ausgerufen haben: »O wie anmuthig sehen Sie heute aus, meine Gnädige!«
Ihre Verhandlung eifrig fortführend, hatten sich die Fräulein mitten auf dem Wege aufgepflanzt, als von der Ringstraße, in der Richtung gegen den äußeren Burgplatz, zwei ärmlich gekleidete Kinder einher kamen. Ein Knabe von etwa sieben Jahren und ein viel jüngeres Mädchen. Der Knabe, hoch aufgeschossen und schmächtig, trug an einem Riemen am Arme eine der mit Wachsleinwand überzogenen Schachteln, in denen Modehändler ihre Waare verschicken. Das kleine Mädchen im ausgewaschenen Percailkleidchen, einen blauen, gestrickten Capuchon auf dem Kopfe, ein Tüchlein um die mageren Schultern geschlungen, hüpfte neben ihm her.
Beim Anblick der aufgeputzten Fräulein blieb sie plötzlich stehen und staunte, wie angenagelt vor Entzücken, zu ihnen hinauf. Besonders hingerissen schien sie von dem grauen Federhut; zu ihm kehrte ihr leuchtender Blick immer wieder zurück.
Sie wurde bemerkt, die Modedöckchen nahmen den Zoll naiver Bewunderung, den das Kind ihnen darbrachte, spöttisch auf, und die Blaue sprach:
»Wie dumm sie ist!«
»Und wie sie nach Armuth riecht,« setzte Aurora mit der langen Taille hinzu. »Meine Mama sagt, das ist der ärgste Geruch. Böhmische Spitzen riechen manchmal so.«
Die Kleine verstand sie nicht. Seelenvergnügt blieb sie regungslos wie ein hypnotisirtes Hühnchen, bewunderte weiter und bemerkte nicht, daß sie ausgelacht und verachtet wurde.
Der Auftritt hatte außer Brand noch einen Beobachter gehabt, einen sehr jugendlichen. Ein braunes, ungemein feinknochiges Bübchen verließ eine Gruppe Spielgenossen und kam auf die Verspottete zu mit einer herzigen und komischen Gebärde. Er verschränkte die Finger so fest er konnte und streckte die gerungenen Hände einmal ums andere mit heftigem Rucke von sich. So trat er, kämpfend mit Empörung und Rührung, vor das arme Kind hin und sagte im durchdrungensten Tone:
»Wenn sie nur zu mir käm’, in mein Haus, ich würd’ ihr geben, was ich nur hab!«
Sie sah ihn eine Weile überrascht und zweifelnd an, steckte zuerst ihr Zeigefingerchen in den Mund, zog es dann heraus und deutete schüchtern auf seine hundsledernen Handschuhe: »Die gieb mir.«
Sogleich fing er an, hastig an ihnen zu zerren, brachte sie auch herunter; als er sie aber der Kleinen reichte und sie danach griff, kam ihr Bruder ihr zuvor:
»Wir dürfen nichts annehmen. Du weißt, Annerl, die Mutter will’s nicht,« sagte er sehr sanft und sehr entschieden, und es war ein merkwürdig trauriger Klang in seiner Stimme. »Wir danken Ihnen vielmals, junger Herr; komm Annerl,« er zog seine Schwester mit sich fort.
Der abgewiesene Wohlthäter sah ihnen verdutzt und bestürzt nach. Dietrich stand auf und half ihm seine Handschuhe wieder anziehen, allein wäre er damit kaum fertig geworden.
»Wie alt bist Du?« fragte Brand, als die für sie beide sehr schwierige Arbeit zu Stande gebracht war.
»Fünf Jahre.«
»Wie heißest Du?«
Der Taufname des Bübleins war Fritz, sein Familienname der eines österreichischen Grafen- und Fürstengeschlechts.
»Fritz,« sagte der Rittmeister, »Du hast einen schönen Namen, weißt Du, was das heißt? Weißt Du auch, was es heißt, seinem Namen Ehre machen?«
Der Kleine hob seine prachtvollen, von langen dunklen Wimpern beschatteten Augen zu Brand empor und erwiderte ohne Zögern: »O ja.«
Dietrich verbiß ein Lächeln: »Nun, wenn Du das jetzt schon weißt, dann salutire – das heißt,« verbesserte er sich, »dann grüße ich Dich.«
Er lüftete den Hut, und der Kleine riß den seinen förmlich herunter, holte weit aus mit der Rechten und machte eine tiefe, respektvolle Verbeugung.
»Der verspricht, der verspricht,« dachte Brand: »so jung er ist, kennt er schon das Mitleid und die Ehrfurcht. Beim Mitleid und bei der Ehrfurcht fängt der Mensch an, sehr früh also bei diesem Fritzchen.«
Er verließ den Garten und folgte den Kindern, die »nach Armuth rochen.«