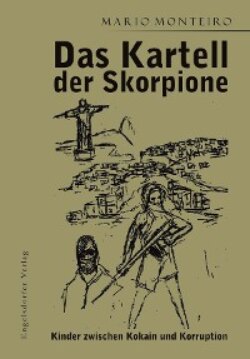Читать книгу Das Kartell der Skorpione - Mario Monteiro - Страница 6
1. Kapitel
ОглавлениеDie Leuchtspur sprang im Zweisekundentakt über den dunkelgrünen Tachometer. Der Fahrer zwang sich, nicht ständig auf die Uhr zu schielen. Als der Cadillac am Tunnel ankam, war es vierzehn vor neun. Und Punkt halb zehn sollten sie am Flughafen sein. Halb zehn, überlegte der Fahrer. Sie werden es gerade noch schaffen. Der heruntergekommene Lieferwagen, der die ganze Zeit auf Zentimeterdistanz hinter ihnen hergefahren war, schien am Ende doch noch vernünftig geworden zu sein. Plötzlich hielt er einen ganz annehmbaren Abstand ein.
Jorge Berenguer ärgerte sich über seinen eigenen Verstand. Und überhaupt. Weshalb rieb er sich schon wieder in den Augen? Er hatte doch fantastisch durchgeschlafen. Im Lichtkegel des rechten Scheinwerfers huschten fingerbreite Risse vorbei, wie Spinnenbeine auf grauschwarzem Beton, aus dem Grundwasser sickerte.
Sein Boss im Fond hatte die druckfrische Morgenausgabe der ›Gazeta Mercantil‹ zur Seite gelegt und entschied sich dafür, nicht weiterzulesen. Das Licht im Tunnel war nicht das Beste und dazu flackerte es ständig in den Röhren.
Anthony McGooley besah seine Schuhspitzen und überschlug die Zeit. Er konnte sich ohnehin ausmalen, auf wen es der für seine Polemik bekannte Wirtschaftsjournalist dieses Mal abgesehen hatte. Dezember 2. 010! Fast vier Jahre saß McGooley schon wieder hier. Drei Jahre höchstens, hatten sie in New York damals versprochen. Nur bis alles richtig liefe. Und dabei blieb es dann. McGooley presste die Lippen zusammen. Eines Tages werden sie ihn vielleicht ins Headquarter holen. Oder Kollege Bronson wird endlich torpediert und sie werden ihm das Eurocenter in Rotterdam übertragen. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Zukunftsvisionen! Dabei verblassten selbst jene unmissverständlichen Drohungen, die ihm anfangs der Woche die Farbe aus dem Gesicht getrieben hatten. Bis er damit begann, die Gewitterwolken zu verdrängen und nichts mehr ernst zu nehmen. Prompt ließ auch das bohrende Gefühl im Magen nach und bald darauf lächelte er in sein eigenes Gesicht. Jedes Mal, wenn er vor dem Spiegel stand.
Stahlhart und unnachgiebig war er noch immer mit allen Hindernissen fertiggeworden. Und selbst die Kassandrarufe, die sich auf der heutigen Titelseite bis zur letzten Zeile hinzogen, konnten ihm nur ein müdes Lächeln entlocken. Also gab ihm seine eigene Unternehmenspolitik, die er vor dem Board verteidigte, in allen Punkten recht. Und genau das wird er auch den Herren in Buenos Aires gleich nach der Landung auseinandersetzen.
Weder der unruhige, stoßweise Atem seines Fahrers noch das ungewohnte Zucken der Nackenmuskulatur und die Art, in der sich Jorges Finger im Steuer verkrallten, war dem Präsidenten der American Viamac do Brasil zunächst aufgefallen. Und als der Manager, einem Zufall gehorchend, durch die Windschutzscheibe starrte, war es bereits zu spät. Jäh fuhr seine Hand in die Lederschlaufe. Und hoffend, den unvermeidlichen Stoß in seiner Wirbelsäule noch abzufangen, stemmte er sich mit beiden Füßen gegen den stählernen Sockel des Vordersitzes.
Der Fahrer unterdrückte einen leisen Fluch. Warum musste dieser Idiot da vorne mit seinem elenden Vehikel so plötzlich stoppen? Und das ausgerechnet hier, mitten im Tunnel! Wieso eigentlich? Es gab doch keinen Grund dazu, wenigstens soweit es McGooley vom Fond des Wagens aus beurteilen konnte.
... peng! Die Stoßstange des Cadillacs zertrümmerte das Heck der verrosteten Kiste.
»Auf den Schrottplatz mit dir!«, fluchte Jorge. Nicht einmal die Bremsleuchten funktionierten bei dem Kerl. Und total abgefahrene Reifen, soweit es von hier aus zu beurteilen war. Selbst ein so gerissener Fahrer wie Jorge hätte nicht die geringste Chance gehabt, den Aufprall im letzten Moment doch noch zu verhindern. Wütend zunächst, und dann schreckgelähmt starrte er durch das halb offene Fenster in den Außenspiegel.
Zum Donnerwetter! Warum reagierte diese verdammte Schlafmütze nicht. Der blödsinnige Lieferwagen hinter ihm musste doch stockvoll ... »Mensch hau auf die Bremse!«
In Jorges Hirn zuckte es. Zurückstoßen! Ausscheren! Und nichts wie raus hier! Im gleichen Moment sah er die Sinnlosigkeit ein. Mit diesem Kahn und in den paar Sekunden, die ihm jetzt noch blieben, mitten drin in dieser elenden Betonröhre. Mitten in der Mausefalle von Rio! In der Mausefalle hockten sie.
Abflug zehn Uhr zehn, schoss es ihm noch durch den Kopf. McGooley musste die Vormittagsmaschine unbedingt kriegen. In Buenos Aires wartete ein halbes Dutzend auf ihren Boss.
Rumm! Der Minitransporter donnerte stockvoll in den Kofferraum des Cadillacs. Eingekeilt. McGooley schoss wie ein Projektil aus dem Fond nach vorne und landete mit dem Kopf nach unten zwischen Beifahrersitz und Frontscheibe. Offenbar sofort bewusstlos, konnte er gar nichts mehr mitgekriegt haben.
Dann stand die Kawasaki da. Natürlich mit abgedrehten Scheinwerfern, keine zwei Meter neben Jorge, dem die Maschine bis zuletzt nicht aufgefallen war. Leichtsinnige Brüder.
Die beiden Burschen auf dem Feuerstuhl grinsten unverfroren auf das Lederpolster. Anstatt gleich anzupacken. Jorge wusste in der ersten Sekunde selbst nicht recht, was tun. Hundertmal schon hatte er sich eine derartige Situation vorgestellt. Mit zitternden Knien tastete er McGooley ab und fingerte nach dem Verbandskasten. Der Boss blutete leicht an der rechten Stirn. Schramme. Sicher war es nicht all zu schlimm.
»Nein« schrie Jorge entsetzt. Und noch einmal: »N-nein! Bitte!«
Die Kerle auf der Kawasaki grinsten immer noch. Dann blitzte die Mündungsfeuer und sie feuerten, was aus ihren MPi’s herauszukriegen war. Zwanzig Sekunden Kugelhagel!
Mit aufgerissener Brust, blutüberströmt und immer noch voll da, sah Jorge das kurze Stahlrohr auf den Rücksitz schwirren. Die Explosion zerfetzte die Karosserie der schweren Limousine, dann raste die Druckwelle des infernalischen Tornados durch den Tunnel von Rebouça.
Rio ... kurz vor neun! Der diensttuende Polizeioffizier zögerte einen Moment. Um ganz sicher zu gehen, blickte er zum zweiten Mal auf die nagelneue Omega. »Stimmt genau ... acht Uhr 51«, gab er an die Zentrale durch. »Was zu sehen ist ...« Der Beamte lachte dreckig. Diese Scheißer im Büro fragten einem vielleicht ein Loch ins Ohr. »Natürlich wissen wir nicht, wer unter dem Blechhaufen liegt. Jetzt jedenfalls noch nicht.«
Im Instituto Médico Legal könnten die Doktorchen dann zusehen, wie sie das Puzzle aus zusammengehauenen Knochen und einem halben Dutzend verkohlter Muskelfetzen zusammenkriegten.
Der Polizist steckte das Handy in den Gürtel. Der Tag fing richtig bombig an. Auch auf dem ersten TV-Streifen sah man so viel wie nichts. Und wen sie sich heute Morgen im Rush durch den Tunnel vorgeknüpft hatten, das käme sowieso erst raus, nachdem das Fahrgestell identifiziert sein wird oder das, was davon noch übrig war. Kopfschüttelnd stieg der Beamte in seinen Jeep. Viel werden die da nicht mehr finden.
Der alte Mann schaltete das Fernsehgerät aus und tappte zufrieden an den Tisch zurück, um sein Frühstück zu beenden. Seit langem hatte er nicht mehr so gut geschlafen. Die grausigen Hirngespinste, die ihn seit Wochen verfolgten, waren unversehens ausgeblieben und das hatte er eigentlich gar nicht mehr zu hoffen gewagt. Dann hing es also doch mit den neuen Tabletten zusammen, die ihm sein Hausarzt verschrieben hatte. Selbst der kleine Moisés stellte sofort fest, dass sich die Stimmung seines Herrn ganz wesentlich gebessert haben musste. Das Negerchen, das seinen Dienst gewöhnlich in der Küche zu versehen hatte, stand jeden Morgen an einer auf den Zentimeter festgelegten Stelle, etwas abseits von dem tadellos gedeckten Tisch, an dem sich der Anwalt damit beschäftigte, den Rest der Cornflakes auszulöffeln.
Nicht eine Sekunde durfte der Kleine verlieren, wenn es dem Mann am Tisch einfallen sollte, noch etwas zu wollen. Nur nicht schlafen! Mammy trichterte es ihm jeden Morgen von neuem ein. Sonst wird er die Stelle bei Dr. Cariaga am Ende noch verlieren. Und so etwas Gutes würde er heutzutage nirgends mehr bekommen.
Trotzdem war der Kleine nicht so richtig bei der Sache. Viel zu unaufmerksam war er. Ein Glück, dass der Küchenchef gerade nicht in der Gegend war. Seinen Blick starr auf die blank gescheuerten Terrassenplatten geheftet, zählte Moisés heimlich die Tage ab, bis ihm der dicke Frederico das Wochengeld auf den Küchentisch legen würde. Freilich nicht ohne ihm jedes Mal etwas für diese oder jene Kleinigkeit abzuzwacken.
Endlich riskierte der Bub einen scheuen Blick hinüber auf den Tisch und zwar lediglich, um sich zu vergewissern, ob er immer noch mit der guten Laune des Doktors rechnen dürfe.
Zur Beruhigung des Kleinen zeigten sich indessen die unter dem Hauspersonal so gefürchteten Fältchen neben den Mundwinkeln des alten Mannes heute Morgen nicht. Ganz im Gegenteil. Schon zum zweiten Mal strich Dr. Cariaga über sein peinlich gepflegtes Lippenbärtchen, und das war von jeher ein untrügliches Zeichen für seine Zufriedenheit.
Doch weshalb der Doktor so lange mit dieser seltsamen Nadel spielte, hatte Moisés nicht begriffen. Was wollte er nur mit dem komischen Ding? Schon wieder hielt er sie gegen das grelle Sonnenlicht. Moisés senkte schnell das Köpfchen, um seine Neugier nicht zu zeigen.
Trotz der teuren, grünlich getönten Lesebrille auf seiner dünnen, in einer kläglichen Spitze auslaufenden Nase war der schmalbrüstige Siebziger, durch eine frühzeitige Rachitis stark beeinträchtigt und im Übrigen auch etwas zu kurz geraten, eine ziemlich unauffällige Erscheinung, dabei bescheiden, wenn man seinen rundum gepanzerten Bentley und das voll abgesicherte Penthouse hoch über der Avenida Atlántica nicht berücksichtigte.
Entschieden willensstark, dabei nicht mehr als ein Dutzendgesicht, gehörte Alberto Cariaga zu jenen Persönlichkeiten, die auf keinem Empfang anzutreffen waren, in keiner Gesellschaftsspalte erwähnt wurden und es auch peinlichst vermieden, vor eine neugierige Kamera zu geraten.
Und dennoch beeinflusste der Anwalt von Copacabana das Leben der Millionenstadt so nachhaltig, wie es nur Staatspräsidenten oder
machthungrigen Pressezaren möglich gewesen wäre.
Weniger mürrisch als in den vergangenen Tagen, wies er Moisés an, die beiden welken Blätter aus dem Schwimmbad zu fischen. Von dort aus, wo Cariaga gerade seinen letzten Bissen verzehrte, hatte man einen unvergleichlichen Blick über den kilometerweit sich aus dehnenden Badestrand bis nach Leblon hinüber und weit hinaus auf die bläulich silberne See. Und dennoch gehörte jenes grandiose Panorama zu den Alltäglichkeiten, die der einsame Bewohner der Fünfmillionen-Dollarbehausung längst nicht mehr wahrgenommen hatte. Denn Wichtigeres hatte ihn Tag für Tag in Anspruch genommen. So war es heute das Nadelöhr, das ihn den ganzen Tag lang beschäftigen sollte.
Das Nadelöhr im Tunnel von Rebouça! Mit einem jähen Ruck, den er sich selbst nicht recht erklären konnte, richtete er sich auf, beugte sich dann entschlossen über den Tisch und stach die Nadel in das damastene Tischtuch. Sicher wäre niemand, der ihn in diesen Minuten hätte beobachten können, das zynische Lächeln um den schmallippigen Mund entgangen, in Wahrheit eine böse Grimasse, nichts als ein kleiner Schlitz, der einen sekundenlangen Blick in seine Seele erlaubte, von der er selbst kaum eine Ahnung hatte.
Oder versuchte er gar, sich vorzustellen, wie das anmaßende Gesicht McGooleys nun aussehen könnte? Schade! Nachdenklich kniff Cariaga beide Augen zu.
Alle, die draußen in Ipanema oder in den teuren Wohnungen von Leblon wohnten, sich von der angenehmen Brise vor der Barra de Tijuca oder in Leme verwöhnen ließen, waren am Ende gezwungen, sich jeden Morgen durch den Tunnel zu quetschen, um eine halbe Stunde später in eisgekühlten Büros vor den Computern zu sitzen. Doch bis dahin hatten sie nichts zu erwarten als kilometerlange Fahrzeugkolonnen. Abbremsen und anfahren, Meter um Meter hinter dem Vordermann herkriechen, warten bis Ampeln umschalteten und froh sein, wenn man wieder durch den Tunnel war. Dabei war die Mausefalle nur eine der unfehlbaren Waffen, die Dr. Cariaga mit einem einzigen Anruf einzusetzen vermochte.
Moisés flitzte an den Tisch. Hoffentlich hatte Senhor Alberto zu guter Letzt nicht doch noch seine Geduld verloren. Wortlos hielt er dem Kleinen die Nadel entgegen. Moisés sauste los, um das unnütze Ding in die Nähstube zurückzubringen.
»E traga me o celular!«, rief Cariaga hinter ihm her.
Aha! Sein Handy wollte er auch gleich haben. Moyses steckte die Nadel in Luizas Nähkörbchen, flitzte an drei hintereinander liegenden Schlafräumen vorbei, durchs Massagebad und dann ins Arbeitszimmer. Dort hatte das zweite Handy zu liegen. Griffbereit, rechts unterhalb der Schreibtischuhr. Ordnung musste sein. Nie durfte man lange danach suchen müssen.
Jetzt geht bestimmt wieder das Gequatsche los, überlegte Moisés, während er mit dem vergoldeten Funktelefon auf die Terrasse zurückhetzte. Nach einem scheuen Blick auf die ausgestreckte Hand des Mannes hielt ihm Moisés das Handy hin und stahl sich davon.
»Alles okay, Doutor Alberto«, bestätigte sein Partner. Cariaga hasste es, Zeit zu verlieren, wenn einmal etwas beschlossen war. Er sah kurz auf, rückte dann die Brille zurecht und blickte auf die Uhr.
»Wirklich«, fragte er. Alles okay, Guimaraes?«
»Alles okay«, bestätigte der Anrufer und atmete durch. Auf die Minute genau hatten die Skorpione zugeschlagen. Nur einen Sprung weit trieben sie sich vor den Tunneleinfahrten herum oder warteten mitten in der Röhre auf das Opfer, hockten hinter unscheinbaren Mäuerchen, unsichtbar im dichten Gestrüpp längs der Zufahrten. Sie mordeten erbarmungslos und schnell. Die Betroffenen sollten nicht leiden müssen, verlangte Cariaga. Sie durften nur keine Chance haben zu entkommen.
Warum die Organisation im Fall McGooley nicht früher zugeschlagen hatte, war im engsten Kreis um Cariaga keinem so recht klar gewesen. Tagelang machte man im Kartell saure Gesichter, besonders wenn Cariaga nicht in der Nähe war. Hatte man dem Amerikaner nicht pünktlich drei Millionen Dollar auf sein Luxemburger Konto überwiesen? Und dann hatte McGooley die Stirn gehabt, den Betrag zurückzuschicken und sich keine Minute länger an die Abmachungen zu halten. Die erste Operation dieser Art war es doch nicht und der Kontaktmann aus Philadelphia hatte sich inzwischen einen Sack voll Dollar verdient. Warum wollte McGooley auf einmal nicht mehr mitmachen?
Das Schiff, um das es heute ging, war vorgestern in San Francisco ausgelaufen, und die vier Container voll Äthyläther, säuberlich als Bohrmittel für Erdölfelder deklariert, waren nicht an Bord. Es sei zu gefährlich zur Zeit, gab McGooley, codeverschlüsselt, an Cariaga weiter.
»Zu gefährlich?«, höhnte Guimaraes. Jetzt auf einmal! In Medellin tobten sie wie die Irrsinnigen. Ihr Äthervorrat sei am Ende und die Extraktion der Kokablätter stehe still. Cariaga hatte McGooley zweimal warnen lassen. Hatte der Manager vielleicht darauf gehört? Oder meinte er am Ende, nur seines US-Passes wegen könne er sich alles erlauben? Was für eine Illusion!
Nach einigem Hin und Her hatte Cariaga seinen Männern Recht geben müssen. Außerdem wisse McGooley inzwischen viel zu viel. Auch in diesem Loch stocherte man die ganze Woche über. Der Kerl müsse weg. Guimaraes gab nicht nach. Nur Cariaga schwankte immer noch. Kurz vor Wochenende gab er auf.
»Entao, queima de arquivo«, sagte er lustlos, als er das Meeting beendete und das bedeutete nicht mehr als undichte Stellen im Netz mit etlichen Leichen zuzudecken. Doch nicht nach einer letzten Chance für McGooley. Deadline war am Wochenende.
»Macht den Tunnel frei!« Cariagas Stimme krächzte, als er nach Barrios verlangte. Antonio Guimaraes saß auf der Schreibtischkante und hörte mit. Lange wird’s der Alte nicht mehr machen, überlegte er, stellte dabei ein bedenkliches Gesicht zur Schau, doch hütete er sich, einen weiteren Kommentar abzugeben.
»Wo ist Barrios«, fragte Cariaga ungeduldig. Bolzoni antwortete nicht sofort und schöpfte Atem.
»Wahrscheinlich noch in seinem ›Paratí‹!«
Cariaga murrte durchs Telefon. »Ich will ihn um elf bei mir sehen.«
»Sim Senhor«, erwiderte Bolzoni, fast einen Ton zu forsch. Erst gestern war er beim Chef angeeckt. In den nächsten Tagen durfte er sich nicht das Geringste erlauben.
»Todo está arranjado«, sagte er leise. Und das stimmte auch. Bis ins letzte Detail hatten sie alles vorbereitet. Zuverlässig. Nichts hatten sie jemals dem Zufall überlassen.
»Ich fahre jetzt los!« Cariaga krächzte immer noch und schien sich beim Sprechen anstrengen zu müssen, zwischendurch immer wieder nach Luft ringend.
»Barrios«, ächzte es in der Leitung. »Ich will Barrios bei mir sehen.«
Abrupt klappte Cariaga sein Handy zu. Guimaraes verzog das Gesicht und rutschte vom Tisch herunter. Bolzoni grinste zurück. Der Anruf war vorauszusehen. Nur nicht so schnell. Keine fünf Minuten war es her, seit die Boys den Cadillac im Tunnel hochgehen ließen und schon meldete sich der Boss.
»Also dann wollen wir mal!« Guimaraes schaltete den kleinen TV-Empfänger auf dem Schreibtisch aus und ließ die Sonnenblenden der beiden Fenster zur Seite gleiten.
»Zehn vor neun«, brummte er.
»Acht vor«, widersprach Bolzoni. »Nur um ganz genau zu sein.« Guimaraes zuckte mit den Schultern. Auf alle Fälle musste sich der Coronel um diese Zeit auf dem Weg zu seiner Dienststelle befinden.
»Ob er es schon weiß«, rätselten sie.
»Ruf ihn doch an!«
Coronel Bonrosa nickte unwillkürlich, als er die verhasste Stimme im Handy hörte. Fast so, als ob ihm die Kerle dabei auch noch ins Gesicht sehen könnten. Das fehlte ihm noch. Seit sich der Polizeioffizier zu weit vorgewagt hatte, waren ihm Zweifel gekommen. Vor allem, was Guimaraes betraf. Er wird sich schnellstens bei Barrios Rückendeckung verschaffen müssen.
»Warum hat der Kerl auch nicht besser aufgepasst?« murmelte der Polizist, nachdem Guimaraes aufgelegt hatte. Dann bekam er wieder einmal seinen roten Kopf. Konnte sich nicht jeder an seinen fünf Fingern abzählen, wie das mit diesem Amerikaner ausgehen wird? Selbst Barrios, der gewöhnlich keinen Ton von sich gab, hatte letzten Donnerstag im Club etwas bemerkt, was seine beiden Zuhörer misstrauisch werden ließ.
»Passt mal gut auf euer Tunnelchen auf«, drohte er mit dem Zeigefinger und dabei lachte er leise, so als ob es nur um einen abgedroschenen Bierwitz ginge.
Nur mit der Vollstreckung hatten sich die Brüder diesmal mehr Zeit gelassen. Weiß der Teufel warum, aber aus irgendeinem Grund hatten sie das Attentat so lange vor sich hergeschoben, so dass man am Ende nicht mehr daran glauben wollte.
»Was sagten Sie, Coronel?«, fragte der Sargento, der den Wagen durch das Chaos der Avenida Rio Branco steuerte. Bonrosa biss auf seine Zähne. Dann presste er die Lippen aufeinander.
»Nichts, gar nichts«, murrte er. »Nichts Besonderes jedenfalls.«
Als sie die ›Getulio Vargas‹ überquerten, winkte er der Besatzung eines Streifenwagens, die den Verkehrsstrom aufhielt, um Barrios vorbeizulotsen.
»Vor einer halben Stunde, im Tunnel ... gehöriger Kugelregen!«
»Entführung?«, fragte sein Fahrer.
Barrios zuckte mit den Achseln. »Vielleicht, vielleicht auch nicht! Jedenfalls eine gewaltige Detonation und ein paar Tote natürlich. Genaues wissen sie noch nicht.« Und damit beendete er den Kommentar.
»Mhm«, machte der Fahrer, und fragte sich, mit wem der Coronel gesprochen haben könnte. Dann surrte das Handy zum zweiten Mal. Die scharfe Stimme schreckte Bonrosa auf.
»Wir werden da ein paar Problemchen kriegen«, warnte Barrios.
»Ich höre«, sagte Bonrosa vorsichtig, ohne weitere Erklärungen zu bekommen. Der Name McGooley war tabu, mindestens so lange man offiziell nichts wusste.
»Die haben doch wieder mal keine Ahnung von nichts«, behauptete Bonrosa und dachte sofort an den Stunk, den es mit den Schlaksen von der Botschaft geben wird. Und die werden wieder alles haargenau wissen wollen, und das FBI wird die Interpol mobilisieren und womöglich noch einen Sonderbeauftragten schicken. Natürlich wird es Proteste hageln. Warum man in Rio nicht in der Lage sei, mit den Banditen endlich aufzuräumen. Als ob sie in Chicago und Los Angeles nur Nonnenklöster hätten.
»Drück mal auf die Tube«, herrschte er seinen Fahrer an. »Los, zu dem verdammten Tunnel rüber!«
Der Sargento ließ die Sirene aufheulen. »Rebouças«, fragte er und reizte den Oberst unnötigerweise.
»Klar, Rebouças!«, bellte Bonrosa. »Wohin denn sonst?«
An der Einfahrt des Tunnels war die Truppe vom Dienst mit den Nervenbündeln wochenendhungriger Fahrer noch immer nicht fertig geworden. Irgendein Blödian hupte mitten im Tunnel. Purer Protest natürlich. Oder weil der Kerl so einen Spaß an seiner Dreiklanghupe hatte. Anstatt froh zu sein, dass er’s nicht war, den sie auf der Liste stehen hatten.
Dann kamen die Burschen vom technischen Dienst mit der antiquierten Anlage nicht zurecht. Das kannte man vom letzten Mal. Als erstes fielen immer die Entlüfter aus und dann war das Licht weg. Im Dunkeln flogen hundert Türen auf, hemdsärmlige Fahrer wischten sich den Schweiß aus den Gesichtern und palaverten im Scheinwerferlicht der Wagen.
»Que passa de novo ... a última vez ...« Das, was dieser Filialdirektor sonst noch für mitteilenswert hielt, ging im Sirenengeheul eines Polizei-Jeeps unter. Hinter dem Schatten des Fahrzeugs stachen die Scheinwerfer des Abschleppwagens in die Finsternis.
Neun Uhr 15! Die Blechlawine aus Ipanema rollte an. Und kein halbes Dutzend wusste in diesem Moment, um was es heute Morgen ging. Bonrosa überhörte die Frage seines Fahrers.
Raubmord? Entführung? Auffahrunfall? Man hockte eben da und wartete und wusste nicht, wo vorne und hinten war und wann man endlich raus wäre aus dem Loch.
»In den Wagen sitzen bleiben! Rechts ran, bitte!« Nassgeschwitzt im Jeep stehend, brüllte ein Beamter in sein Megafon.
»Nada de grave. Todo esta em ordem«, wurden sie alle zwei Minuten beschwichtigt. Alles in Ordnung also? Nichts Besonderes? Weshalb dann die ganzen Fernsehteams?
»Kein Grund zur Aufregung«, wurden sie beruhigt. »Nur eine kurze Unterbrechung.«
Blitzlichter schossen an der Tunnelwand entlang. Sekundenlang tauchten Blechfetzen im Dunkel auf, zerrissen, aufeinander getürmt wie lästiger Müll. Pulverdampf und Rauchschwaden zogen durch den Tunnel. Der Gestank schwelenden Gummis biss in den Augen.
Endlich ging es weiter. Schrittweise fuhr man an, bremste, rückte auf.
»Geduld, etwas Geduld bitte. Na seht doch! Es geht schon wieder.«
Zwei Beamte winkten den Strom der Wagen durch den Tunnel.
... ANTHONY MCGOOLEY ERMORDET ... wird man vielleicht schon in den Mittagsausgaben erfahren. Und wenn schon. Wer zum Teufel war denn dieser McGooley?
Cariaga erreichte Barrios kurz vor zehn. Am Ende des Telefonates ließ er sich ein zweites Mal versichern, dass man mit dieser leidigen Sache keinesfalls in Verbindung gebracht werden könne.
»Natürlich nicht«, tröstete Barrios. Wozu hatte man Bonrosa? Seit Monaten lag der Coronel an der Leine und auch den Vorfall dieses Morgens wird er zur vollsten Zufriedenheit des Kartells regeln. Wenn nicht ... doch was das betraf, machte sich Bonrosa keine Illusionen. Am Abend wird er geschniegelt und gebügelt beim Kriminalreport vor der Kamera stehen. Höflich oder bestimmt, je nach dem, wird er den Vorfall bedauern, dann und wann verbindlich lächeln und immer wieder betonen, dass er zur Zeit aus verständlichen Gründen noch nicht viel sagen könne. Man sei bereits dabei, das heimtückische Verbrechen schnellstens zu klären. Doch aus taktischen Gründen müsse man noch schweigen. Wie immer werde die Polizei alles Erdenkliche tun ... und so weiter und so fort!
Zwei Tage lang werden die Zeitungen über nichts anderes berichten. Spekulationen, Theorien, Beweisaufnahmen, unbegreifliche Fehler bei der Untersuchung werden einige behaupten und dann ... ein Dementi nach dem anderen. Nichts als ein bedauerlicher Zwischenfall und damit basta!
Wo lebte man denn? Gab es nicht täglich Morde in dieser Stadt? Und einen Skandal nach dem anderen. Regierungsbeamte in Millionenschwindel mit städtischen Schuldverschreibungen verwickelt. Fünf Börsenagenten waren mit von der Partie! Das kam erst gestern ans Licht. Und dazwischen Menschenraub. Und Kinder, Kinder, die jeden Tag verschwanden und nach denen kein Hahn mehr krähte. Arme Kinder meistens, die am Morgen aus den Favelas ins Zentrum latschten, sich mit kleinen Gaunereien durchschlugen, bettelten oder mit ein paar Gramm Kokain und zwei drei Stückchen Crack in der Hosentasche ihre ersten Geschäftchen machten, um abends ein paar Kröten heimzubringen.
Spätestens in einer Woche wird ganz Rio vergessen haben, dass es einmal einen Anthony McGooley gegeben hatte.
Die Polizeibeamten grüßten höflich, als Cariagas Bentley vorüber glitt. Den ›graudo‹ hinter den dunkelgrünen Scheiben kannten sie nicht. Ein ›Wichtiger‹ musste das schon sein.
»Mann, in so einem Dampfer!« meinte einer der Beamten.
Der Rattenschwanz aufgestauter Wagen kroch hinterher, bleiche Gesichter sonnenverbrannter Fahrer am Steuer. Zweimal täglich zitterten sie, wenn sie durch den Tunnel mussten. Wer konnte hier wissen, wen sie sich als Nächsten vorknüpfen werden?
Früher hatte sich die halbe Welt um eine Position in Rio gerissen. Sonne und Meer, unendliche Strände, verlockende Frauen. Wer hatte dieser Stadt schon widerstanden? Aber heute! Zu Dutzenden verenden sie im Feuerhagel moderner Waffen. Gleich morgens, wenn sie aus der Wohnung kommend in die Tiefgarage hasten, Minuten später im nicht endenden Tohuwabohu des Stadtverkehrs vor Ampeln wartend, sich für Sekunden zwischen den Pfeilern eines Viadukts auf die nächste Besprechung vorbereitend.
Überall lauern die Skorpione aus den Bergen. Fast täglich schlagen Geschosse in Büroetagen ein. Hinterher laue Untersuchungen, ein paar Akten auf den Tischen verstaubter Dienststellen. Selten genug dringt Licht ins Dunkel und die wenigsten kennen die Gründe. Außer denen natürlich, die es erwischt. Eine Stadt mitten im Krieg. Wer merkt das schon?
Blutverschmiert hängen die Opfer in den Polstern frisch gewaschener Wagen, und jene, die der Illusion erliegen, sich noch bis zur nächsten Intensiv-Station durchzuschlagen, brechen ein paar Meter weiter auf dem Pflaster zusammen, halb schaudernd, halb neugierig begafft, hundertmal geknipst, vom Fernsehen gefilmt, zugedeckt und abtransportiert.
Die meisten müssen sich durch den Tunnel schieben und froh sein, wenn es auf der anderen Seite weitergeht. Scharfe Augen unfehlbarer Todesschützen überall. An den Ecken eleganter Straßen lauernd, oft keine hundert Meter neben weltbekannten Luxusläden und verstopften Bankfilialen, zwischen unscheinbaren Würstchenbuden, im Hinterhalt enger Hofeinfahrten, nur einen Sprung weit weg vom rettenden Hotelportal.
›Bala perdida‹ hieß es im Polizeibericht. Nichts als Querschläger also. So versuchte man eine ganze Stadt zu beruhigen. Auch wenn die Geschosse meistens den Kopf zerfetzten. Der Epilog versank im Schweigen fassungsloser Freunde oder unter den Schreien hysterisch kreischender Frauen, die über den Särgen ihrer Männer und Söhne hingen.
Der Tod wohnt auf den ›Morros‹, sagt man in Rio. Dort in den Bergen, rings um die Stadt hausen über zwei Millionen Menschen in Elendsquartieren, überleben durch täglichen Kleinverkauf von Kokain, Maconha und Crack. Zwischen morschen Brettern ihrer Hütten und unter Wellblechdächern, in versiegten Brunnenlöchern und hinter Friedhofsmauern eingebuddelt, hüten sie Karabiner und Munition für das Kartell. Dafür gibt’s Milch von den Bossen und Medikamente, um die Kinder der Ärmsten durchzubringen. Wehe, wer nicht spurt!
Aber dort droben, hinter Baracken und Lehmbuden, zwischen stinkenden Abwasserrinnen und quietschenden Ratten, im Schlamm und Morast, den tagelange Wolkenbrüche herunterwälzten, wer hatte dort jemals von Alberto Cariaga gehört?
Der alte Mann im Bentley hauchte die Gläser an und rieb sie blank. Einen Grund, unzufrieden zu sein, hatte er nicht. Längst hatten sie erreicht, was sie erreichen wollten. Sie hatten die Stadt kleingekriegt. Selbst die eleganten Herren in importierten Luxuswagen hatten sich mit Cariagas Konzern zu arrangieren.
In Angst und Schrecken lebten Hunderttausende. Wer es sich leisten konnte, mied die Stadt und manches Hotel bettelte in seitenlangen Anzeigen um Gäste, die von Jahr zu Jahr seltener kamen. Internationale Unternehmen wanderten ab. Irgendwo draußen zwischen Sâo Paulo und Belo Horizonte, vielleicht bei Recife oder hinter Curitiba glaubte man sicher zu sein. In den Chefetagen der Banken zermarterten sie ihre Köpfe. Cariaga schmunzelte. Die millionenschweren Kunden mit sauberem Geld, das in der Rezession knapp und knapper geworden war, verschwanden fast über Nacht. Selbst in den Kreditinstituten war man plötzlich auf das Kartell angewiesen, auf die Millionen, die aus dem Rauschgiftgeschäft sprudelten, die Stapel von Dollar aus kleinen und großen Erpressungsmanövern, aus Schutzgebühren und Entführungsdividenden.
Hunderte von Millionen, von denen die Zentralbank nichts ahnte. Und wer etwas wusste, hielt seinen Mund. Riesensummen lagen auf Konten von Menschen, die nie gelebt hatten, angelegt im Namen von Firmen, die nicht existierten. Schmutziges Geld für Belohnungen an folgsame Polizeibeamte, Prämien für Richter, die nicht aburteilten, Wahlgeschenke an Abgeordnete, auf deren Unterstützung man sich beim nächsten Gesetzentwurf verlassen konnte.
Täglich wechselten Millionen ihre Besitzer, Tausende kleiner Regierungsangestellter und deren Helfershelfer besserten ärmliche Bezüge auf, finanzierten den eigenen Kokainkonsum und unterhöhlten den Staat, von dem sie lebten.
Recht geschah es den Banken, behauptete Cariaga. Hatten diese Dollarjongleure vielleicht Ruhe gegeben? Bohrten und schaufelten sie nicht Tag und Nacht, bis sie ihm das Geschäft mit dem verbotenen Glücksspiel vermasselt hatten? Nur weil sie die Supergewinne selber einstecken wollten. Riesensummen, Centavo auf Centavo herausgeholt aus den Taschen der Armenheere, von Menschen, die jeden Tag aufs Neue davon träumten, den ganz großen Coup zu machen und ihrem Elend ein für alle mal zu entrinnen. Warum also hatten sie Cariaga samt seinen Partnern aus dem Geschäft gedrängt?
Musste sich das Kartell nicht notgedrungen nach anderen Möglichkeiten umsehen?
Doch solange sie auch suchten und forschten, immer kamen sie auf das gleiche Resultat. Es gab nichts Besseres, als mit den starken Männern in Cali und Medellin zusammenzuarbeiten.
»Droben in den Anden haben sie die Pflanzer in der Hand und kümmern sich um reibungslose Extraktion«, rief ihnen Cariaga schon vor Jahren zu. »Doch sie brauchen fünf Kontinente, um das Zeug loszuwerden. Und die Häfen, die Airports, Leute? Die internationalen Banken, die nur darauf warten, Milliarden waschen zu können ... wo liegen die denn? Hier bei uns in Brasilien«, rief er begeistert aus. »Und von hier aus geht es hinaus in die Welt!«
Dazu der Inlandskonsum. Ein bis auf die Knochen gestresstes Volk, durch jahrelange Inflation in die Armut getrieben und dann von der Rezession verfolgt. Hinter den miesesten Jobs rannten sie jetzt her, zusammengepfercht in rasant wuchernde Millionenstädte, die nichts als neue Armut zustande brachten. Im Elend geboren, verloren sie jede Sicherheit und zuletzt die Achtung vor sich selbst.
Nur dank der Voraussicht Cariagas und seiner Organisatoren lagen nun Tonnen von Kokain und Maconha in den Verstecken. Berge von Drogen, meterhoch aufgestapelt, modernste Pistolen zu Tausenden, selbst Handgranaten und Dynamitpatronen, Schnellfeuermunition und Granatwerfer sammelte sich auf den Morros an, nur ein paar tausend Meter von Luxusvierteln und übervölkerten Sandstränden entfernt.
Und dort unten? Fingen sie endlich an zu zittern und lahm vor Entsetzen auf den Vulkan zu starren, der in der nächsten Stunde ausbrechen könnte? An fünf Fingern könnte man sich abzählen, wie lange sich die Horden in den Bergen noch im Zaum halten ließen, meinten nicht wenige. Bis die Skorpione aus Löchern und Spalten krabbelten und losmarschierten, um den apokalyptischen Sturm anzublasen.
Wenn sie beginnen sollten, Söhne und Töchter der Reichen, Playboys und Spekulanten, Parasiten eines vermoderten Systems am Strand von Ipanema zusammenzuschießen. Wer sollte Hunderttausende der Ärmsten daran hindern, mit Schnellfeuergewehren, automatischen Pistolen und Plastikbomben in eine Welt einzudringen, die sie ausgeschlossen hatte? Nur um sich das zu holen, was sie zum Leben brauchten und nicht bezahlen konnten. Wer hätte es gewagt, sich ihnen zu widersetzen?
Trost sei mit euch! Sonne und Meer, erfrischender Schatten unter Kokospalmen, eng an haselnussbraune Brüste geschmiegt, das eigne sich nicht für einen Krieg, behaupteten die anderen. Ganz Unrecht hatten sie nicht. Fuhr man nicht jede Nacht hinauf und feilschte in düster verwinkelten Gassen, wartete im Dunkel auf den nächsten Dealer, hielt die Hand durchs Autofenster, um die tägliche Ration in Empfang zu nehmen? Selbst tagsüber, im Schatten eng aneinander stehender Bürotürme, in Tiefgaragen, neben Schulen und Clubs, an kilometerlangen Stränden, überall wartete einer auf den anderen. Nicht mehr als ein verständnisvoller Blick zwischen zwei Welten und ein Geschäft, das in 3o Sekunden abgeschlossen ist.
Nonsens! Wer bringt schon seine Kunden um? So blieb das Arsenal der Trader und Dealer, wo es schon immer war. In den Hütten auf den Bergen, versteckt unter Elendsbaracken, hinter Tausenden von Bretterbuden, in ausgetrockneten Brunnenlöchern und raffiniert ausgehobenen Gruben. Wie ein gigantisches, nicht zu überblickendes Spinnennetz zog es sich von Hang zu Hang. Wer wusste auch nur ungefähr, wie viele es waren, die dort hausten? Wem war bekannt, wo ein Elendsviertel endete und das nächste begann? Am wenigsten wussten sie das bei der Polizei. Oder sollten sich junge Beamte mit ärmlichen Gehältern, veralteten Waffen und dürftiger Ausbildung im Labyrinth der an den Abhängen ineinander verkeilten Behausungen abknallen lassen wie Schießbudenprämien? Sie hatten doch Frauen und Kinder. Und wie viele von ihnen mussten selbst in den Hütten ihr Dasein verbringen! Wand an Wand mit Tradern, Kokainschleppern und Mördern. Und die hatten immer die besseren Waffen. Dafür hatte der alte Herr auf dem Penthouse beizeiten gesorgt.