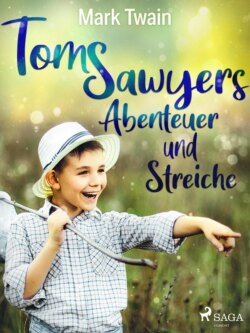Читать книгу Tom Sawyers Abenteuer und Streiche - Mark Twain, ReadOn Classics, Charles Dudley Warner - Страница 5
Erstes Kapitel
Оглавление„Tom!“
Keine Antwort.
„Tom!“
Tiefes Schweigen.
„Wo der Junge nun wieder stedt, möcht’ ich wissen. Du — Tom!“
Die alte Dame zog ihre Brille gegen die Nasenspitze herunter und starrte drüber weg im Zimmer herum, dann schob sie sie rasch wieder empor und spähte drunter her nach allen Seiten aus. Nun und nimmer würde sie die Brille so entweiht haben, dass sie durch die geheiligten Gläser hindurch nach solchem geringfügigen Gegenstand geschaut hätte, wie ein kleiner Junge einer ist. War es doch ihre Staatsbrille, der Stolz ihres Herzens, die sie sich nur der Zierde und Würde halber zugelegt, keineswegs zur Benutzung, — ebenso gut hätte sie durch ein paar Kochherdringe sehen können. Einen Moment lang schien sie verblüfft, da sie nichts entdecken konnte, dann ertönte wiederum ihre Stimme, nicht gerade ärgerlich, aber doch laut genug, um von der Umgebung, dem Zimmergerät nämlich, gehört zu werden: „Wart, wenn ich dich kriege, ich — —“
Sie beendete den Satz nicht, denn sie war inzwischen ans Bett heran getreten, unter welchem sie energisch mit dem Besen herumstöberte, was ihre ganze Kraft, all ihren Atem in Anspruch nahm. Trotz der Anstrengung förderte sie jedoch nichts zu Tage, als die alte Katze, die ob der Störung sehr entrüstet schien.
„So was wie den Jungen gibt’s nicht wieder!“
Sie trat unter die offene Haustüre und liess den Blick über die Tomaten und Kartoffeln schweifen, welche den Garten vorstellten! Kein Tom zu sehen! Jetzt erhob sich ihre Stimme zu einem Schall, der für eine ziemlich beträchtliche Entfernung berechnet war:
„Holla — du — To—om!“
Ein schwaches Geräusch hinter ihr veranlasste sie sich umzudrehen und zwar eben noch zu rechter Zeit, um einen kleinen, schmächtigen Jungen mit raschem Griff am Zipfel seiner Jacke zu erwischen und eine offenbar geplante Flucht zu verhindern.
„Na, natürlich! An die Speisekammer hätte ich denken müssen! Was hast du drinnen wieder angestellt?“
„Nichts.“
Nichts? Na, seh’ mal einer! Betracht’ mal deine Hände, he, und was klebt denn da um deinen Mund?“
„Das weiss ich doch nicht, Tante!“
„So, aber ich weiss es. Marmelade ist’s, du Schlingel, und gar nichts anderes. Hab’ ich dir nicht schon hundertmal gesagt, wenn du mir die nicht in Ruhe liessest, wollt’ ich dich ordentlich gerben? Was? Hast du’s vergessen? Reich’ mir mal das Stöckchen da!“
Schon schwebte die Gerte in der Luft, die Gefahr war dringend.
„Himmel, sieh doch mal hinter dich, Tante!“
Die alte Dame fuhr herum, wie von der Tarantel gestochen und packte instinktiv ihre Röcke, um sie in Sicherheit zu bringen. Gleichzeitig war der Junge mit einem Satz aus ihrem Bereich, kletterte wie ein Eichkätzchen über den hohen Bretterzaun und war im nächsten Moment verschwunden. Tante Polly sah ihm einen Augenblick verdutzt, wortlos nach, dann brach sie in leises Lachen aus.
„Hol’ den Jungen der und jener! Kann ich denn nie gescheit werden? Hat er mir nicht schon Streiche genug gespielt, dass ich mich endlich einmal vor ihm in acht nehmen könnte! Aber, wahr ist’s, alte Narren sind die schlimmsten die’s gibt, und ein alter Pudel lernt keine neuen Kunststückchen mehr, heisst’s schon im Sprichwort. Wie soll man aber auch wissen, was der Junge im Schild führt, wenn’s jeden Tag was andres ist! Weiss der Bengel doch genau, wie weit er bei mir gehen kann, bis ich wild werde, und ebenso gut weiss er, dass, wenn er mich durch irgend einen Kniff dazu bringen kann, eine Minute zu zögern, ehe ich zuhaue, oder wenn ich gar lachen muss, es aus und vorbei ist mit den Prügeln. Weiss Gott, ich tu’ meine Pflicht nicht an dem Jungen. ,Wer sein Kind lieb hat, der züchtigt es’, heisst’s in der Bibel. Ich aber, ich — Sünde und Schande wird über uns kommen, über meinen Tom und mich, ich seh’s voraus, Herr, du mein Gott, ich seh’s kommen! Er steckt voller Satanspossen, aber, lieber Gott, er ist meiner toten Schwester einziger Junge und ich hab‘ nicht das Herz ihn zu Hauen. Jedesmal, wenn ich ihn durchlasse, zwickt mich mein Gewissen ganz grimmig und hab’ ich ihn einmal tüchtig vorgenommen, dann — ja dann will mir das alte, dumme Herz beinahe brechen. Ja, ja, der vom Weibe geborene Mensch ist arm und schwach, kurz nur währen seine Tage und sind voll Mühe und Trübsal, so sagt die hl. Schrift und wahrhaftig, es ist so! Heut’ wird sich der Bengel nun wohl nicht mehr blicken lassen, wird die Schule schwänzen, denk’ ich, und ich wird’ ihm wohl für morgen irgend eine Strafarbeit geben müssen. Ihn am Sonnabend, 1 wenn alle Jungen frei haben, arbeiten zu lassen, ist fürchterlich hart, namentlich für Tom, der die Arbeit mehr scheut, als irgend was sonst, aber ich muss meine Pflicht tun an dem Jungen, wenigstens einigermassen, ich muss, sonst bin ich sein Verderben!“
Tom, der, wie Tante Polly sehr richtig geraten, die Schule schwänzte, liess sich am Nachmittag nicht mehr blicken, sondern trieb sich draussen herum und vergnügte sich königlich dabei. Gegen Abend erschien er dann wieder, kaum zur rechten Zeit vor dem Abendessen, um Jim, dem kleinen Niggerjungen, helfen zu können das nötige Holz für den nächsten Tag klein zu machen. Dabei blieb ihm aber Zeit genug, Jim sein Abenteuer zu erzählen, während dieser neun Zehntel der Arbeit tat. Toms jüngerer Bruder, oder besser Halbbruder, Sidney, hatte seinen Teil am Werke, das Zusammenlesen der Holzspäne, schon besorgt. Er war ein fleissiger, ruhiger Junge, nicht so unbändig und abenteuerlustig wie Tom. Während dieser sich das Abendessen schmecken liess und dazwischen bei günstiger Gelegenheit Zuckerstückchen stibitzte, stellte Tante Polly ein, wie sie glaubte, äusserst schlaues und scharfes Kreuzverhör mit ihm an, um ihn zu verderbenbringenden Geständnissen zu verlocken. Wie so manche andere arglos-schlichte Seele glaubte sie an ihr Talent für die schwarze, geheimnispolle Kunst der Diplomatie. Es war der stolzeste Traum ihres kindlichen Herzens, und die allerdurchsichtigsten kleinen Kniffe, deren sie sich bediente, schienen ihr wahre Wunder an Schlauheit und List. So fragte sie jetzt:
„Tom, es war wohl ziemlich warm in der Schule?“
„Ja, Tante.“
„Sehr warm, nicht?“
„Ja, Tante.“
„Hast du nicht Lust gehabt schwimmen zu gehen?“
Wie ein warnender Blitz durchzuckte es Tom, — hatte sie Verdacht? Er suchte in ihrem Gesichte zu lesen, das verriet nichts. So sagte er:
„N—ein, Tante, — das heisst nicht viel.“
Die alte Dame streckte die Hand nach Toms Hemdkragen aus, befühlte den und meinte:
„Jetzt ist dir’s doch nicht mehr zu warm, oder?“
Und dabei bildete sie sich ein, bildete sich wirklich und wahrhaftig ein, sie habe den trockenen Zustand besagten Hemdes entdeckt, ohne dass eine menschliche Seele ahne, worauf sie ziele. Tom aber wusste genau, woher der Wind wehte, so kam er der mutmasslich nächsten Wendung zuvor.
„Ein paar von uns haben die Köpfe unter die Pumpe gehalten — meiner ist noch nass, sieh!“
Tante Polly empfand es sehr unangenehm, dass sie diesen belastenden Beweis übersehen und sich so im voraus aus dem Felde hatte schlagen lassen. Ihr kam eine neue Eingebung.
„Tom, du hast doch wohl nicht deinen Hemdkragen abnehmen müssen, den ich dir angenäht habe, um dir auf den Kopf pumpen zu lassen, oder? Knöpf doch mal deine Jacke auf!“
Aus Toms Antlitz war jede Spur von Sorge verschwunden. Er öffnete die Jacke, der Kragen war fest und sicher angenäht.
„Dass dich! Na, mach’ dich fort. Ich hätte Gift drauf genommen, dass du heut’ mittag schwimmen gegangen bist. Wollens gut sein lassen. Dir geht’s diesmal wie der verbrühten Katze, du bist besser, als du aussiehst — aber nur diesmal, Tom, nur diesmal!“
Halb war’s ihr leid, dass alle ihre angewandte Schlauheit so ganz umsonst gewesen, und halb freute sie sich, dass Tom doch einmal wenigstens, gleichsam unversehens, in den Gehorsam hinein gestolpert war.
Da sagte Sidney:
„Ja aber, Tante, hast du denn den Kragen mit schwarzem Zwirn aufgenäht?“
„Schwarz? Nein, er war weiss, so viel ich mich erinnere, Tom!“
Tom aber wartete das Ende der Unterredung nicht ab. Wie der Wind war er an der Türe, rief beim Abgeben. Sid noch ein freundschaftliches „wart‘, das sollst du mir büssen“ zu und war verschwunden.
An sicherem Orte untersuchte er drauf zwei eingefädelte Nähnadeln, die er in das Futter seiner Jacke gesteckt trug, die eine mit weissem, die andre mit schwarzem Zwirn, und brummte vor sich hin:
„Sie hätt’s nie gemerkt, wenn’s der dumme Kerl, der Sid, nicht verraten hätte. Zum Kuckuck! Einmal nimmt sie weissen und einmal schwarzen Zwirn, wer kann das behalten. Aber Sid soll seine Keile schon kriegen; der soll mir nur kommen!“
Tom war mit nichten der Musterjunge seines Heimatortes, — es gab aber einen solchen und Tom kannte und verabscheute ihn rechtschaffen.
Zwei Minuten später, oder in noch kürzerer Zeit, hatte er alle seine Sorgen vergessen. Nicht, dass sie weniger schwer waren oder weniger auf ihm lasteten, wie eines Mannes Sorgen auf eines Mannes Schultern, nein durchaus nicht, aber ein neues mächtiges Interesse zog seine Gedanken ab, gerade wie ein Mann die alte Last und Not in der Erregung eines neuen Unternehmens vergessen kann. Dieses starke und mächtige Interesse war eine eben errungene, neue Methode im Pfeifen, die ihm ein befreundeter Nigger kürzlich beigebracht hatte, und die er nun ungestört üben wollte. Die Kunst bestand darin, dass man einen hellen, schmetternden Vogeltriller hervorzubringen sucht, indem man in kurzen Zwischenpausen während des Pfeifens mit der Zunge den Gaumen berührt. Wer von den Lesern jemals ein Junge gewesen ist, wird genau wissen, was ich meine. Tom hatte sich mit Fleiss und Aufmerksamkeit das Ding baldigst zu eigen gemacht und schritt nun die Hauptstrasse hinunter, den Mund volt tönenden Wohllauts, die Seele voll stolzer Genugtuung. Ihm war ungefähr zu Mute, wie einem Astronomen, der einen neuen Stern entdeckt hat, doch glaube ich kaum, dass die Freude des glücklichen Entdeckers der seinen an Grösse, Tiefe und ungetrübter Reinheit gleich kommt.
Die Sommerabende waren lang. Noch war’s nicht dunkel geworden. Toms Pfeifen verstummte plötzlich. Ein Fremder stand vor ihm, ein Junge, nur vielleicht einen Zoll grösser als er selbst. Die Erscheinung eines Fremden irgend welchen Alters oder Geschlechtes war ein Ereignis in dem armen, kleinen Städtchen St. Petersburg. Und dieser Junge war noch dazu sauber gekleidet, — sauber gekleidet an einem Wochentage! Das war einfach geradezu unfasslich, überwältigend! Seine Mütze war ein niedliches, zierliches Ding, seine dunkelblaue, dicht zugeknöpfte Tuchjacke nett und tadellos; auch die Hosen waren ohne Flecken. Schuhe hatte er an, Schuhe, und es war doch heute erst Freitag, noch zwei ganze Tage bis zum Sonntag! Um den Hals trug er ein seidenes Tuch geschlungen. Er hatte so etwas Zivilisiertes, so etwas Städtisches an sich, das Tom in die innerste Seele schnitt. Je mehr er dieses Wunder von Eleganz anstarrte, je mehr er die Nase rümpfte über den „erbärmlichen Schwindel’, wie er sich innerlich ausdrückte, desto schäbiger und ruppiger dünkte ihm seine eigene Ausstattung. Keiner der Jungen sprach. Wenn der eine sich bewegte, bewegte sich auch der andere, aber immer nur seitwärts im Kreise herum. So standen sie einander gegenüber, Angesicht zu Angesicht, Auge in Auge. Schliesslich sagt Tom:
„Ich kann dich unter kriegen!“
„Probier’s einmal!“
„N — ja, ich kann.“
„Nein, du kannst nicht.“
„Und doch!“
„Und doch nicht!“
„Ich kann’s.“
„Du kannst’s nicht.“
„Kann’s.“
„Kannst’s nicht.“
Ungemütliche Pause. Dann fängt Tom wieder an:
„Wie heisst du?“
„Geht dich nichts an.“
„Will dir schon zeigen, dass mich’s angeht.“
„Nun, so zeig’s doch.“
„Wenn du noch viel sagst, tu’ ich’s.“
„Viel — viel — viel! Da! Nun komm ’ran!“
„Ach, du hälst dich wohl für furchtbar gescheit, gelt du? Du Putzaff’! Ich könnt’ dich ja unterkriegen mit einer Hand, auf den Rücken gebunden, — wenn ich nur wollt’!“
„Na, warum tust du’s denn nicht? Da sagst’s doch immer nur!“
„Wart, ich tu’s, wenn du dich mausig machst!“
„Ja, sagen kann das jeder, aber tun — tun ist was andres.“
„Aff’ du! Gelt du meinst, du seist was Rechtes? — Puh, was für ein Hut!“
„Guck’ wo anders hin, wenn er dir nicht gefällt. Schlag’ ihn doch runter! Der aber, der ’s tut, wird den Himmel für ’ne Bassgeig’ ansehen!“
„Lügner, Prahlhans!“
„Selber!“
„Maulheld! Gelt du willst dir die Hände schonen?“
„Oh — geh’ heim!“
„Wart, wenn du noch mehr von deinem Blödsinn verzapfft, so nehm’ ich einen Stein und schmeiss ihn dir an deinem Kopf entzwei.“
„Ei, natürlich, — schmeiss nur!“
“Ja, ich tu’s!“
„Na, warum denn nicht gleich? Warum wartest du denn noch? Warum tust du ’s nicht? Ätsch, du hast Angst!“
„Ich hab’ keine Angst.“
„Doch, doch!“
„Nein, ich hab’ keine.“
„Du hast welche!“
Erneute Pause; verstärktes Anstarten und langsames Umkreisen. Plötzlich stehen sie Schulter an Schulter. Tom sagt:
„Mach’ dich weg von hier!“
„Mach’ dich selber weg!“
„Ich nicht!“
„Ich gewiss nicht!“
So stehen sie nun fest gegeneinander gepresst, jeder als Stütze ein Bein im Winkel vor sich gegen den Boden stemmend, und schieben, stossen und drängen sich gegenseitig mit aller Gewalt, einander mit wutschnaubenden, hasserfüllten Augen anstarrend. Keiner aber vermag dem andern einen Vorteil abzugewinnen. Nachdem sie so schweigend gerungen, bis beide ganz heiss und glühendrot geworden, lassen sie wie auf Verabredung langsam und vorsichtig nach und Tom sagt:
„Du bist ein Feigling und ein Aff’ dazu. Ich sag’s meinem grossen Bruder, der haut dich mit seinem kleinen Finger krumm und lahm, wart nur!“
„Was liegt mir an deinem grossen Bruder! Meiner ist noch viel grösser, wenn der ihn nur anbläst, fliegt er über den Zaun, ohne dass er weiss wiel“ (Beide Brüder existierten nur in der Einbildung.)
„Das ist gelogen!“
„Was weisst denn du?“
Tom zieht nun mit seiner grossen Zehe eine Linie in den Staub und sagt:
„Da spring’ rüber und ich hau dich, dass du deinen Vater nicht von einem Kirchturm unterscheiden kannst!“
Der neue Junge springt sofort, ohne sich zu besinnen, hinüber und ruft:
„Jetzt komm endlich ‘ran und tu’s und hau, aber prahl nicht länger!“
„Reiz’ mich nicht, nimm dich in acht!“
„Na, nun mach aber, jetzt bin ich’s müde! Warum kommst du nicht!“
„Weiss Gott, jetzt tu’ ich’s für zwei Pfennig!“
Flink zieht der fremde Junge zwei Pfennig aus der Tasche und hält sie Tom herausfordernd unter die Nase.
Tom schlägt sie zu Boden.
Im nächsten Moment wälzen sich die Jungen fest umschlungen im Staube, trallen einander wie Katzen, reissen und zerren sich an den Haaren und Kleidern, bläuen und zerkratzen sich die Gesichter und Nasen und bedecken sich mit Schmutz und Ruhm. Nach ein paar Minuten etwa nimmt der sich wälzende. Klumpen Gestalt an und in dem Staub des Kampfes wird Tom sichtbar, der rittlings auf dem neuen Jungen sitzt und denselben mit den Fäusten bearbeitet.
„Schrei ,genug‘,“ mahnt er.
Der Junge ringt nur stumm, sich zu befreien, er weint vor Zorn und Wut.
„Schrei ,genugʻ,“ mahnt Tom noch einmal und drischt lustig weiter.
Endlich stösst der Fremde ein halb ersticktes genug’ hervor, Tom lässt ihn alsbald los und sagt: „Jetzt hast du’s, das nächstemal pass‘ auf, mit wem du anbindest!“
Der fremde Junge rannte heulend davon, sich den Staub von den Kleidern klopfend. Gelegentlich sah er sich um, ballte wütend die Fäuste und drohte, was er Tom alles tun wolle, „wenn er ihn wieder erwische.“ Tom antwortet darauf nur mit Hohngelächter und machte sich, wonnetrunken ob der vollbrachten Heldentat, in entgegengesetzter Richtung auf. Sobald er aber den Rücken gewandt hatte, hob der besiegte Junge einen Stein, schleuderte ihn Tom nach und traf ihn gerade zwischen den Schultern, dann gab er schleunigst Fersensgeld und lief davon wie ein Hase. Tom wandte sich und setzte hinter dem Verräter her, bis zu dessen Hause, wodurch er herausfand, wo dieser wohnte. Er pflanzte sich vor das Gitter hin und forderte den Feind auf, heraus zu kommen und den Streit aufzunehmen, der aber weigerte sich und schnitt ihm nur Grimassen durch das Fenster. Endlich kam die Mutter des Feindes zum Vorschein, schalt Tom einen bösen, ungezogenen, gemeinen Buben und hiess ihn sich fort machen. Tom trollte sich also, brummte aber, er wollte es dem Affen schon noch zeigen.
Erst sehr spät kam er nach Hause und als er vorsichtig zum Fenster hinein klettern wollte, stiess er auf einen Hinterhalt in Gestalt der Tante. Als diese dann den Zustand seiner Kleider gewahrte, gedieh ihr Entschluss, seinen freien Sonnabend in einen Sträflingstag bei harter Arbeit zu verwandeln, zu eiserner Festigkeit.