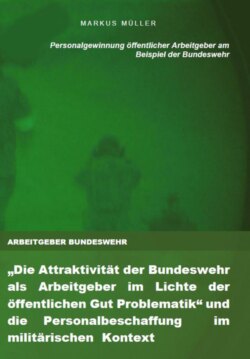Читать книгу ARBEITGEBER BUNDESWEHR und die Personalgewinnung öffentlicher Arbeitgeber - Markus Müller - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.2 Definition und Problematik öffentlicher Güter und Ressourcen 2.2.1 Definition
ОглавлениеÖffentliche Güter zeichnen sich durch zwei herausstechende Eigenschaften aus. Ihre Klassifizierung ist daher über die Konsummöglichkeit bzgl. der Merkmale Rivalität und Ausschließbarkeit möglich (Samuelson, 1954). Ein öffentliches Gut weist dabei A) Nicht-Ausschließbarkeit des und B) Nicht-Rivalität im
Konsum(s) auf. Ein „reines öffentliches Gut“ verfügt über beide dieser Merkmalsausprägungen. Liegt nur eines dieser Merkmale vor, handelt es sich bei diesem öffentlichen Gut um ein „unreines öffentliches Gut“. Besteht beispielsweise nur Nicht-Ausschließbarkeit vom, aber Rivalität im Konsum9, so handelt es sich um „Allmendegüter“. Liegt hingegen Nicht-Rivalität im, aber Ausschließbarkeit vom Konsum vor, handelt es sich um „Clubgüter“. Diese werden in der Literatur jedoch oft auch als „Mautgüter“ oder als ein „natürliches Monopol“ bezeichnet. Herrscht hingegen keine dieser beiden Merkmalsausprägungen vor, so handelt es sich um ein „privates Gut“, dass sich sowohl durch Rivalität im als auch durch Ausschließbarkeit vom Konsum auszeichnet. Ein elementarer Bestandteil für die Ausschließbarkeitsbedingung ist dabei das Vorliegen wohldefinierter Eigentumsrechte. Erst aufgrund durchsetzbarer Eigentums- und Verfügungsrechte können andere Individuen vom freien und unentgeltlichen „Free Rider“ Zugang zu einem Gut ausgeschlossen werden. Für ein privates Gut ist dies vollständig der Fall. Für ein Clubgut ist der Zugang hingegen an die Zahlung von z.B. einer Maut oder eines Eintrittspreises (diese sind zumeist jedoch nicht kostendeckend für die Bereitstellung des unreinen öffentlichen Gutes) gebunden.
Ein reines öffentliches Gut besteht hingegen ohne definierte Eigentumsrechte und Nutzungsbeschränkungen (z.B. Luft). Bei einem Allmendegut ist dies ebenfalls der Fall, jedoch herrscht hier Konsumrivalität zwischen den Nutzern (z.B. Hochseefischerei). Hieraus ergibt sich eine Einteilung in reine und unreine öffentliche Güter aufgrund von Rivalität und Zugangsbeschränkung/Ausschluss wie in der Abbildung 1 grafisch veranschaulicht.
Unter Verwendung dieses konzeptionellen Rahmens (vgl. u.a. Mankiw und Taylor, 2009 und Beck, 2011) erfolgt eine Charakterisierung des Gutes „Sicherheit“ bzw. Militär, auf die Ausgangslage dieser Studie bezogen, im weiteren Sinne in die Klassifizierungsbeispiele10
1 - privater Sicherheitsdienst (privates Gut)
2 - Militärmuseum (Club-/Mautgut als unreines Gut)
3 - Landes-/Bündnisverteidigung im Einsatzfall bei einer unterdimensionierten Armee (Allmendegut als unreines öffentliches Gut)
4 - Landes-/Bündnisverteidigung (reines öffentliches Gut)
und
1 - internationale Bündnisverteidigung (globales öffentliches Gut).
Abbildung 1: Reine und unreine öffentliche Güter
Da die bestehende Literatur hier häufig mit unterschiedlichen Begrifflichkeiten und unterschiedlichsten Beispielen arbeitet, dient die komplexe zusammenfassende Abbildung 2 dazu, dem Leser einen umfassenden Gesamtüberblick zur öffentlichen Gut Thematik im Spannungsfeld zu privaten Gütern, zu Externalitäten in Form von positiven und negativen externen Effekten, sowie zur Thematik globaler öffentlicher Güter zu ermöglichen (siehe Abb. 2).
Für den militärischen Fokus konzentriert sich diese Arbeit auf das reine öffentliche Gut11 Landesverteidigung bzw. Bündnisverteidigung, das auch als globales öffentliches Gut der Staaten-/Bündnisgemeinschaft supranational konsumiert wird.
Der konzeptionelle Rahmen globaler öffentlicher Güter (global public goods = GPGs) ist dabei in den letzten anderthalb Jahrzehnten zu einer Art Referenzrahmen in der Global Governance Debatte geworden. Er liefert damit über bilaterale und multinationale Verträge zwischen Staaten hinaus einen zusätzlichen Begründungszusammenhang für supranationale Kooperation und Zusammenarbeit und wurde bereits in verschiedenen UN-Foren extensiv diskutiert (vgl. Schubert und Bayer, 2010 und Kaul et al., 1999). So wurde beispielsweise bereits 2002 auf dem Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung in Johannesburg eine „International Task Force on Global Public Goods“ etabliert, die die Bereitstellung verschiedener globaler öffentlicher Güter, sowie deren Finanzierungsbedarf und -optionen entwickeln sollte12. Während die Bereitstellung öffentlicher Güter historisch gesehen immer eine nationalstaatliche Aufgabe war, gewinnt diese jedoch mit zunehmender Globalisierung immer mehr an einer globalen Perspektive hinzu. Da globale öffentliche Güter und Übel, bzw. deren Nutzen oder Schaden, über Landesgrenzen hinaus wirken, ergibt sich hieraus die Begründung für eine verstärkte multinationale Kooperation. Im militärischen Kontext praktiziert die Europäische Union und NATO dies bereits aktiv seit etwa 2004 durch die Indienststellung der EU-Battlegroup(s)13 und seit 2002 durch den Beschluss der Aufstellung einer NATO Response Force14.
Globalität stellt dabei eine Art von Öffentlichkeit dar, die sich durch den Wegfall nationaler (Handels-)Grenzen und die internationale Verflechtung durch Bündnisse und Abkommen ergibt. Aus globaler Sicht betrachtet ist ein nationalstaatliches öffentliches Gut supranational betrachtet daher ein Gut von globalöffentlicher Bedeutung und daher von erheblichem internationalem Interesse aufgrund seines globalsupranationalen externen Nutzens, das allein nationalstaatlich betrachtet, ebenfalls der Problematik öffentlicher Güter unterliegen würde. Seine effiziente Bereitstellung erfordert daher neben nationalen Anstrengungen ebenso eine Betrachtung und Bereitstellung als „globales öffentliches Gut15 “.
Abbildung 2: Öffentliche Güter im Spannungsfeld zu privaten Gütern, Externalitäten und globalen öffentlichen Gütern
Die politischen Präferenzen, welche globalen öffentlichen Güter in welcher Art und in welchem Umfang staatenübergreifend bereitgestellt werden sollen, erfordert somit einen global-normativen Ansatz und die Thematisierung innerhalb der internationalen Staatengemeinschaft. So forderte beispielsweise die „International Task Force on Global Public Goods“ in ihrem Zwischenbericht (2005) neben internationalen Schutzgütern wie Wäldern, Meeren, etc. ebenso eine verantwortliche internationale Sicherstellung der fünf zentralen globalen öffentlichen Güter
- Kontrolle ansteckender Krankheiten,
- freier Handel,
- Wissen,
- finanzielle Stabilität und
- Frieden und Sicherheit.
Im Kontext dieser Arbeit stehen hierbei internationaler Frieden und Sicherheit als globales öffentliches Gut externe Sicherheit, dass national auch häufig als internationales Peacekeeping bezeichnet und diskutiert wird, im Fokus.