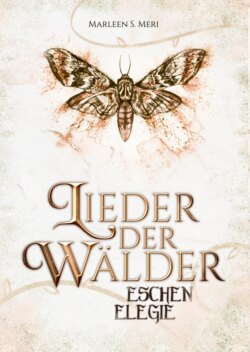Читать книгу Lieder der Wälder - Marleen S. Meri - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Schöpfungen des Waldes
Оглавление»In der Nacht, längst nicht erwacht, lang vor dem Morgen
spenden Bäume schöne Träume, in seinem Arm geborgen.
Tausend Kronen, die thronen dort auf seinem Haupt.
Knarren, Knistern, Säuseln, Wispern, dringen aus dem Laub.«
Aus ihrer hellen Stimme war das Kind noch nicht gänzlich gewichen. Die schmalen, eschenblassen Hände lösten die getrockneten Blüten und Kräuter von ihren Plätzen an der Schnur. Duftende Blütenblätter waren mit Farn und Thuja unterlegt. Schafgarbe, Myrte, Hainblume. Salbei, Blaustern, Kugeldistel. Bunte Fäden wanden sich um die Blütenpäckchen, die Knoten prüfte sie mit geübten Fingern.
Breya nahm die Räucherbündel und rollte sie in ein seidenes Tuch. Behutsam legte sie das Geschenk zu den anderen in den Korb. Das war genau das, was Severyn benötigte.
Ihr Zimmer im fürstlichen Palast von Eshwen war um diese Tageszeit lichtdurchflutet und golden. Letzte Nacht hatte es geregnet, aber heute, zum Frühlingsfest, war die Sonne hervorgekommen. Genau rechtzeitig drang sie durch die Vorhänge und beschien den seidenen Himmel über ihrem Bett, die ledernen Einbände der Bücher, die Paravents und Kleiderschränke. Fröhlich erleuchtete es die Blüten auf dem Balkon, die die Prinzessin stets sorgfältig mit Wasser versorgte. Breya liebte diese sachte Frühlingswärme. Obwohl sie nicht von den Eschenelben abstammte wie der Rest ihrer Familie, stellte sie sich manchmal vor, wie diese sich fühlten, wenn ihnen das Licht auf die Flügel schien – wie es ihnen erging, da der Wald alles war, was sie kannten. Wenn die Sonne so strahlte, fühlte sich Breya den Wäldern besonders nahe.
Sie verließ ihre Zimmerflucht, um sich zu Severyns Gemächern zu begeben. Die Geschenke trug sie in ihrem Korb.
»Guten Morgen, Eure Hoheit«, begrüßten sie die beiden Keitha, die ihre Räumlichkeiten bewachten.
»Guten Morgen, Dunmor. Guten Morgen, Barra.«
»Sollen wir jemanden holen, der die Geschenke für Euch trägt?«, fragte Dunmor.
Breya schüttelte den Kopf. »Danke, das schaffe ich schon.« Die beiden nickten und ließen sie ziehen, den Gang hinab bis zu Severyns Zimmerkomplex.
Auf den Gängen herrschte geschäftiges Treiben. Breya begegnete einer Schneidergesellin, die ihr Gewand für den Abend zu ihrem Gemach trug, und ihr Herz flatterte beim Anblick der wunderbaren seidenen Stoffe. Bedienstete reinigten Kronleuchter, Fenster und Gemälderahmen. Die mit goldenem Stuck ausgestatteten, weiß getünchten Wände und Fensterreihen waren mit Blumenbouquets und Gestecken geschmückt. Teppichläufer wurden gefegt, Spiegel poliert, Statuen abgestaubt. Der fürstliche Palast war von hypnotisierender Schönheit und heute würde er in ganz besonderem Glanz erstrahlen.
Breya schritt den Flur hinab, sie grüßte jeden freundlich und mit Namen. Farlan, Clara, Sibyl, Ronald. »Guten Tag, Maura«, sagte sie, als sie den Weg einer älteren Bediensteten kreuzte.
»Hoheit.« Maura knickste rasch. »Ihr seid bereits zurechtgemacht, fantastisch. Aber Ihr müsst umgezogen sein, bevor die Zeremonien beginnen.«
»Ist gut.« Noch trug sie bloß eine feine Bluse und einen seidenen, cremefarbenen Rock. Die oberen Partien ihres Haars waren geflochten und hochgesteckt. »Ich wollte Severyn nur rasch seine Geschenke geben. Es wird sicher nicht lang dauern, schließlich ist er beschäftigt, möglichst wunderbar auszusehen.«
Die ältere Dame verdrehte die Augen. »Tut das. Wenn er nicht mit Gegenständen nach Euch wirft, ist Euch das Glück bereits hold.«
»Ist er heute nicht gut zu sprechen?«
»Er ist der Schrecken jeder Bediensteten. All diese grauen Haare, nur wegen ihm.« Maura richtete ihre einfache Hochsteckfrisur. »Wenn er doch so liebreizend wäre wie seine Schwester.«
Breya lächelte. »Ich werde versuchen, dafür zu sorgen, dass er sich zurückhält. Für gewöhnlich habe ich ein gutes Gespür für ihn.«
»Hoheit, man sollte Euch heiligsprechen.« Maura knickste und grinste sie an. Breya erwiderte es warm.
»Wo ist meine Mutter, darf ich das noch wissen?«
»Sie kostet von den Speisen in der Küche und kommandiert die Bäcker herum. Entsprechend alles wie immer.« Maura nickte ihr zu, ehe sie in Richtung des Gemachs verschwand.
Breya hatte damit gerechnet, dass Severyn heute nicht besonders umgänglich sein würde. Das lag nicht bloß daran, dass er immer nicht besonders umgänglich war. Nein, heute würden die armen Bediensteten es noch einmal schwieriger mit ihm haben: Schließlich war sein Geburtstag.
Breya brauchte nicht lang nach Severyn zu suchen. Sie hörte seine Stimme bereits, als sie in den Empfangssalon trat: »Und ihr wisst Bescheid, wie sie zu liegen haben. Und wenn sich in zwei Stunden etwas verändert haben sollte, dann macht es neu! Du! Finde heraus, wie es um die Stiefel steht. Wenn sie noch nicht poliert wurden, sorgt dafür, dass – au!« Stille. Dann: »Du hast mich geschnitten?«
»Es tut mir leid, Eure Hoheit, Ihr habt den Kopf bewegt …«
»Willst du sagen, das war meine Schuld?«
»Neinein!«
Breya hatte Arbeitszimmer und Schlafgemach durchquert und betrat die Baderäumlichkeiten. Sie wurde Zeugin, wie Severyn sich den Rasierschaum abwischte und das Tuch ärgerlich fortwarf.
Der junge Bedienstete hob die Hände. »Bitte, es war keine Absicht. Womöglich ist es nicht schlimm, Ihr habt mächtiges Eshwenblut …«
»Eshwenblut, Eshwenblut!«, knurrte Severyn mit erstaunlich leichter Zunge. »Und wenn du tiefer geschnitten hättest? Ich sollte dich auf der Stelle … so eine Unverschämtheit kann …«
»Durchaus einmal vorkommen«, meldete sich Breya rasch zu Wort. Sowohl der Bedienstete als auch Severyn hoben die Köpfe. »Schon in Ordnung, Ronah.« Sie neigte das Kinn. »Sorge dich nicht, mein Bruder ist bloß angespannt. Nicht wahr, Seryn?«
»Ich verbitte mir so ein Verhalten«, entgegnete Severyn und spezifizierte nicht, wen genau er damit ansprach.
»Es war doch deine eigene Schuld«, erwiderte Breya geduldig.
Severyn zog die Brauen zusammen, als wollte er verdeutlichen, dass sie endlich den Mund halten sollte.
»Danke, Hoheit.« Der junge Bedienstete verneigte sich tief. Breya hatte Tränen in seinen Augen gesehen, die er nun rasch fortblinzelte. Er wandte sich an Severyn. »Ich werde jemand anderen holen, wenn ich zu ungeschickt bin.«
»Wir reden später über die Konsequenzen. Jetzt sieh nach meinen Gewändern. Weg mit dir, mit euch allen.« Severyn winkte den Bediensteten, die sich daraufhin rasch entfernten. Ein Dienstmädchen eilte noch herbei, um ihm den übriggebliebenen Rasierschaum wegzuwischen. Ein junger Mann half ihm in seinen Morgenmantel, da der Fürstensohn bis auf eine mondäne Hose aus handverwobenen, dunklen Leinen noch unbekleidet war. Schließlich waren alle fort und Severyn erhob sich aus dem Stuhl. Er prüfte sein Spiegelbild und richtete unzufrieden eine verirrte kiefernbraune Haarsträhne. »Ich habe dir gesagt, nicht in die Baderäume.«
»Du verbringst schon den ganzen Tag hier«, erwiderte Breya. »Seit heute um sechs in der Frühe! Soll ich warten bis zum Fest heute Abend? Das dauert eine Ewigkeit.«
»Du könntest mir zumindest nicht hereinreden, wenn ich das Wort erhebe«, sagte Severyn tadelnd. »Solch immerwährende Freundlichkeit untergräbt meine Autorität. Diese Bediensteten denken, ich stünde unter deinem Einfluss.«
Breya schmunzelte. »Tust du das denn nicht?«
In seinen Blick trat ein bedeutungsvolles Schimmern. »Ich würde dich hinauswerfen lassen, wärst du nicht so schön.«
Mit Amüsement verdrehte Breya die Augen, ehe sie die Arme um ihn schlang. »Alles Gute zum Geburtstag, Seryn. Und ein schönes Ostara.«
»Danke.« Er erwiderte die Umarmung. »Ich wünsche mir auch alles Gute zu meinem Geburtstag.«
Breya löste sich von ihm und schob sich eines der beiden geflochtenen Armbänder vom Handgelenk. Beide bestanden aus feinem, dunklen Leder und winzigen Silberstückchen. Über Severyns Lippen zuckte ein wohlwollendes Lächeln, als sie das Bändchen über sein Handgelenk streifte und festzog. Breya war sicher, er bemühte sich absichtlich, diese Abschätzigkeit zur Schau zu tragen. Warum sonst trug er ihr Geburtstagsbändchen jedes Jahr als Talisman, bis es ausblich oder Fransen bekam? Erst dann legte er es in ein Kästchen auf der Anrichte, in dem sich bald vier Bändchen befinden würden.
»Heute bin ich genauso alt wie du, als ich dir das erste geschenkt habe.«
»An dir ist eine Mathematikerin verloren gegangen«, meinte Severyn. Er löste sich von ihr und griff nach dem Weinkelch, der auf der Anrichte neben den Trauben stand. »Dann rasch, gib mir die anderen Geschenke. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit, schließlich ist dies mein Geburtstag.«
»Sicher.« Breya kam ihm rasch nach. Sie hob den Korb mit den Geschenken auf das Bett und setzte sich daneben. Severyn verdrehte unzufrieden die Augen, setzte sich aber zu ihr und ließ sich das erste Geschenk reichen. Es war eckig und in Seidenpapier verpackt.
»Was ist das? Sicher kein Buch.« Severyn riss das Papier auf und zog mit mäßiger Begeisterung die Brauen hoch. »Helden, Herrscher und Propheten.«
»Ich habe es schon dreimal gelesen. Jeder sollte es besitzen, finde ich.«
»Du weißt, ich gebe nicht viel auf Helden. Auch nicht auf Propheten. Auf Herrscher … na ja.«
»Lass dich darauf ein«, beharrte Breya und legte eine schmale Hand auf die seine. »Es wird dich sicher nicht enttäuschen.«
Severyn betrachtete das Buch leidenschaftslos. »Wollen wir es hoffen. Zeig, was gibt es noch? Was ist das dort?«
Breya reichte ihm das nächste Geschenk. »Dein Lieblingskonfekt, handverlesen. Ich habe extra darauf geachtet, dass sie nicht die mit den Pistazien dazulegen.«
»Fabelhaft. Du weißt noch, was letztes Mal passiert ist.«
»O ja! Du hast …«
»Reite nicht darauf herum. Was ist dies?«
Breya unterdrückte ein Schmunzeln und reichte ihm das nächste Päckchen, das ebenfalls in Papier eingeschlagen war. Severyn löste die Schnürung und schob es auf. Behutsam nahm er die drei Tiegel heraus und untersuchte sie neugierig.
»Du hast gesagt, bei Siebenfein gibt es die besten.« Farbgeruch stieg Breya in die Nase, als Severyn einen der Tiegel öffnete. »Ich habe die schönsten Farben ausgesucht. Haselnuss, Mistelgrün und Flieder. Waldfarben.«
Severyn neigte den Kopf, als wollte er gestehen, dass das gar nicht schlecht war. Breya meinte, seine Hände zucken zu sehen, als wollte er die Farben am liebsten gleich ausprobieren. Es erfüllte sie mit Stolz, dass sie seinen Geschmack getroffen hatte.
»Danke, Breya.«
Sie lächelte. »Dann noch dies!« Sie schob ihm den Korb hin.
Noch schien Severyn nicht abgeneigt. Er beugte sich vor und schlug das Seidentuch auseinander. Erst da runzelte er die Stirn. »Was ist das für Gesträuch?«
»Das ist kein Gesträuch, das sind Räucherbündel«, erklärte Breya. »Die Sagart benutzen solche, um Keyll Naomh ihre Zuneigung darzubieten und ihn um Unterstützung bei schwierigen Vorhaben zu bitten. Vor allem zu Ostara werden sie oft entzündet. Ich habe die Blumen selbst gezüchtet und die Blüten getrocknet. Und ich musste schon letztes Jahr damit anfangen – Salbei und Kugeldisteln blühen nämlich nur im Spätsommer und Herbst. Da, du musst sie bloß an der Spitze anzünden und in einer Schale langsam abbrennen lassen.«
Als Severyn skeptisch eine Augenbraue in die Höhe zog, wies sie auf das erste Bündel. »Das hier ist Schafgarbe. Es soll Schutz vor allem Bösen bieten.« Sie zeigte auf das nächste. »Blaustern, damit dir stets Loyalität entgegengebracht wird. Die Kugeldistel soll dafür sorgen, dass du deinen Stolz und deine Eminenz wahrst. Hier drin ist Hainblume, damit du siegreich bist. Und dann zuletzt die Myrte«, Breya berührte das letzte Bündel, »für ein gutes Schicksal.«
»Was ist mit Einfluss?«, fragte Severyn nicht ohne Spott. »Bewunderung? Macht? Tadellosem Aussehen?«
»Bescheidenheit wäre offenbar nicht unangebracht gewesen.« Breya stieß ihn an. »Komm, Seryn, sei kein Spielverderber.«
»Verzeih.« Er wedelte mit einem Bündel. »Aber damit kann ich nicht viel anfangen. Was du eigentlich wissen solltest.«
Sie ignorierte, wie abschätzig er die Brauen hob. »Ich möchte bloß, dass du immer in Sicherheit bist. Womöglich … kannst du sie irgendwann gebrauchen.«
»So kenne ich dich. Pathetisch und dramatisierend. Was hast du denn in deiner Malachitkugel gesehen, hm? Welche Schreckgestalt soll mich dieses Ostara in die Klauen bekommen?«
Breya schnaubte. Severyn würde ihr ohnehin nicht zuhören. Das war sein größter Makel: Dass er glaubte, ohne Fehler zu sein. Die Eshwen hatten den Glauben an Keyll Naomhs Seele schon vor vielen Jahren abgelegt und begegneten dem Wald mit Gleichgültigkeit. Und Severyn war ein selbstgefälliger, mottenliebender, Wälder verschmähender Eshwen, wie er im Buche stand.
Breya begriff das nicht. Spürte er denn nicht, wie lebendig die Macht der Wälder durch jedes Blatt pulsierte? Durch jeden Zweig? Sie spürte das jeden Tag.
Dass er auch so stur sein musste! Keyll Naomh würde es sicher nicht gutheißen, wenn ihm jemand mit Spott begegnete. Wenn sie etwas unternehmen konnte, um Severyn vor dem Zorn des Waldes zu schützen, würde sie nicht zurückschrecken. Ob er nun daran glaubte oder nicht, das spielte keine Rolle.
»Danke.« Severyn richtete sich auf. Breya kam ebenfalls auf die Beine. »Ich werde sie mal anzünden. Denke ich. Bei offenem Fenster. Oder draußen? Besser draußen.«
»Mehr möchte ich auch gar nicht.« Breya nickte zufrieden und strich ihm mit sanfter Hand eine verirrte Haarsträhne fort, was Severyn wohlwollend gewährte. Der feine Schnitt an seinem Hals war bereits verheilt. »Eshwenblut, Eshwenblut«, sagte Breya, »ist übrigens kein schlechter Zungenbrecher, wenn man es schnell sagt. Eshwenblut, Eshwenblut, Eshwenblut …«
»Weißt du, was mir gefällt?«, fragte Severyn, als er ihre Hand, die auf seiner Schulter liegen geblieben war, mit seiner umschloss. »Dass du kein Eshwenblut in dir trägst.« Er zog sie an sich und ehe Breya einen Laut machen konnte, hatte er ihre Lippen mit seinen verschlossen. Unter der Wärme ihrer Haut und dem sanften Streifen seines Atems suchte er sie, fordernd, mit Bestimmtheit. Severyn kannte den Weg. Breyas Hände fanden sein Gesicht – keineswegs um ihn fortzuschieben, sondern um ihn näher an sich zu ziehen. Ihr Herz bebte in ihrer Brust, erfüllt von dem kaum fassbaren Kribbeln in ihrem Inneren. Sie erwiderte seinen Kuss begierig, ihr Körper drängte sich wie selbstbestimmt an Severyns. Seine Hände glitten über ihre zarte Bluse und brachten sie zum Erschauern. Sie strich über die Stelle, an der seine verkümmerten Flügelreste lagen, die auf das Erbe der Eshwen hinwiesen.
»Severyn!«, drang der Bariton seines Vaters durch die Zimmerflucht und die beiden fuhren auseinander.
Fürst Barcat trat durch die geöffnete Flügeltür. Sein von einem dichten Bart dominiertes Gesicht trug den gewohnten herrschaftlichen Ausdruck. Die Brauen zogen sich tadelnd zusammen, als er die beiden entdeckte. »Ich dachte, wir hätten uns verstanden und ihr beschränkt euch auf ungestörte Augenblicke.«
»Es scheint euch allen entfallen zu sein«, sagte Severyn, der seinen Morgenmantel richtete, »aber das hier sind meine Privaträume.«
»Nerys ist in der Küche und stellt sicher, dass die Speisen wie gewünscht zubereitet werden.« Breya strich sich das Haar glatt. Ihre Lippen brannten, sogar mehr als ihre Wangen. »Sie wird nichts bemerken.«
Barcat hielt vor ihnen inne und musterte sie prüfend. Der Eshwenherrscher war eine Erscheinung, vor allem in den zeremoniellen Gewändern. Wams und Mantel waren mit Silber und Gold abgehoben. Den Rest der Kleidung durchsetzten dunkle, erdige Töne. Da der Fürst recht gedrungen war, wählte er oft dunkle Farben und hohe Stiefel, die ihn größer erscheinen lassen sollten. Breya fand, dass Barcat das nicht nötig hatte. Er war ein solch respekteinflößender Mann, dass auch seine eher geringe Größe dem keinen Abriss tat. Sein pelzbesetzter Umhang, der sich hinter ihm teilte und wie die Flügel seiner Ahnen gemustert war, fiel schwer über den glatten Marmor. Der gewundene Reif, seine Krone, hob sich golden vom Haar ab. Zwei Keitha, in dunkle, aufpolierte Rüstungen gekleidet, waren hinter dem Fürsten an der großen Fensterflucht postiert.
»Und wo sind die Bediensteten? Warum wirst du nicht vorbereitet?«, fragte Barcat. Er klatschte in die Hände und rief mit donnernder Stimme: »Sammeln! Macht gefälligst eure Arbeit! Nicht auf der faulen Haut liegen!«
Breya wollte zum Sprechen ansetzen, doch der Fürst kam ihr zuvor:
»Breya! Die Gräfin von Caru’hen wird verfrüht eintreffen und auch die anderen Gäste erscheinen bald. Ich wünsche, dich in fünfzehn Minuten unten im Hof zu sehen, um sie gemeinsam mit Nerys zu empfangen.«
»Ist gut. Ich muss nur rasch umgezogen werden.«
»Und du, Sohn, lass dich für die Zeremonien einkleiden. Du musst einen herausragenden Eindruck machen.«
Severyn nickte, während die Bediensteten um ihn herumwuselten. »Ihr habt es gehört. Beeilung!«
Barcat trat auf Severyn zu, woraufhin die Angestellten einen demütigen Bogen um ihn schlugen. Der Fürst war gedrungener als sein Sohn, doch sein Ausdruck zeugte von Autorität, Einfluss, Weisheit. Severyn neigte den Kopf, als Fürst Barcat seine Hand mit beiden ergriff. »Alles Gute zum Geburtstag, Sohn. Heute ist ein bedeutsamer Tag. Du vollendest dein einundzwanzigstes Lebensjahr und wirst in den Rat der Drei aufgenommen.«
»Ich weiß, Vater«, sagte Severyn mit Demut. »Das ist eine große Ehre.«
»Beweise dich. Zeige mir, dass du ein würdiger Nachfolger bist, Severyn.« Sein Vater ließ die Hände sinken und Breya entdeckte einen Ring in Severyns Fingern. Zwei kleine, goldgestanzte Motten umwoben einander auf dem Siegel. Fürst Barcat nickte bedeutsam. »Dann wirst du eines Tages mehr als meinen Siegelring tragen.«
Severyn nickte achtungsvoll. »Ich weiß dein Vertrauen zu schätzen. Danke, Vater.«
»Trag ihn mit Stolz. Mach mich stolz, Severyn.« Barcat wandte sich Breya zu und stupste sie an. »Und du ebenso, Mädchen.«
»Danke, Barcat.« Breya neigte den Kopf, die Hände ineinander geschlossen.
»Und seid vorsichtig«, setzte er noch dahinter. »Wenn jemand erfährt, was hier hinter geschlossenen Türen vor sich geht, bleiben die Probleme an mir haften.«
»Geheimnisse gehören gewahrt«, sagte Breya höflich. Das Netz an Lügen war ohnehin so schwierig zu entwirren, dass sie es besser ruhen ließ und Severyns Nähe nur in Stille und Ungestörtheit genoss.
»Beeilt euch jetzt«, drängte der Fürst. »Du willst die Gräfin nicht warten lassen. Du weißt, wie unbequem sie werden kann.«
Severyn winkte die Bediensteten näher und ließ sich den Morgenmantel abnehmen, wobei er Breya noch einmal zulächelte. Fürst Barcat wandte sich zum Gehen, die Keitha kamen ihm in stummem Einvernehmen nach.
Breya lief ebenfalls zur Tür, um sich zurück in ihre eigenen Gemächer zu begeben. Vom Fenster aus konnte sie sehen, wie die Sonne über der Stadt strahlte, alles in wunderschönes Licht tauchte. Die Wipfel Keyll Naomhs wurden von der Sonne beschienen und erstreckten sich um die Stadt herum, soweit das Auge reichte. Heute würde ein guter Abend werden. Schließlich war es ein heiliger Tag für ihren Wald – Severyns Geburtstag und zugleich das Frühlingsfest.
»Barcat?«, fragte sie, während sie dem Fürsten folgte.
»Ja, Mädchen?«
»Wie oft kannst du Eshwenblut hintereinander sagen, ohne dich zu versprechen?«
Als Adeena ein Kind gewesen war, hatte sie oft stumm am Fenster gesessen.
Die anderen hatten sie misstrauisch beäugt, wenn sie stundenlang innegehalten hatte, wortlos, reglos. Sie hatte gewusst, dass die Angestellten des Anwesens hinter vorgehaltener Hand über sie sprachen. Dass auch ihre Mutter argwöhnisch und besorgt war, wenn Adeena dort am Fenster saß. Warum spricht sie nicht, hatten sie gefragt, sie alle. Warum sagt sie nie etwas? Warum schaut sie so drein, warum geht sie so krumm? Und dann hatten sie dahinter gesetzt: Man sollte ihr eine Falle stellen. Eierschalen verteilen, ihr eine Schuhsohle zum Essen vorsetzen oder dergleichen. Ob sie das Amadeus Ewig beten kann? Ich habe sie nie beten gehört …
Immer wieder hatten sie so geflüstert. Merkwürdig, falsch, dieses Kind.
Dabei war Adeena bloß nachdenklich gewesen.
Ihr Vater hatte ihr erzählt, dass der Rest der Welt, außerhalb von Austradar, gänzlich mit Wald bedeckt war. Adeena hatte das kaum begreifen können. Sie kannte bloß die lichten Haine ihrer Heimat, und die bloß von weitem. Wie wäre das, so weit das Auge reichte nur Grün zu finden?
Aber der Wald war schlecht. Er wollte Böses, er säte Schlechtes. Solche wie sie. Der gute Mensch blieb sicher im heimischen Austradar, bewahrt vor den Gefahren der Wälder, die bloß Unheil über sie brachten.
Adeena war nachdenklich gewesen, und auch ein wenig traurig. Warum sprachen die Bediensteten über sie, als sei sie jemand Fremdes? Warum schaute ihre Mutter sie an, als sähe sie keine Tochter in ihr? Fürchteten sie sich vor ihr, weil sie so krumm ging?
Musste man sich vor ihr fürchten? War Adeena tatsächlich, was sie sich hinter vorgehaltener Hand zuflüsterten?
Heute blickte Adeena wieder aus dem Fenster. Wann immer die Kutsche, die sie zum Schloss des Eshwenfürsten hinaufbrachte, so auf den Serpentinen herumschwenkte, dass die Stadt und die Wälder in Sicht gerieten, weitete sie voll Faszination die Augen. Welch eine Übermacht! Wie weit man sehen konnte, ohne dass das Grün der Wipfel dem Blick wich. Voll Bewunderung sah sie zu, wie sich die goldene Frühlingssonne auf dem dichten Blätterdach brach. Unter ihnen, umgeben von diesem faszinierenden Wald, befand sich das in bunten Farben schimmernde Dinas Rhedyn.
Sie waren durch den Wald gereist, eine Woche lang von Gasthaus zu Gasthaus. Auf den dick gepflasterten Wegen mit Umzäunungen und Gräben, die Reisende von den Bäumen, dem Farn, den Sträuchern trennten. Ihr Vater, ein Diplomat Kaiser Ferdinands, nahm diesen Weg stets, wenn er nach Dinas Rhedyn reiste. Es war die sicherste Route durch Keyll Naomh, hatte er versichert, und es war auch nichts geschehen.
Der Wald aber, so hatte Adeena festgestellt, wich vor dem Kopfsteinpflaster nicht zurück wie vor der feurigen Barriere, die ihn von ihrer Heimat trennte. Nein, er versuchte, sich diese Straße zurückzuholen. Sprösslinge, Farne und Triebe junger Bäume brachen aus dem Gestein hervor, Ranken umwoben die Umzäunungen, Blüten und Gräser sprossen im Wasser der Gräben. In unstillbarer Gier fraß der Wald sich durch Mörtel und Granit, durchbrach Stein, verschlang Struktur und Ordnung.
Adeena war Keyll Naomh mit dem Respekt begegnet, der ihm gebührte. Sie hatte die Gefahr gespürt, die von ihm ausging, die Wildheit und Unberechenbarkeit der dichten Zweige. Ja, es war wahrlich besser, den Wäldern fernzubleiben, einen sicheren Abstand zu wahren. Nur in dem Gasthaus, das in den ersten Ausläufern der uralten Wälder gelegen hatte – Lithasonn, sie hatte sich den Namen gemerkt –, hatte sie sich ein Stück weiter gewagt. Sie war ein paar Schritte zwischen die Stämme und das Blattwerk hinter das Haus getreten. Ihre Hände hatten die silbrige Rinde berührt, das weiche Moos und die feinen Farne auf der Haut gefühlt. Sie spürte uralte Kraft durch die Adern der Blätter und das Innere der Bäume pulsieren. Sie atmete seine Macht mit dem Blüten- und Rindenduft, hörte ihn im Klang des stetigen Summens und Vibrierens. Adeena hatte den Wald respekteinflößend gefunden, verwunschen, gefährlich und auf eine eigentümliche Weise wunderschön. War das, was sie fühlen sollte? Empfand nur sie Achtung vor diesem Wesen, verspürte nur sie Ehrfurcht und Bewunderung? War es ein Zeichen dafür, dass sie tatsächlich seine Brut war, wie die Bediensteten auf dem Anwesen zuhause sich zuflüsterten?
»Gefällt dir der Anblick?«, fragte ihr Vater und Adeena wandte sich zum ersten Mal vom Fenster ab, seit sie die Auffahrt begonnen hatten. Der Landgraf musterte sie über seine Reiselektüre hinweg.
»Ja«, sagte sie. »Bei Amadeus, mehr als alles andere.«
Jakob Klingwahr schmunzelte. »Weißt du, es gab Tage, da habe ich befürchtet, du könntest gar nicht lächeln.«
Adeenas Mundwinkel zuckten. »Ich dachte immer, du hättest übertrieben, als du von der Schönheit der Welt gesprochen hast.«
»Ah! Die Welt ist ein Ort voller Gefahren«, sinnierte Jakob Klingwahr. »Voller Tücken, Lügen, Gier. Aber weißt du, ich würde sie nicht bereisen, wenn ich sie nicht auch auf eine Art und Weise schön finden würde.« Er lehnte den Hinterkopf an das Polster der Kutsche. Sein Haar ergraute an den Schläfen, aber Adeena fand, dass das Silber ihn würdevoller erscheinen ließ. Ihr Vater war ein Träumer, das war ihr schon vor langer Zeit bewusst geworden. Dass er dieselbe Faszination gegenüber den Wäldern verspürte wie sie, war beruhigend. Es ließ sie hoffen, dass sie normal war.
»Danke.« Adeena strich eine Haarsträhne fort. »Weil du mich mitgenommen hast, Papa.«
»Für das Lächeln hat es sich gelohnt.« Der Landgraf betrachtete sie liebevoll. Ihr Vater war stets der Einzige gewesen, der sie nicht wie einen Fremdkörper behandelt hatte. Er hatte akzeptiert, dass sie still war, dass sie in ihrer eigenen Welt lebte, die mit ihren eigenen Gedanken gefüllt war. Er hatte sie immer gemocht, wie sie war, selbst mit ihrer krummen Hüfte und ihren Ohren, die spitzer zuliefen als gewöhnlich.
Adeena spähte nochmals hinter den Vorhang. Die Kutsche hatte wieder eine Kurve genommen und sie konnte den Wald in all seiner Pracht bewundern. Unten auf den Straßen gingen die Bürger von Dinas Rhedyn, klein wie Ameisen, ihrem Tagewerk nach und bereiteten sich auf das bevorstehende Fest vor. »Ich könnte mir das den ganzen Tag ansehen. Papa, du brauchst mich heute Abend gar nicht, oder? Ich könnte einfach – du weißt schon … nicht zum Fest gehen. Dafür ein bisschen draußen auf den Balkon oder …«
»Sicher«, sagte Jakob amüsiert. »Überspring den Grund, aus dem wir gekommen sind. Um dir Dinge anzusehen.«
Sie schüttelte den Kopf. »Du hattest ewige Jahre Zeit, um dir alles anzuschauen! Aber ich? Nur so kurz.« Sie zeigte eine winzige Menge mit den behandschuhten Fingern.
»Es gibt auch im Ballsaal genug Dinge zum Ansehen. Und sicher verzehren sich alle danach, meine wundervolle Tochter kennenzulernen.«
Adeena schmunzelte, als er ihr eine verrutschte Falte des Chiffonkleides richtete. Die Geste erinnerte sie an Lichterfeste, Zimtgeruch und Geschenke aus der weiten Welt, an Kinderbücher, die er vorlas, und die Ausflüge, auf denen er sie auf dem Rücken die Berggipfel des Lausass’ hinaufgetragen hatte. Sie dankte Amadeus, dass er sie mit einem solchen Mann gesegnet hatte. Er hatte sie mitgenommen, obwohl ihm alle davon abgeraten hatten. Es war gefährlich in der Welt – doch vor allem hatte jeder gefürchtet, sie könnte auf ihren Vater und die Familie ein schlechtes Licht werfen, wenn sie ihn auf den Geburtstag dieses Fürstensohns begleitete.
Adeena interessierte sich nicht für die Meinung der Eshwen. Sollten diese Menschen sie doch verachten. Sie begehrte die fremden Gerüche und Geräusche, die fremden Personen, die Erinnerungen, die sie in ihrem Herzen bewahren konnte. Sie hatte sich danach gesehnt, zu wissen, ob die Wälder der Ort waren, an dem sie zuhause war.
Wie schlimm konnte es sein? Sie war gewohnt, dass man sie schief ansah. Adeena fürchtete sich nicht davor. Nur ein kleiner Teil ihres Herzens hoffte, dass man ihr hier weniger Missgunst entgegenbringen würde als daheim. Die Eshwen waren dem Wald nicht so abgeneigt wie die Austrier, aber auch nicht so zugetan wie die Skoggen. Deswegen betrieb Kaiser Ferdinand noch immer Handel mit ihnen, pflegte eine Beziehung, die ihm womöglich irgendwann Vorteile einbringen würde. Und vielleicht würde auch sie hier etwas Gutes finden.
Ihr Herz tat einen Satz, als die Kutsche zum Halten kam und die Tür zur Kabine kurz darauf geöffnet wurde. Ihr Vater klappte seinen Reiseroman zu. »Na los.« Da er an der Tür saß, musste er zuerst aussteigen. Adeena gab sich einen Ruck und richtete sich mit Mühe auf, um ihm nachzukommen. Hilfsbereit hielt ihr Vater ihr eine Hand hin, sodass Adeena sich an ihm und der Tür abstützen konnte, als sie das Innere der Kutsche verließ. Ihre Hüfte ließ den alten, dumpfen Schmerz verkünden, als sie sich aufrichtete, die Glieder steif vom langen Sitzen.
Sonnenlicht empfing sie, wärmte ihr die blasse, von weißer Seide bedeckte Haut. Sie befanden sich im Hof des Palasts und die Sicht war nunmehr von einer dicken Schlossmauer verwehrt. Der Palast derweil ragte weiß und sandsteinfarben vor ihnen in den Himmel. Wunderschöne Spitzbögen mit von steingemeißelten Blüten bestückten Ziergiebeln wölbten sich in den hohen Mauern. Das viele kunstvoll verarbeitete Strebewerk, die Rippengewölbe und Figurenportale ließen sich so rasch kaum erfassen. Vom Hauptgebäude erhoben sich schlanke, spitz zulaufende Pinakel, über dem hochgesäumten Portal thronte ein imposantes Rosettenfenster. Überall befanden sich Statuen, ob in den Giebeln und Erkern, in den angrenzenden Gärten oder an den Treppenaufgängen. Adeena kannte die Eshwener Bildhauerkunst von den kleinen Marmorskulpturen, die ihr Vater manchmal mitbrachte. Die Figuren, oftmals Helden und Götzenbilder, Gargoyle und mystische Kreaturen, schienen so lebensecht, dass einige Austrier der Meinung waren, die Eshwen könnten Lebewesen zu Stein machen.
Die Eshwen begegneten der Natur mit Entgegenkommen. Gewundene Kletterrosen, wilde Blüten und Sträucher fanden sich zwischen ordentlich gestutzten Buchsbäumen und Zypressen. Ihr Vater hatte ihr einmal erzählt, dass der Palast von Skoggen der Natur noch viel zugetaner war: Dass der Wald die Mauern und Streben dort so stark überwuchert hatte, dass das Gebäude einstürzen würde, sollten die Ranken eines Tages aufhören, es zu stützen. In der hier herrschenden Unruhe fand sich immerhin eine gewisse Ordnung, wie Adeena bemerkte. So wurde den Ranken an den Gebäudetrakten der Bediensteten mehr Raum gewährt als am Mauerwerk des tatsächlichen Palasts. Die hellen Balustraden und Reliefs, die das Hauptgebäude schmückten, waren gänzlich frei von Ranken. Auch in den Gärten schien man dem Wald bloß da Freiheit zu gewähren, wo es positiv zum Erscheinungsbild des Palasts beitrug.
Beinahe wurde Adeena schwindlig von all den Eindrücken, der blütengeschwängerten Luft und der Sonne. Das fremdartig gestaltete Schloss beeindruckte sie, doch sie empfand auch gewisses Unbehagen. Zuhause in Austradar war alles rein und geordnet. Adeena gefiel diese Ordnung, die Beständigkeit und Ruhe, die sie brachte. Ihr Leben war durcheinander genug und es beruhigte sie, dass immerhin ihre Umgebung über eine klare Struktur verfügte.
Sie hob den Kopf, als ihr Name fiel: »Landgraf Jakob Siegfried Klingwahr mit seiner Tochter, Dame Adeena Klingwahr. Abgesandte des Kaisers Ferdinand von Austradar.«
Der Page stand neben einer blonden Frau und einem ebenfalls blonden Mädchen von etwa siebzehn Jahren. Beide waren in edle, seidene Gewänder gekleidet – rauchfarbener Stoff mit dezent gewähltem, aber wertvoll erscheinendem Schmuck in Grün und Gold. Auf dem hellen Haar der Frau saß ein goldenes Diadem. Aus ihren Augen sprach mäßiger Intellekt, aber ihre Haltung war erhaben. Neben ihnen befanden sich noch weitere Personen im Burghof, gut gekleidete Adlige und vorbeieilende Angestellte.
Ihr Vater verneigte sich und küsste die Luft über der Hand der Fürstin. »Fürstin Nerys.« Auch die Hand des Mädchens ergriff er. »Prinzessin Breya. Es ist mir eine Ehre, heute in Eurem Palast willkommen geheißen zu werden.«
»Wir sind dankbar, Euch empfangen zu dürfen, Landgraf Klingwahr«, sagte die Fürstin. Ihr Lächeln war Adeena ein bisschen zu aufgesetzt, während das Mädchen an ihrer Seite durchaus sympathisch erschien. Adeena versank rasch in einem möglichst gewählten Knicks. »Auch ich freue mich, dem Fest beiwohnen zu dürfen. Es ist das erste Mal, dass ich Gast in Eshwen sein darf, und es ist wahrlich überwältigend schön, wenn Ihr es mir zu sagen erlaubt.«
»Und noch ein wenig schöner durch Euer Eintreffen hier.« Die Fürstin strahlte sie an und Adeena spannte unmerklich die Schultern. War das ernst gemeint? Sie konnte es nicht von der Miene der Herrscherin ablesen, doch Prinzessin Breya neben ihr schmunzelte amüsiert.
»Ihr seid sehr hübsch, Frau Klingwahr.«
»Danke. Ihr auch«, sagte Adeena aufrichtig.
»Darf man dem Prinzen gratulieren?«, fragte Jakob Klingwahr. »Wir haben ein Geschenk des Kaisers dabei, das ihm hoffentlich zusagen wird.«
»Er wird noch angekleidet, Ihr begegnet ihm am Abend. Ich bin sicher, er wird Eurer Anwesenheit sehr zugetan sein«, sagte Fürstin Nerys glücklich. »Eine so wunderbare junge Frau, die ihm im Alter auch so wunderbar gleicht. Schönes, dunkles Haar habt Ihr, ein hübsches Gesicht. Man sagt, Ihr spielt die Harfe?«
»Ja, tue ich.« In den Augen ihres Vaters fand Adeena dasselbe Amüsement, das auch in ihrem Herzen flatterte. Sie war weit von einer Verbindung entfernt, wie Nerys sie offenbar im Sinn hatte. Aber dass die Fürstin es in Betracht zog, schmeichelte ihr durchaus.
Nerys machte eine einladende Geste. »Bitte, Eure Reise war sicher beschwerlich. Tretet ein. Unsere Bediensteten werden Euch den Weg zu Euren Gemächern zeigen, in denen Ihr ausruhen könnt. Euer Gepäck wird man hinaufbringen.«
Ihr Vater neigte den Kopf und bot Adeena den Arm. Diese trat dankbar auf ihn zu, um seine Hilfe entgegenzunehmen.
Die Anwesenden im Hof begannen zu tuscheln.
Adeena humpelte zu ihrem Vater, wenngleich ihre Hüfte bei jedem Schritt mit dem rechten Bein einknickte. Als sie aus der Kutsche gestiegen war, hatte man das Humpeln sicher nur auf die Steifheit ihrer Glieder oder Ungeschicklichkeit geschoben. Nun aber wurde deutlich, dass mit ihr etwas nicht stimmte. Heiß spürte sie die Blicke der Eshwen im Nacken, als sie den Arm ihres Vaters ergriff. Sie hörte die Stimmen, vermischt mit denen der Austrier daheim, ihrer Mutter, ihrer Schwester: Ein Wechselbalg. Der Landgraf hat ein Wechselbalg im Haus.
»Ich wusste nicht, dass Eure Tochter so … beeinträchtigt ist«, murmelte Fürstin Nerys, auf deren Gesicht ein merkwürdiger Ausdruck getreten war. Wenn Adeena nicht alles täuschte, war sie einen Schritt zurückgewichen.
»Eine angeborene Fehlstellung der Hüfte«, erklärte Jakob Klingwahr geduldig. »Es ist bedauerlich, aber leider nicht zu ändern.«
»Sie zeigt aber keine … Anzeichen?«, fragte Nerys. »Ihre Füße sehen nicht merkwürdig aus? Zeig deine Ohren, Kind.«
»Hoheit«, sagte ihr Vater höflich, als Adeena den Kopf schütteln wollte. Ihr Herz war schwer wie Stein. Sie wünschte sich heim, oder nein, zurück in die Kutsche – denn zuhause sah man sie ebenso an wie hier. »Bitte. Sie ist kein Wechselbalg.«
Nerys hatte den Kopf gehoben und schien tief einatmen zu müssen, ehe sie nickte. In Prinzessin Breyas Augen lag ein mitfühlender Ausdruck. Adeena war nicht ganz sicher, was am schlimmsten war: Das Mitleid, die Abscheu oder ihre eigene Scham, dem Ruf ihres Vaters geschadet zu haben. »Nun gut«, sagte die Fürstin mit einem Räuspern. »Sicher ist sie das nicht. Wechselbälger sollen ja sehr hässlich sein, und das kann man von Eurer Tochter nicht sagen. Bitte, wir sehen einander heute Abend.«
Nichts war fürchterlicher, als am Arm ihres Vaters den Hof zu durchqueren und die Treppenstufen zu erklimmen. Adeena musste jede Stufe einzeln beschreiten, mit beiden Füßen. Ihre Hüfte brannte, es dauerte ein Leben lang und mit jedem Schritt sengte sich die Aufmerksamkeit der anwesenden Personen in ihren Rücken, hörte sie ihr Tuscheln.
Warum haben sie eine solche nicht längst weggegeben? Wissen die Austrier überhaupt, was ein Wechselbalg ist? Was man sich da ins Haus holt?
Ihr Gemach lag im ersten Stock. Als Adeena die Treppen erklommen hatte und die letzten Schritte bis ins Zimmer gehinkt war, schleppte sie sich durch den Raum, stützte sich auf dem Fensterbrett ab und drängte die Tränen weg.
»Adeena.«
»Schon gut.« Sie blinzelte ins Sonnenlicht, vertrieb den Kloß in ihrem Hals, während ihr Vater die Tür ins Schloss fallen ließ. »Schon gut, ich muss nicht weinen. Ich … wusste, dass das passieren wird.« Aber sie hatte gehofft, dass es nicht so enden würde. Viel mehr, als sie sich eingestanden hatte.
Die junge Frau zuckte, als ihr Vater ihr die Hände auf den Rücken legte. Sein vertrauter Geruch, die Wärme, die von ihm ausging, waren tröstlich und schmerzhaft zugleich.
»Ich will nicht auf diese Feier.«
»Adeena.« Die Stimme ihres Vaters war sanft. »Du bist geladen worden … wir kommen nicht mehr heraus aus dieser Sache.«
»Ich kann behaupten, unpässlich zu sein …«
»Adeena.« Ihr Vater trat ans Fensterbrett, sodass sie sich ihm zuwenden musste. »Lass dich nicht so vom Wort dieser Menschen beeinflussen. Ich weiß, das ist nicht einfach. Aber diese Prinzessin erschien mir recht zugänglich, und die Fürstin werde ich überzeugen, dass du ein ganz gewöhnliches Mädchen bist. Womöglich ist der Prinz auch nicht abgeneigt, wenn er ein bisschen so wie seine Schwester ist?« Er strich ihr mit dem Daumen über die Wange. »Nimm deine Erinnerungen, Adeena. Sie stehen dir zu.«
Adeena konnte ihn nicht anschauen. Sie war nicht sicher, ob sie diese Erinnerungen wollte, wenn sie von Abneigung und Missgunst handelten. »Es tut mir leid, dass du jetzt in Schwierigkeiten bist. Es war dumm mitzukommen.«
Ihr Vater nahm sie in den Arm. Adeena spürte seine bärtige Wange an ihrer Stirn, seine warmen Hände auf ihrem Rücken. »Ich bin froh, dass du hier bist. Ich habe eine fabelhafte Tochter. Und ich werde sie auf diesem Ball präsentieren wie das wunderschöne Mädchen, das sie ist.«
Adeena blinzelte. Mit brennenden Augen sah sie zu ihm hoch – erfüllt von Wärme, nicht mehr so sehr von Traurigkeit. »Und du bist die ganze Zeit bei mir?«
»Na sicher.« Er stupste gegen ihre Nase und Adeena lachte.
»Danke, Papa«, sagte sie. »Danke.«